


Online-Handbuch
Inklusion als Menschenrecht
www.inklusion-als-menschenrecht.de
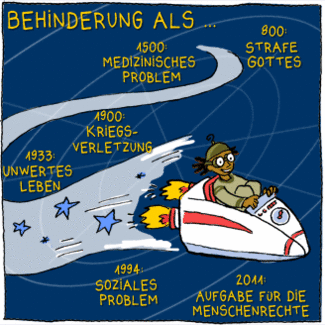
Die Zeitleiste
Menüleiste und Aktivität
Die Zeitleiste ist das Herzstück des Online-Handbuchs! Durch sie ist es möglich, einen Überblick zu bekommen darüber, wie sich die Einstellungen zu Behinderung und die Rechtswirklichkeit für Menschen mit Behinderungen im Wandel der Zeit entwickelt haben.
Über die Zeitleiste erreichst du einerseits alle Inhalte der Website - sie ist die Menüleiste. Zum anderen kannst du dir mit den Kurzbeschreibungen der Epochen von der Antike bis heute sowie den dazugehörigen Biografien und Gesetzen einen Überblick verschaffen über die sich verändernde Rechtslage und die Haltungen gegenüber Menschen mit Behinderungen im Wandel der Zeit. Dabei wird deutlich, welche Faktoren in der jeweiligen Epoche für die Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderungen wichtig waren bzw. sind, und welche Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung, Arbeit, der Gesellschaft etc. sie hatten bzw. haben.
Lerngruppen können sich durch die Arbeit mit den Epochentexten, den Biografien und den Gesetzen in Eigenarbeit einen fundierten Überblick verschaffen. Ihr könnt dabei erkennen, welche Entwicklungsschritte sich auf dem Weg zur vollen und gleichen Anerkennung der Menschenrechte behinderter Menschen vollzogen haben.
Die Kleingruppenarbeit funktioniert am besten, wenn ihr die jeweiligen Texte und Biografien zu den Epochen (von der Antike bis heute) gleichmäßig auf die Gruppen verteilt.
Die Texte, Biografien und Gesetze, die ihr in der Zeitleiste findet, könnt ihr jeweils einzeln ausdrucken und damit in der Gruppe arbeiten.
Tipp: Schwere Wörter sind verlinkt und werden im Glossar erklärt.
Infos zur Aktivität
Anzahl Teilnehmende:
7 bis 21
Dauer:
ca. 2,5 Stunden
Material:
7 Poster, Klebeband o. ä., um die Poster nebeneinander an der Wand zu befestigen, 7 dicke Stifte, Kopien aller Texte.
Ablauf:
Phase 1: Lesen, Verstehen, Austausch/Diskussion in Arbeitsgruppen (ca. 60 Minuten)
Druckt euch die Texte zur Haltung gegenüber und Rechtswirklichkeit von Menschen mit Behinderungen für jede Zeit aus.
Verteilt euch in sieben gleich große Gruppen und lest in jeder Gruppe einen der sieben Texte einer Epoche.
Diskutiert anschließend, was ihr gelesen habt und fasst die wesentlichen Punkte auf einem Poster zusammen. Orientiert euch dabei an den folgenden Fragen:
- Wenn ihr euch noch nicht kennt, könnt ihr mit einer kurzen Vorstellung einsteigen: Wie heißt du, warum nimmst du an dem Seminar teil, welchen Bezug hast du zum Thema Behinderung?
- Welche Information der Epoche in eurem Text waren besonders interessant?
Versucht außerdem in den Texten Hinweise zu finden, die euch bei der Beantwortung folgender Fragen helfen:
- Welche Faktoren spielten in der Zeit eine entscheidende Rolle dafür, ob und wie ein Mensch mit Behinderungen sein Leben gestalten konnte: Alter, finanzielle Situation, Geschlecht, Herkunft, Wohnort, Glaube/Religion, Familienstand, Zugang zu Bildung in der Familie oder Schule, Vorstellungen des Einzelnen, Art der Behinderung, sexuelle Orientierung, Aussehen?
- Welche dieser Faktoren waren möglicherweise hilfreich für die Menschen, welche erschwerten ihnen das Leben?
- Was dachten zu der Zeit viele Menschen über Behinderungen und Krankheiten?
- Welche Möglichkeiten hatten Menschen mit Behinderungen zu dieser Zeit, einen Beruf auszuüben oder eine Schule zu besuchen? Wie konnten sie Geld verdienen?
Phase 2: Präsentation und Diskussion der Ergebnisse in der Gesamtgruppe (ca. 80 Minuten).
Stellt euch eure Ergebnisse chronologisch von der Antike bis heute gegenseitig vor (ca. 10 Minuten pro Gruppe). Versucht Fragen, die andere Gruppen euch stellen, zu beantworten, auch wenn dazu im Text selbst nichts stand. Wenn ihr sie nicht beantworten könnt, diskutiert in der Gesamtgruppe, wie die Antwort aussehen könnte.
Tipps zur Weiterarbeit:
- Ordnet auf einer Zeittafel die Ereignisse der Zeitleiste anderen geschichtlichen Ereignissen in dieser Zeit auf der Welt zu.
- Recherchiert im Internet nach weiteren Menschen, die Behinderungen hatten und die in der jeweiligen Zeit lebten.
- Schreibt die Wörter auf, die euch in den Texten auffallen: Welche Sprache wird verwendet und welche Bedeutung haben die Wörter, die in den Gesetzen für Behinderungen verwendet werden, für uns heute?
Übersicht aller Übungen nach Schwierigkeitsgrad, Lernfeld und Zeitumfang
| Übung | Schwierigkeitsgrad | Gebiet | Typ | Lernumgebung | Epoche | Zeit |
| Arbeiten mit der Zeitleiste | schwer | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien, Materialien, Gesetze | Schule, außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Selbststudium | Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR, Gegenwart, Nationalsozialismus, Neuste Geschichte, Neuzeit, Mittelalter, Antike | 2,5 h |
| NS-Verfolgte im Alter | schwer | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Materialien, Zusatzinformationen | Fachschule | Nationalsozialismus | variabel |
| Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus | schwer | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Materialien | Schule, außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Selbststudium | Nationalsozialismus | variabel |
| Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache | mittel - schwer | Ethik/Lebenskunde Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Sprachen | Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium | Gegenwart | 1,5 h |
| Planspiel: Die Verhandlungen über die Behindertenrechtskonvention bei den Vereinten Nationen | schwer | Ethik/Lebenskunde Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 5-6 h |
| Rollenspiel: Talkshow | mittel | Ethik/Lebenskunde Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 3 h |
| Persönliche Zukunftsplanung: Inklusion als Menschenrecht | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Materialien | Kindergarten, Schule | Gegenwart | variabel |
| Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive auf der Suche nach Barrieren | leicht - mittel | Ethik/Lebenskunde Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Mathe | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 1-3 h |
| Denkmalstreit | mittel | Ethik/Lebenskunde Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Philosophie | Spiele, Materialien | Außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule | Gegenwart | 1-2 h |
| "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius" | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien, Materialien | Schule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Antike | 1-2 h |
| Ballade von Hester Jonas | mittel | Ethik/Lebenskunde, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Philosophie, Geschichte, Sprachen | Biografien | Fachschule, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Hochschule, Jugendgruppe | Neuzeit | 1-2 h |
| Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 1-2 h |
| Stephen Hawking - Geist und Körper, schön und doof, klug und hässlich? | mittel | Ethik/Lebenskunde Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Materialien | Schule, außerschulische Bildung, Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Selbststudium | Nachkriegsdeutschland | 1-2 h |
| Biografien | ||||||
| Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Kaiser Claudius) | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Sprachen, Philosophie | Biografien | Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Fachschule | Antike | 0,5-1 h |
| Gottfried "Götz" von Berlichingen | mittel | Ethik/Lebenskunde, Fachschule, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Sprachen, Philosophie | Biografien | Hochschule, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Jugendgruppe | Mittelalter | 0,5-1 h |
| KARL VI. | mittel | Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen, Ethik/Lebenskunde | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Mittelalter | 0,5-1 h |
| Ludwig van Beethoven | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 0,5-1 h |
| Hester Jonas | mittel | Ethik/Lebenskunde, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Kunst, Philosophie, Geschichte, Sprachen | Biografien | Fachschule, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung, Hochschule, Jugendgruppe | Neuzeit | 0,5–1 h |
| Eugenie Marlitt | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 0,5-1 h |
| Maria Theresia Paradis | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuzeit | 0,5-1 h |
| Marie Gruhl | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuste Geschichte | 0,5-1 h |
| Margarete Steiff | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie, Sprachen | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Neuste Geschichte | 0,5-1 h |
| Otto Perl | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |
| Anna Eleanor Roosevelt | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |
| Franklin Delano Roosevelt | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |
| Hilde Wulff | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nationalsozialismus | 0,5-1 h |
| Stephen William Hawking | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR | 0,5-1 h |
| Petra Stephan | mittel | Ethik/Lebenskunde, Fachschule, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR | 0,5-1 h |
| Pablo Pineda | mittel | Ethik/Lebenskunde, Geschichte, Gesellschaftskunde/ Sozialkunde, Philosophie | Biografien | Fachschule, Hochschule, Jugendgruppe, Schule, Selbststudium, außerschulische Bildung | Gegenwart | 0,5-1 h |
Antike

Römische Antike
(ca. 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung bis 500 nach Beginn unserer Zeitrechnung)
Recht und Gerechtigkeit
Das römische Zwölftafelgesetz, um 450 vor der Zeitrechnung entstandene Holztafeln, fasst schriftlich die Vorstellungen von Recht, Rechtsprechung und Gerechtigkeit zusammen, die zu diesem Zeitpunkt im römischen Gebiet entstanden waren. Regeln und Gesetze gab es allerdings schon viel länger. Sie waren vor der Erfindung des Papiers häufig in Stein gehauen worden. Die 12 Tafeln des römischen Gesetzes und andere Gesetze dieser Zeit begründeten im Gegensatz zu der Zeit vorher erstmalig Vorstellungen über Recht und Gerechtigkeit, die teilweise auch heute noch bekannt sind. Einige der in den Tafeln festgehaltenen Vorstellungen darüber, was als gerecht gilt oder wie Recht durchzusetzen oder zu sprechen ist, finden sich deshalb auch heute noch in wichtigen Rechtstexten wieder – andere finden wir heute grausam.
Das römische Zwölftafelgesetz
Das römische Zwölftafelgesetz wurde ständig verändert und weiterentwickelt. Es galt für männliche, freie, römische Bürger und enthielt Regelungen dazu, wie Anklage erhoben werden kann und welche Taten wie bestraft werden. So durften Angeklagte gefoltert werden. Sie konnten in Schauprozessen verurteilt und öffentlichkeitswirksam hingerichtet werden. Üblich war auch, dass Männer über Frauen und Kinder herrschten. Väter hatten beispielsweise das Recht, die Kinder, die ihnen nicht gefielen, in Weidenkörbchen auszusetzen. Sie taten dies häufig, wenn der Körper des Kindes etwas anders aussah als der anderer Kinder, wenn ihr Kind schwach wirkte, unehelich geboren oder ein Mädchen war. Geregelt war auch, dass Menschen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung keiner Arbeit nachgehen konnten, betteln durften. Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen hatten das Recht, mit einer Trage oder von einem Lasttier zum Gericht getragen zu werden, wenn sie dort einen Termin hatten.
Unterschiedliche Lebensperspektiven
Unterstützung durch Arbeitsämter oder Krankenkassen, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Hilfe und Unterstützung konnten die Menschen am ehesten von ihren Familien erwarten. Wenn der gerade herrschende römische Kaiser Lust dazu hatte, verteilte er kleine Geldgeschenke, um sein Ansehen zu erhöhen.
Wie es einem Menschen mit Behinderungen in dieser Zeit erging, hing vor allem davon ab, ob er oder sie in eine einflussreiche, wohlhabende oder in eine arme Familie geboren worden war. Ob man ein Mann oder eine Frau war, spielte ebenfalls eine wichtige Rolle. Kinder mit Behinderungen oder Krankheiten wurden oft getötet oder ausgesetzt, kranke Frauen wurden verstoßen. Kaiser Claudius hingegen konnte trotz seiner körperlichen Einschränkungen von 41 bis 54 nach Beginn unserer Zeitrechnung herrschen. Allerdings war auch er Spott und Missgunst ausgesetzt.
Religionen verändern die Einstellung und das Leben vieler Menschen
In der Antike begannen sich die monotheistischen Religionen im römischen Einzugsgebiet zu etablieren. Monotheismus bedeutet Glaube an einen einzigen Gott. Im Gegensatz dazu bezeichnet Polytheismus die Verehrung vieler Götter. Monotheistische Religionen sind zum Beispiel das Christentum, das Judentum und der Islam. Mit den monotheistischen Religionen entstand nach Beginn unserer Zeitrechnung das Gebot der Nächstenliebe. Die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen veränderte sich. Krankheit und Behinderung wurden jetzt häufig als gottgegebenes Schicksal und Prüfung der oder des Einzelnen und ihrer oder seiner Familie betrachtet. Die Fürsorge und das Abgeben aus Mitleid wurden Bestandteil der Religionsausübung.
Materialien
Zur Weiterarbeit: "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius"
Zur Weiterarbeit: "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius"
Die Satire "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius" wurde von Seneca verfasst, der zu Zeiten Claudius’ acht Jahre in der Verbannung auf der Insel Korsika lebte. Lucius Annaeus Seneca war ein römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher, Staatsmann und einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Die Satire wurde anonym als Schmähschrift veröffentlicht.
Diese Übung kann unter anderem im Latein-Unterricht verwendet werden, beispielsweise als Übersetzungsübung und zur Auseinandersetzung mit Sprache. Hierfür dient das Reclam-Heft "Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius" von Seneca.
In der Schmähschrift wird Kaiser Claudius mit folgenden Worten beschrieben (S. 86):
Claudius
- hätte eine unklare Aussprache,
- würde gelegentlich Stottern,
- würde den rechten Fuß nachschleifen,
- würde in einer Hand zittern,
- würde mit dem Kopf wackeln,
- hätte ein nervöses Reißen,
- wäre gelegentlich geistesabwesend,
- wäre zerstreut,
- wäre stupide und vergesslich,
- hätte Abhängigkeiten von den Frauen und Freigelassenen,
- wäre naiv und ungeniert,
- wäre schrullenhaft,
- wäre grausam,
- wäre gallischer Abstammung,
- hätte einen guten Appetit,
- hätte viele Eigenheiten und Liebhabereien,
- hätte eine Neigung für die Philologie, für die Rechtsprechung, für die gelehrte Verwendung von Dichtersprüchen, für das Würfelspiel.
Übung:
Ordnet in Zweiergruppen diese Beschreibungen den Kategorien "Körper", "Verhalten", "Persönliche Eigenheiten und Vorlieben" zu.
Gruppendiskussion:
Welche dieser Merkmale machten Claudius zu seiner Zeit wohl besonders lächerlich und waren besonders verletzend? Hierfür kann es sinnvoll sein, mehr über die damalige Zeit und ihre Kulturen zu recherchieren.
Text: Seneca: Apocolocyntosis. Die Verkürbissung des Kaisers Claudius
S. 12 (3)
Ultima vox eius haec inter
homines audita est, cum
maiorem sonitum emisisset
illa parte, qua facilius loquebatur:
>va me, puto, concacavi me<.
Quod an fecerit, nescio: omnia
certe concacavit.
S. 13 (3)
Die letzten Laute übrigens, die man
unter Menschen von ihm vernommen
hatte – nachdem er gerade aus jenem
Körperteil, mit dem er sich stets leichter
zu äußern verstand, einen stärkeren Ton
hatte entfahren lassen – waren folgende:
"O je, ich glaube, ich habe mich beschissen."
Ob er es wirklich getan hat, weiß ich nicht;
sicher ist nur, dass
er alle Welt beschissen hat.
Tipp:
Als Ergänzung könnt ihr die Übung "Verletzende Worte" aus "Compasito - Handbuch zur Menschenrechtsbildung mit Kindern" (Seite 164) nutzen.
Quellen:
Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. 25 Portraits bekannter Persönlichkeiten. Luchterhand. Neuwied. S. 18 f
Ivan Lesný (1991): Die Krankheiten der Mächtigen. Historische Persönlichkeiten mit den Augen eines Neurologen gesehen. Aufbau-Verlag: Berlin/Weimar.
3: Seneca (1981): Apocolocyntosis. Die Verkürbissung des Kaisers Claudius. Reclam: Stuttgart.
Biografien
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Kaiser Claudius)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Kaiser Claudius, 10 v. - 54 n. unserer Zeitrechnung)
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus war der vierte römische Kaiser. Sein größter kriegerischer Erfolg war die Eroberung Britanniens. Während seiner Regierungszeit entstanden Ansätze sozialer Fürsorge sowie viele neue Gebäude und öffentliche Straßen. Den Verkehrswegen widmete er sich besonders - er ließ neben neuen Straßen auch Kanäle bauen. Dies trug bedeutend zur Verbreitung der lateinischen Sprache im Mittelmeerraum bei, was sich bis in die heutige Zeit auswirkt. Kaiser Claudius setzte sich auch für die Versorgung der Bevölkerung mit Getreide und für eine bessere Landwirtschaft ein. Er widmete sich lange Zeit historischen Studien und war als Wissenschaftler sehr angesehen.
Laut Geschichtsaufzeichnungen hatte Kaiser Claudius seit seiner Geburt spastische Lähmungen und die Krankheit Epilepsie. Aufgrund seiner Behinderungen wurde er von seiner Familie nicht als späterer Kaiser vorgesehen. Seine Mutter betrachtete seine Behinderungen als Strafe der Götter. Sie versteckte Claudius vor der Öffentlichkeit. Sie soll gesagt haben, dass er ein "Missgebilde" sei, das von der Natur nur angefangen und nicht vollendet wurde. Seine Behinderungen zeigten sich unter anderem durch Stottern, Speichelfluss und eingeschränkte Beweglichkeit der Gliedmaßen. Er stand unter der Obhut eines ehemaligen Stallaufsehers, der ihn disziplinierte. Er wurde oft verunglimpft: So wurde über ihn als "Claudius der Stotterer", "Clau-Clau-Claudius" oder als "der gute Onkel Claudius" (1) gesprochen. Trotz solcher Diffamierungen und der Ausgrenzung durch seine Familie erlangte Claudius durch seine Studien und seinen Einsatz für die Bevölkerung auch Respekt in der Öffentlichkeit.
Zur Weiterarbeit:
"Apocolocyntosis – Die Verkürbissung des Kaisers Claudius"
Quellen
1: Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. 25 Portraits bekannter Persönlichkeiten. Luchterhand. Neuwied. S. 18 f.
Ivan Lesný (1991): Die Krankheiten der Mächtigen. Historische Persönlichkeiten mit den Augen eines Neurologen gesehen. Aufbau-Verlag: Berlin/Weimar.
Seneca (1981): Apocolocyntosis. Die Verkürbissung des Kaisers Claudius. Reclam: Stuttgart.
Gesetze
12-Tafel-Gesetz
12-Tafel-Gesetz
Mittelalter

Mittelalter
(500 bis 1500 nach Beginn der Zeitrechnung)
Der Sachsenspiegel
Der Begriff Mittelalter bezeichnet in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen Antike und Neuzeit. Im Laufe der rund zehn Jahrhunderte veränderten sich sowohl die Gesetze als auch die Haltungen der Menschen gegenüber Krankheit und Behinderungen sehr. Ganz unterschiedliche Gesetze und Haltungen zu verschiedenen Themen und Rechtsbereichen existierten nebeneinander. Der wichtigste überlieferte Rechtstext des Mittelalters im mitteleuropäischen Gebiet war der Sachsenspiegel. Das illustrierte Rechtsbuch basierte auf einer Mischung aus mythischen und religiösen Vorstellungen, enthielt aber auch praktische Alltagsregelungen. Der Sachsenspiegel erläuterte unter anderem, wer als handlungs-, rechts-, lebens- und erbfähig galt und wie dies zu beweisen war.
Gesundheit musste bewiesen werden
Am Anfang des Mittelalters mussten die Menschen ihre körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit häufig unter Beweis stellen. Behinderungen und Krankheiten galten als Strafe Gottes. Die Lebenssituation einiger Menschen verschlechterte sich dadurch verglichen mit früher, die Situation anderer verbesserte sich. So konnten Frauen mit Behinderungen den Vorwurf, vom Teufel besessen zu sein, manchmal schon dadurch entkräften, dass sie zur Kirche gingen. Männer, denen eine Krankheit nachgesagt wurde, konnten versuchen ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen, indem sie ohne Hilfe auf ein Pferd stiegen. Dramatisch war hingegen die Lage von Kindern, die eine Körperbehinderung hatten: Sie durften misshandelt oder auch getötet werden, da ihnen eine Nähe zum Teufel unterstellt wurde. Diese Vorstellung vertrat zum Beispiel der christliche Reformator Martin Luther, sogar noch zu Beginn der Neuzeit.
Fürsorge und Armenpflege
Die christlichen Kirchen gewannen im heutigen deutschsprachigen Gebiet immer mehr Einfluss. Dadurch änderte sich die Einstellung vieler Menschen zu Krankheiten und Behinderungen. Dies veränderte auch die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen und die Rechtsprechung: Die Idee der sozialen Fürsorge und die gesetzlich geregelte sogenannte "Armenpflege" setzten sich im Laufe des Mittelalters zunehmend durch. Die ersten speziellen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen entstanden. Für bestimmte Personengruppen war es dennoch schwierig, aufgrund einer Behinderung ein gutes Leben zu führen: für arme Menschen, für Frauen und Kinder, für Menschen jüdischen Glaubens und andere. Ganz anders war die Situation für christliche Männer, die in Kriegen verwundet wurden, wie zum Beispiel Götz von Berlichingen, und für reiche, angesehene Männer wie Karl VI. Sie hatten größere Handlungsspielräume und mehr Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten.
Menschen mit Behinderungen als Jahrmarktsattraktion
In dieser Zeit entstand auch das Handwerk der Gaukler und Hofnarren. Menschen, die keiner anderen Arbeit nachgehen konnten, arbeiteten häufig in diesen Berufen. Menschen mit besonderen Körpern hatten häufig keine andere Möglichkeit Geld zu verdienen, als sich auf Jahrmärkten als sogenannte "Missgeburten" oder "Krüppel" zur Schau stellen zu lassen.
Biografien
Gottfried "Götz" von Berlichingen
Gottfried "Götz" von Berlichingen mit der eisernen Hand (um 1480 - 1562)
Der fränkische Reichsritter Götz von Berlichingen ist bekannt durch seine Rolle im schwäbischen Bauernkrieg. Außerdem ist er Vorbild der Hauptfigur in Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel "Götz von Berlichingen".
Götz von Berlichingen wurde in Jagsthausen in Süddeutschland geboren. Er war das jüngste von zehn Kindern aus dem sogenannten Geschlecht der Herren von Berlichingen. Die Schulbildung und die Wissenschaft mochte er nicht besonders. Deswegen arbeitete er als Bube und später als Knappe. Seine Lehrjahre trat er bei seinem Vetter Conrad von Berlichingen an. Götz bat um eine ritterliche Ausbildung und das Erlernen des Waffenhandwerks. Nachdem er seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatte, arbeitete er sein ganzes Leben als Ritter und wurde berühmt.
Mit 16 Jahren begann für ihn die Zeit der Kriege und Gefechte. Mit 24 Jahren zog Götz von Berlichingen auf bayerischer Seite in den Landshuter Erbfolgekrieg. In diesem Krieg verlor er seine rechte Hand. Dies geschah während einer Belagerung vor Landshut. Ein Schuss aus den eigenen Reihen traf sein Schwert, das Schwert wurde zertrümmert und die Trümmer traten in die Armschiene der Rüstung ein. Seine rechte Hand wurde dabei zerfetzt. Wegen seiner Verletzung lag er monatelang im Krankenbett.
Götz war verzweifelt über den Verlust seiner Hand. Doch dann erinnerte er sich an einen Knecht, der mit nur einer Hand gekämpft hatte. Der Knecht hatte "so gute Dinge gegen den Feind im Felde ausrichten können, als ein anderer". (1) Dieser Bericht ließ Götz neuen Mut fassen. Er schrieb: "… dershalben ich auch vermeinte, auch wenn es mir nur einen Behelf hätte, und wenn es gleich einer eisernen Hand wäre, so wollt ich doch mit Gottes Gnad und Hülf im Feld so gut sein, als irgend ein unverstümmelter Mensch… ." (2) Götz soll zunächst eine Art "Hakenklaue" als Ersatzhand getragen haben. Das Innenfutter soll aus Hirsch-, Reh- oder Schafsleder bestanden haben. Die Verwendung eines weichen Leders war sehr wichtig, es durfte auch nicht zu stark gegerbt sein. Durch hartes oder stark gegerbtes Leder hätte sich der Stumpf entzünden können.
Nach der Abheilung des Stumpfes bekam der Ritter eine raffiniert entwickelte Eisenhand. Dieser eiserne Handschuh funktionierte durch Federn und Einrastmechanismen (siehe Abbildung). Die eiserne Hand war beweglich, ähnlich wie eine echte. Er konnte damit beispielsweise Zügel halten, jedoch kein Schwert benutzen. Götz von Berlichingen erhielt den Beinamen "mit der eisernen Hand". Wo diese hoch entwickelte Hand hergestellt wurde, ist unbekannt. Bekannt ist, dass sie entsprechend den Wünschen von Götz angefertigt, aber nicht von ihm selbst erfunden worden war. Viele der in der eisernen Hand verwendeten Konstruktionen werden heute noch bei der Anfertigung von Hand-Prothesen genutzt. Die Konstruktionen wurden dazu allerdings abgewandelt und modernisiert.
Quellen:
1, 2: G. H. Bidermann (1980): Burg Hornberg. Wohnsitz des Ritters Götz von Berlichingen. Rüstzeugschau 1980. Journal-Verlag Schwend: Schwäbisch Hall. S. 80
Website Rotes Schloss Jagsthausen: Götz von Berlichingen (abgerufen am 24.09.2010)
Karl VI.
Karl VI. (1368 - 1422)
Karl VI. war von 1380 bis 1422 König von Frankreich. Er war der Sohn von König Karl V. und seiner Frau Johanna von Bourbon. Er war ihr ältestes Kind. Als Karl VI. auf den Thron gerufen wurde, war er erst 12 Jahre alt. Er stand unter Vormundschaft der Brüder seines Vaters. 1388 wurde Karl VI. zum König ausgerufen und regierte nun offiziell. Er regierte in der Zeit des Hundertjährigen Krieges und zahlreicher Aufstände. Diese Aufstände hatten ihren Ursprung unter anderem in den sehr schlechten sozialen Lebensbedingungen für sehr viele Menschen. Die schlechten Lebensbedingungen resultierten aus schlechter Regierungsführung früherer Könige. In dieser schwierigen Zeit erwies sich Karl VI. als fleißiger und geschickter König. Er holte unter anderem den Rat von Lehrenden der Pariser Universität ein. Ab 1392 jedoch war Karl VI. zeitweise handlungsunfähig, er wurde als wahnsinnig beschrieben. Die folgende Szene illustriert sein Verhalten:
"Im Jahr 1392 beschloß Karl VI., einen Feldzug in die Bretagne zu unternehmen, weil beim bretonischen Herzog der Mörder seines geliebten Heerführers Connetable de Clisson Zuflucht gefunden hatte. In der Stadt Mans sammelte sich das Heer. Als er Mans verlassen hatte und durch einen Wald zog, stürzte aus dem Gebüsch ein Vagabund hervor, packte die Zügel des königlichen Pferds und rief: 'Kehr um, erhabener Herr, du bist verraten!' (…) Eine Weile später stieß ein königlicher Knappe mit der Lanze an seinen Helm. Beim Klingen des Metalls schrie der König schrecklich auf, er ergriff sein Schwert und schlug um sich. (…)" (1)
Ab diesem Zeitpunkt wurde Karl VI. von vielen Menschen in seiner Umgebung als "geistesgestört" beschrieben. Direkt nach diesem Vorfall soll er sich zwar zunächst wieder scheinbar "normal" verhalten haben. In der darauf folgenden Zeit häuften sich jedoch Geschehnisse wie das im Wald. Die Regierungsgeschäfte wurden ihm aus der Hand genommen. Zunächst übernahm der Bruder seines Vaters Philipp der Kühne die Regierung. Das gefiel Karls Bruder, Herzog Ludwig von Orléans, jedoch gar nicht. Es entstand ein Streit darüber, wer regieren darf. Dieser Streit führte zu kämpferischen Auseinandersetzungen.
Anhand der historischen Aufzeichnungen wird heute vermutet, dass Karl VI. eine phasenweise auftretende Krankheit hatte. Die Symptome deuten auf eine Demenz hin. Die Krankheit Demenz wurde erst 400 Jahr später wissenschaftlich beschrieben. Der Begriff fasst verschiedene Erkrankungen zusammen, die alle mit einem Verfall der geistigen Leistungsfähigkeit und einer Persönlichkeitsveränderung einhergehen. Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit.
Karl VI. starb 1422 und ging als der "Wahnsinnige" und der "Vielgeliebte" in die Geschichte ein.
Quelle:
1: Ivan Lesný (1991): Die Krankheiten der Mächtigen. Historische Persönlichkeiten mit den Augen eines Neurologen gesehen. Aufbau-Verlag: Berlin/Weimar. S. 117
Gesetze
Sachsenspiegel 1220-1225
Sachsenspiegel 1220-1225
"Ein Geisteskranker kann sich nicht strafbar machen. Ein mit Schellen und Glocken herausgeputzter Geisteskranker verletzt mit einem hammerähnlichen Gegenstand einen anderen am Kopf. Für den angerichteten Schaden haftet der Vormund, hier zahlt er dem Ritter Schaden."
(Sachsenspiegel, Schild 1980 zit. nach Lieberwirth, Rolf: Eike von Repchow und sein Sachsenspiegel. Entstehung. Inhalt, Bedeutung. Köthen 1980)
Bremischen-Evangelischen Kirchenordnung von 1534
Bremischen-Evangelischen Kirchenordnung von 1534
"Und damit über diese Sache das Amt des Praedicanten nicht vom Dienste der Evangelie verücket werden möge, so ist es recht und gut, daß wir gethan haben, was einst die Apostel und rechten Christen zu thun pflegten; nämlich daß wir Diaconen das ist Diener der Armen erwählt haben, Männer, welche fromm, treu und unverdrossen sind, gleich wie sie gezeichnet werden (Apd. VI.1. Tim.III) welche zu dieser Nothdurft bestellt sind, daß sie in unserem Namen von der Gemeinde Almosen die anderen Nothdürftigen versorgen, die Armen, ein Jeglicher in seinem Kirchspiele kennen und oft besuchen."
(Bremischen-Evangelischen Kirchenordnung von 1534 zit. n. W.A. Walte, a.a.O., S. 9 in: Zur historischen Entwicklung der Diskriminierung Behinderter von Horst Frehe, Bremen , S.9)
Neuzeit

Neuzeit
(1500 nach Beginn der Zeitrechnung bis Anfang des 20. Jahrhunderts)
Erste staatliche Einrichtungen entstehen
In der Neuzeit setzte sich in Europa zunehmend ein weltliches gegen das christliche Weltbild durch. Krankheit wurde immer seltener als Strafe Gottes und immer öfter als medizinisches Problem betrachtet. In vielen Ländern fand ein solches Umdenken statt. In Europa wird dieses veränderte Denken, das sich in der Kunst, der Politik und vielen anderen Bereichen niederschlug, mit dem Begriff "Moderne" beschrieben. Zu den bestehenden kirchlichen Institutionen wie den Waisenhäusern für Kinder oder der sogenannten Armenpflege kamen nun staatliche Einrichtungen hinzu.
Die Arbeitskraft von Männern wiederherstellen
In der Neuzeit waren es infolge von Kriegen auch neue Personengruppen, die Krankheiten und körperliche Einschränkungen hatten: Beispielsweise verloren Soldaten bei Kriegseinsätzen häufig Gliedmaßen und konnten nicht mehr arbeiten. Für diese, häufig jungen, Männer wurden neue Einrichtungen aufgebaut, in denen sie Unterstützung erhielten. Ziel war es, ihre Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen. Heute nennen wir diese Form der Unterstützung "Rehabilitationsmaßnahme". Der Grund für diese Einrichtungen war nicht nur die Idee, dem einzelnen Menschen zu helfen. Vielmehr sollten durch diese staatlichen Unterstützungsleistungen möglichst viele Menschen wieder arbeitsfähig und soziale Unruhen in der Bevölkerung vermieden werden.
Die Folgen der Industrialisierung
Im Laufe der Zeit hatten sich auch die Arbeitsbedingungen verändert. Mehr Menschen als früher arbeiteten in Fabriken und weniger Menschen zusammen mit der eigenen Familie in Handwerksbetrieben oder der Landwirtschaft. Die Veränderungen des Wirtschaftssystems, die weitreichende Folgen für die Menschen hatten, werden unter dem Begriff "Industrialisierung" zusammengefasst. Viele Menschen zogen in die Nähe der Fabriken, um kurze Arbeitswege zu haben. Eine Folge dieser Entwicklung war, dass weniger Menschen als vorher von ihren Familien unterstützt werden konnten, wenn sie zum Beispiel krank waren. Gleichzeitig litten die in den industrienahen Wohngebieten lebenden Menschen unter neuen Krankheiten und Behinderungen, die durch die häufig schlechten hygienischen Bedingungen hervorgerufen wurden.
Menschen werden in Gruppen eingeteilt
Die Arbeitskraft jeder und jedes Einzelnen zu erhalten, war für den Staat wichtiger geworden. Entsprechend änderten sich auch die Politik und die Gesetze. Das soziale System wurde ausdifferenziert. Mediziner und Politiker begannen, zwischen unterschiedlichen Zielgruppen für und Zielen von Unterstützungsleistungen zu unterscheiden: Männer, Frauen, Kinder, arme und reiche, arbeitende und arbeitslose Menschen hatten unterschiedliche Möglichkeiten, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Der Anspruch auf staatliche Leistungen war zudem häufig daran gekoppelt, ob jemand als in Zukunft wahrscheinlich wieder arbeitsfähig galt. So waren in der Armengesetzgebung in Preußen von 1891 körperbehinderte Frauen, Kinder und Männer ausgenommen von medizinischer Versorgung, von Ausbildung und beruflicher Rehabilitation. In Zusammenhang mit diesen Unterscheidungen und Spezialisierungen wurden am Ende der Neuzeit große Vereine und Anstalten der sogenannten Irren-, Krüppel- und Gebrechensfürsorge gegründet. Die Sozialgesetze entstanden (Krankenversicherungsgesetz (1883), Unfallversicherungsgesetz (1884), Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz (1889)).
Gesundheit und Krankheit lagen zu dieser Zeit vor allem in den Händen der Ärzte und Ärztinnen.
Materialien
Zur Weiterarbeit: Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven
Zur Weiterarbeit: Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven
Ziel
Jede Biografie ist geprägt durch die Bedingungen, die Menschen vorfinden und den Umgang, den sie selbst damit entwickeln können. In dieser Wechselwirkung entsteht eine Biografie. So lässt sich auch das Leben des Komponisten Beethoven nicht allein durch die äußeren Umstände oder seine Behinderung oder seine Person erklären, da all diese Faktoren sich wechselseitig bedingen. Beispielhaft für die sehr unterschiedlichen Faktoren, die eine Rolle spielen, greifen wir drei Dinge heraus: einen Brief von ihm, in dem er seine Situation beschreibt, den Hintergrundtext zur rechtlichen Situation von Menschen mit Behinderungen zu Beethovens Zeit und die Biografie über Beethoven. In diesen drei Texten könnt ihr einige Faktoren finden, die für Beethovens Leben und seine Lebensgestaltung, seinen Umgang mit seiner Behinderung, mit seinen Mitmenschen und seiner Arbeit wichtig waren.
Durchführung
Teilt euch in drei gleichgroße Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt einen der drei genannten Texte. Lest den Text aufmerksam durch. Versucht dann in eurer Gruppe herauszuarbeiten, welche Faktoren für Beethovens Leben wichtig waren. Diskutiert dies in eurer Gruppe und notiert die Ergebnisse.
Anschließend könnt ihr den anderen Gruppen die Ergebnisse vorstellen und die Eindrücke, die ihr von Beethovens Leben und der Epoche erhalten habt, miteinander vergleichen. Ihr könnt die Ergebnisse anhand der Frage ordnen, ob Beethovens Umgang zum Beispiel mit der Arbeit oder mit seinem Umfeld durch seine Behinderung bestimmt war oder eher nicht. Häufig kommen dabei interessante Diskussionen auf. Fasst zum Schluss eurer Diskussion noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Tipp zur Weiterarbeit
Beethoven hatte aufgrund seiner Hörbehinderung ein Konversationsheft: Ihr könnt in Bibliotheken oder im Internet recherchieren, wie ein Konversationsheft aussah und versuchen, ein Gespräch mit einer Person so zu führen, wie es Beethoven tat, als er nicht mehr hören, aber sprechen konnte. Einfacher ist dies, wenn euer Hörvermögen durch Kopfhörer oder Ohrstöpsel tatsächlich beeinträchtigt wird. Im Musikunterricht lässt sich dies erweitern durch den Versuch, sich Musik vorzustellen statt sie zu hören, wie es Beethoven konnte.
Brief Beethoven
Brief
Ludwig van Beethoven konnte immer weniger hören. Er vermied es, darüber zu sprechen und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Am 29. Juni 1801 schrieb Beethoven an seinen Freund Franz Gerhard Wegeler über den Verlust seines Hörvermögens:
"nur hat der neidische Dämon, meine schlimme Gesundheit, mir einen schlechten Stein ins Brett geworfen nemlich: mein Gehör ist seit 3 Jahren immer schwächer geworden (…) mein gehör ward immer schlechter (…) mein Gehör blieb oder ward noch schlechter (…) nur meine ohren, die sausen und Brausen tag und Nacht fort; ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu, seit 2 Jahren fast meide ich alle gesellschaften, weils mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin Taub, hätte ich irgend ein anderes Fach, so giengs noch eher, aber in meinem Fach ist das ein schrecklicher Zustand, dabey meine Feinde, deren Anzahl nicht geringe ist, was würden diese hiezu sagen – um dir einen Begriff von dieser wunderbaren Taubheit zu geben, so sage ich dir, daß ich mich im Theater ganz dicht am Orchester <oder>gar anlehnen muß, um den schauspieler zu verstehen, die hohen Töne von Instrumenten singstimmen, wenn ich etwas weit weg bin höre ich nicht, im sprechen ist es zu Verwundern daß es Leute giebt die es niemals merkten, da ich meistens Zerstreuungen hatte, so hält man es dafür, manchmal auch hör ich den Redenden der leise spricht kaum, ja die Töne wohl, aber die worte nicht, und doch sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich, was es nun werden wird, das weiß der liebe Himmel, weringsagt, daß es gewiß besser werden wird, <obwohl ich es> wenn auch nicht ganz – ich habe schon oft den schöpfer und mein daseyn verflucht, Plutarch hat mich zu der Resignation geführt, ich will wenn's anders möglich ist, meinem schicksaal trozen, obschon es Augenblicke meines Lebens geben wird, wo ich das unglücklichste Geschöpf gottes seyn werde. Ich bitte dich von diesem meinen Zustand niemanden auch nicht einmal der Lorchen etwas zu sagen, nur als geheymniß vertraue ich dir's an, lieb wäre mirs, wenn du einmal mit Wering darüber Brief wechseltest, sollte mein Zustand fortdauren, so komme ich künftiges frühjahr zu dir, du miethe[s]t mir irgendwo in einer schönen Gegend ein Hauß auf dem Lande, und dann will ich ein halbes Jahr ein Bauer werden, vieleicht wird's dadurch geändert, resignation : welches elende." (1)
Quellen:
1: Ludwig van Beethoven: Briefwechsel. Gesamtausgabe, Bd. 1-7 (Hg.) Sieghard Brandenburg, Bd. 1-6: München 1996, Bd. 7 (Register): München 1998). Website des Beethovenhauses Bonn, Digitales Archiv, abgerufen am 21.09.2010
Website Klassika - Die deutschsprachigen Klassikseiten: Ludwig van Beethoven 1770-1827, abgerufen am 20.09.2010
Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. Der Komponist mit fortschreitender Schwerhörigkeit. Luchterhand: Neuwied; Berlin, S. 53-57
Lewis Lockwood (2009): Beethoven. Seine Musik, Sein Leben. Bärenreiter; Kassel
Zur Weiterarbeit: Ballade von Hester Jonas
Zur Weiterarbeit: Ballade von Hester Jonas
Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass auch Frauen mit Behinderungen oder Erkrankungen als Hexen verfolgt wurden. Häufig waren bzw. sind es mehrere verschiedene Faktoren und nicht nur ein Vorwurf allein, die dazu führten bzw. führen, dass Menschen diskriminiert, ausgegrenzt oder verfolgt werden. Anhand des Lebens und der Ballade über Hester Jonas lässt sich dies für ihre Zeit nachvollziehen.
Hester Jonas
Bildet Gruppen von zwei bis drei Personen. Hört euch alle gemeinsam das Lied über Hester Jonas an und verteilt die Biografie und den Text der Ballade an alle. Lest in den Gruppen aufmerksam die Texte und diskutiert sie dann. Beantwortet folgende Fragen:
- Was hat euch überrascht?
- An welchen Stellen der Ballade finden sich Hinweise auf die Vorwürfe gegen Hester Jonas?
- Welche Hinweise lassen sich in der Ballade finden, wie sie mit ihrer Behinderung umging, wie sie arbeitete oder dachte?
- Diskutiert gemeinsam, welche Rolle die Tatsache gespielt haben mag, dass Hester Jonas eine Frau war und andere Frauen unterstützte. Diskutiert, welche Rolle es gespielt haben mag, dass sie etwas von Heilkunde verstand. Welche anderen Faktoren spielten möglicherweise eine Rolle bei ihrer Verurteilung und Ermordung?
- Welche Situationen kennt ihr, in denen Menschen heutzutage gegen mehrere Vorurteile gleichzeitig ankämpfen müssen?
- Schaut in der UN-Behindertenrechtskonvention nach, was dort zu Frauen und Kindern steht. Recherchiert, welche Gründe es heute gibt, Kinder und Frauen mit Behinderungen besonders zu berücksichtigen. Lest dazu den Artikel von Dr. Sigrid Arnade und den Artikel 6 der Konvention (siehe unten).
Ballade Hester Jonas
Ballade von der Hester Jonas
Text: Peter Maiwald
Musik: Pit Budde
Unten im Gnadental geschah eine Geschicht,
Die hat schön angefangen und endete so nicht.
Die Hester Jonas war des Peter Meurer Weib:
Sie hatte grobe Hände und einen jungen Leib.
Die Tage waren Arbeit. Die Nächte waren leer.
Und Hester hatte Träume und träumte immer mehr.
Und morgens an der Erft, wenn sie die Wäsche rieb,
Erzählte sie den Frauen, was vom Träumen blieb.
Da war aus Wein der Fluss. Die Bäume trugen Brot.
Im Hammfeld blühten Kirschen, die warn im Winter rot.
Kein Krämer fuhr den Karrn. Kein Geld brauchte ein Kleid.
Kein Mensch brauchte zu darben. Kein Weg war mehr zu weit.
Die Frauen hörten sie mit lachendem Gesicht.
Schön waren Hesters Träume und schadeten doch nicht.
Und mittags auf dem Markt, wo mancher Hester rief,
Geschah, dass um die Jonas mehr Volk zusammenlief.
Die Städte werden falln, wo reich nur wenig sind.
Die armen Leute steigen zum Reichtum ohne Sünd.
Und gibt nicht mehr den Fürst, nicht Bischof und nicht Zar,
Und wird nichts sein am Morgen wie es am Abend war.
Die Männer zeigen ihr oft einen schiefen Mund.
Die bessern sagten: "Hester, du richtest dich zugrund."
Des Nachts im kühlen Gras kamen sie hungrig doch
Und wollten Hesters Träume und baten: heute noch.
Da kamen in der Früh zwei Männer aus der Stadt
Und schleppten Hester Jonas vor einen Magistrat.
Da war die Red von Gott, da war die Red von ihr.
Da war die Red von Träumen, die kränken Mensch und Tier.
Und quetschten ihr den Hals. Und brachen ihr Gebein.
Die ganze Stadt hat Tage voll Hester Jonas’ Schrein.
Und unterschrieb die Schuld mit der verkrümmten Hand
Und schrie noch lange Träume, bis sie das Feuer fand.
© Heupferd Musik Verlag, Budde, Maiwald. Alle Rechte vorbehalten.
Pit Budde - Spiel der Zeit / Lieder von Cochise. Songbücherei. ISBN 3-923445-02-4
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Schattenübersetzung von NETZWERK ARTIKEL 3 e. V.; Korrigierte Fassung der
zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmten Übersetzung
Erklärung zum Text:
Der Text ist eine sogenannte "Schattenübersetzung" vom NETZWERK ARTIKEL 3. Die offizielle Übersetzung war abgestimmt worden, ohne behinderte Menschen zu beteiligen. Ihrer Ansicht nach sind viele wichtige Begriffe falsch übersetzt worden. Die Leute von NETZWERK ARTIKEL 3 korrigierten deshalb diese fehlerhafte Übersetzung. Die falsch übersetzten Begriffe haben sie in der Schattenübersetzung durchgestrichen und die korrekten Wörter hervorgehoben.
(…)
Artikel 6
Frauen mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt genießen können.
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen zur Sicherung der vollen Entfaltung, der Förderung und der Stärkung der Autonomie derdes Empowerments von Frauen, um zu garantieren, dass sie die in diesem Übereinkommen genannten Menschenrechte und Grundfreiheiten ausüben und genießen können.
Artikel 7
Kinder mit Behinderungen
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.
(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe Assistenz zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können.
(…)
Biografien
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
Ludwig van Beethoven war ein deutscher Komponist mit außergewöhnlichem Talent. Sein musikalisches Können wurde verstärkt durch seine hohe Konzentrationsfähigkeit, große Disziplin und seinen musikalischen Ideenreichtum. Zudem war er seit seiner frühen Kindheit mit Musik aufgewachsen. Sein Großvater war Kapellmeister und sein Vater Sänger in der Bonner Hofkapelle. Sein Vater war von Wolfgang Amadeus Mozart beeindruckt. Mozart galt zu seiner Zeit als Wunderkind und veröffentlichte bereits mit sechs Jahren erste Kompositionen. Beethovens Vater war so von Mozart fasziniert, dass er seinen Sohn Ludwig in ehrgeiziger Weise förderte. Der Vater entwickelte nach und nach eine Alkoholkrankheit. Ludwig van Beethoven musste aus diesem Grund bereits ab seinem zwölften Lebensjahr mit für den Familienunterhalt sorgen.
Als Beethoven etwa 20 Jahre alt war, wurde der österreichische Komponist Joseph Haydn auf ihn aufmerksam. Beethoven sollte sein Schüler in Wien werden. Mit 24 Jahren brach er zum zweiten Mal nach Wien auf. Ludwig van Beethoven gefiel es in Wien und er beschäftigte sich dort mit unterschiedlichen Musikstilen – von der so genannten Wiener Klassik bis hin zur Romantik. In Wien wurde der junge Musiker schnell bekannt, er wurde gefeiert und erlangte große Berühmtheit.
Was jedoch nur wenige Menschen in Beethovens Umfeld wussten: Er kämpfte, seit er etwa 28 oder 30 Jahre alt war, mit seiner Hörfähigkeit. Die ersten Symptome der Schwerhörigkeit zeigten sich wohl mit 28 Jahren. Im Laufe der Zeit wurde sein Gehör immer schlechter. Er suchte zahlreiche Ärzte auf, diese konnten ihm jedoch nicht helfen. Der Kampf gegen den Verlust seines Hörvermögens prägte Beethoven sehr. Er arbeitete noch konzentrierter als früher und stellte an sich extreme Anforderungen. Da Beethoven ein sehr angesehener Musiker war, sprach er nicht offen über das Voranschreiten seiner Gehörlosigkeit. Er hatte Angst, bei Bekanntwerden dieser Tatsache als Künstler nicht mehr ernst genommen zu werden. Er isolierte sich immer mehr. Um zu kommunizieren benutze er ein Hörrohr. Als auch dieses Hilfsmittel immer weniger half, führte Beethoven ab 1818 ein Konversationsheft. Dieses hielt er bereit, damit seine Mitmenschen ihre Stellungnahmen, Nachrichten und Fragen notieren konnten. Er las diese, gab aber meistens eine mündliche Antwort. Nach heutigem Erkenntnisstand war Beethoven nicht absolut gehörlos, seine Fähigkeit zu Hören schwankte jedoch enorm.
Er komponierte und dirigierte auch mit schlechtem Gehör weiter. Er brauchte dazu keine Instrumente. Beethoven konnte sich die Töne vorstellen. Am Tag seiner Beerdigung gaben ihm 20.000 Menschen das letzte Geleit.
Zur Weiterarbeit:
Biografiepuzzle Ludwig van Beethoven
Quellen:
Ludwig van Beethoven: Briefwechsel. Gesamtausgabe, Bd. 1-7 (Hg.) Sieghard Brandenburg, Bd. 1-6: München 1996, Bd. 7 (Register): München 1998). Website des Beethovenhauses Bonn, Digitales Archiv (abgerufen am 21.09.2010)
Website Klassika. Die deutschsprachigen Klassikseiten: Ludwig van Beethoven 1770-1827 (abgerufen am 20.09.2010)
Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. Der Komponist mit fortschreitender Schwerhörigkeit. Luchterhand: Neuwied; Berlin, S. 53-57
Lewis Lockwood (2009): Beethoven. Seine Musik, Sein Leben. Bärenreiter; Kassel.
Hester Jonas
Hester Jonas (um 1570 - 1635)
Hester Jonas (um 1570 - 1635) war Hebamme und beschäftigte sich mit Kräuterheilkunde. Sie war mit dem Müller Peter Meurer verheiratet, der eine Windmühle in Neuss am Rhein betrieb. Hester wurde mit 64 Jahren der Hexerei beschuldigt und angeklagt. Ihr wurde vorgeworfen mit einem bösen Mann Kontakt zu haben. Angeblich schade sie Menschen und Tieren. Sie sei vom Teufel besessen. Als die Gerüchte um Hester Jonas immer größer wurden, sah sich die Obrigkeit zum Handeln gezwungen. Hester Jonas wurde verhaftet, angeklagt und verhört. Sie wurde auf einem Folterstuhl mit Eisennägeln zu den Anschuldigungen verhört. Diese Befragung dauerte Stunden. Unter der Folter legte Hester Jonas ein Geständnis ab und wurde vom Gericht in Neuss zum Tod durch Enthauptung verurteilt. Ihre Leiche wurde verbrannt und die Asche in alle Winde verteilt.
Heute wissen wir, dass Hester Jonas eine Frau war, die sich mit Heilkunde auskannte. Sie setzte sich sehr für die Menschen ein, denen sie half. Zudem hatte sie eine Krankheit, die heute als Epilepsie bekannt ist. Dadurch kam es vor, dass sich ihre Gesichtszüge veränderten oder ihr Körper zuckte. Die Krankheit und ihre Symptome waren ein Grund für die Anschuldigungen gegen sie. Außerdem nutzte sie zum Heilen oft die Alraunwurzel. Die Alraunwurzel war eine Heil- und Ritualpflanze und galt damals als Zaubermittel.
Viele Menschen glaubten im 17. Jahrhundert, dass bestimmte Krankheiten, Verhaltensweisen oder Behinderungen ein Zeichen dafür seien, dass die betreffende Person vom Teufel besessen ist. Wer zum Beispiel eine körperliche Behinderung hatte, entsprach der damaligen Denkweise zufolge nicht dem Ebenbild Gottes, sondern war für viele Menschen mit dem lahmen und hinkenden Teufel verwandt. Auch in den so genannten Hexenprozessen wurden solche Verbindungen zwischen dem Teufel und chronischen Krankheiten oder Behinderungen hergestellt. Besonders oft wurden unabhängig lebende Frauen oder Frauen, die nicht dem Schönheitsideal der Zeit entsprachen, Opfer dieser grausamen Prozesse.
Der in Neuss lebende zeitgenössische Dichter Peter Maiwald schrieb im Jahr 1635, angelehnt an eine Gerichtsnotiz zu einem solchen Prozess, eine Ballade über Hester Jonas.
Zur Weiterarbeit:
Quellen:
Stiftung Deutsches Hygiene-Museum und Deutsche Behindertenhilfe - Aktion Mensch e. V. (Hrsg.) (2001): Der (im-)perfekte Mensch : vom Recht auf Unvollkommenheit. Hatje Cantz Verlag: Ostfildern-Ruit.
Helmut Wessels (2004): Neuss und St. Quirin zu Fuß. J.P. Bachem Verlag: Köln.
Hetty Kemmerich (2003): Sagt, was ich gestehen soll! Hexenprozesse. Entstehung-Schicksale-Chronik. 2. Auflg., Lessing-Verlag: Dortmund.
Eugenie Marlitt
Eugenie Marlitt (1825-1887)
Friederike Henriette Christiane Eugenie John war eine Erfolgsautorin, die unter dem Pseudonym Eugenie Marlitt bekannt wurde. Sie genoss zu ihren Lebzeiten große Anerkennung, geriet aber nach ihrem Tod in Vergessenheit. Sie gilt als wichtige Vertreterin des Frauenromans im 19. Jahrhundert. Sie trug wesentlich dazu bei, Frauen, die sonst nicht lasen, als Lesepublikum zu gewinnen.
Eugenie wurde als zweites von fünf Kindern in Arnstadt geboren. Ihr Vater war Leihbibliothekar, ihre Mutter bildende Künstlerin. Die Familie hatte immer wenig Geld. Eine Schulbildung für alle Kinder war nicht zu finanzieren. Da Eugenie schon als Kind gerne und gut Musik machte, begann sie nach einigen Schuljahren eine Musik-Ausbildung bei der Fürstin Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen. Später, etwa 1844, begann sie eine Ausbildung zur Opernsängerin am Wiener Konservatorium. Eugenie litt unter großem Lampenfieber, was ihr sehr zu schaffen machte. "Wenn ich es auch für eine der herrlichsten Aufgaben halte, seinen Mitmenschen die Schöpfungen großer Meister vorführen zu dürfen, so fehlt mir doch dazu gänzlich der Mut." (1)
Eugenie gab ihre Musikkarriere mit etwa 28 Jahren auf. Nicht nur wegen ihres übergroßen Lampenfiebers - sie wurde auch zunehmend schwerhörig. Zahlreiche Kuren halfen nicht. Sie arbeitete von diesem Zeitpunkt an als Buchvorleserin und Reisebegleiterin für Fürstin Mathilde und begann, Romane zu schreiben. Mit 40 Jahren hatte sie ihren ersten Erfolg als Autorin. Ihre Romane haben einfache Handlungen und handeln von Liebe und Schmerz. In den Werken spiegeln sich die Haltungen und Sehnsüchte vieler Menschen dieser Zeit wider.
In ihrem Roman "Goldelse" von 1866 ist eine der Protagonistinnen eine Frau mit Behinderung. Helene vom Walde ist eine sensible, musisch begabte Frau mit einer Körperbehinderung. Sie wird als "kleines und verkrüppeltes Wesen" beschrieben. Helene hofft, von einem Feldherrn geliebt zu werden. Dieser soll es jedoch nur auf ihr Erbe abgesehen haben. Helene wird aufgrund ihrer Behinderung als "schwer Heimgesuchte" bezeichnet. Als schwer Heimgesuchte kann sie keine Liebesbeziehung haben, vermittelt die Autorin. Einem sogenannten "verkrüppelten Wesen" könne man keine Liebe einflößen. Den Gegenpart zu Helene stellt Elisabeth dar, eine "überirdische" Schönheit. Der Roman gibt sowohl die Meinung der Autorin, als auch die Haltung vieler Menschen des 19. Jahrhunderts gegenüber Menschen mit Behinderungen wieder.
Eugenie Marlitt erkrankte in späteren Jahren, zusätzlich zu ihrer Schwerhörigkeit, an den Gliedmaßen und Gelenken. Sie konnte die betroffenen Glieder nicht mehr frei bewegen. Auch das Stehen und Gehen wurde immer schwerer. "Mitten in dem an sich sonnigen Hofleben, von dem sie oft und gern erzählte bis zu ihren letzten Stunden, merkte sie an ihren kleinen weißen Händen mit den zierlichen Fingern eigentümliche, wenn auch völlig schmerzlose Verdickungen der Gelenke, die sich bald auch in den Knien und Knöcheln einstellten." (2)
Die Gelenke wurden immer unbeweglicher. Es wird vermutet, dass sie an Rheuma, Arthritis oder Gicht litt. Die Schriftstellerin war zunehmend auf einen Rollstuhl angewiesen, den sie "Fahrstuhl" nannte. 1863 gab sie ihre Stellung als Gesellschafterin und Reisebegleiterin auf und zog zunächst zu ihrem Bruder nach Arnstadt. Da sie mit ihren Romanen sehr gut verdiente, konnte sie mit 46 Jahren in die "Villa Marlitt" umziehen. Damit erfüllte sie sich einen Traum. Das Haus war für sie nach ihren eigenen Plänen so gebaut worden, dass sie sich dort gut allein bewegen konnte. Heute nennt man diese Bauweise "barrierefrei". (3)
Quellen:
1: Website Spiegel Online: Eugenie John-Marlitt. Ihr Leben und ihre Werke, (abgerufen am 24.09.2010)
Website Spiegel Online: Onlineversion des Romans "Goldelse" (abgerufen am 27.09.2010)
2: Kaster-Bieker, Hedwig, Mayer, Anneliese (2001): berühmt-beliebt-behindert. Außerordentliche Frauen im Porträt. (Hg.) Bundes Organisationsstelle behinderter Frauen, ein Projekt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Trägerschaft von bifos e. V.
Maria Theresia Paradis
Maria Theresia Paradis (1759 – 1824)
Maria Theresia Paradis war eine sehr bekannte österreichische Pianistin, Sängerin und Komponistin. Ihr Vater war ein Wiener Beamter, der 1785 niederösterreichischer Regierungsrat wurde. Maria Theresia hatte keine Geschwister. Mit etwa acht Jahren bekam sie ein Spinett, auf dem sie schon bald spielen konnte. Ein Spinett ist ein Tasteninstrument, ähnlich einem Cembalo. Anschließend erhielt sie Klavier- und Orgel-Unterricht. Um ihr Talent zu fördern, unterstützte Kaiserin Maria Theresia, ihre Namenspatronin, die Familie finanziell.
Als Erwachsene gab Maria Theresia zahlreiche Konzerte. Später ließ sich die Musikerin in Wien nieder. Mit 50 Jahren gründete sie dort das "Institut für musikalische Erziehung". Am Institut wurden Klavier, Gesang und Musiktheorie unterrichtet.
Maria Theresia Paradis war mit drei oder vier Jahren erblindet. Über die Ursache wurde damals heftig spekuliert. So meinten die einen, es handele sich um einen "gichtischen Schlafguß", andere meinten, der Grund sei ein "nächtlicher Schrecken" gewesen. Auch von einer "nervös-hysterischen Durchblutungsstörung" war die Rede. Damals dachten die Menschen häufig, dass eine Beeinträchtigung des Sehens mit dem Nachlassen der geistigen Fähigkeiten einhergehe. Die Eltern unternahmen viele Bemühungen und Reisen, um ihre kleine Tochter heilen zu lassen. Gleichzeitig förderten sie ihr musikalisches Talent. Maria Theresia sagte über ihr musikalisches Können:
"Ich habe zween vortreffliche Flügel. Man spielt mir die Stücke vor, und ich versuche es gleich nachzuspielen. Man verbessert etwas den Fingersatz, und ich lerne in einer Lection oft anderthalb Soli, ohne viele Mühe. (…) Mein Gehör ist ziemlich richtig. Ich kann mich auf selbiges mehr verlassen, als auf die Tactierung mit der Hand. Ich spiele Concerte von P. E. Bach, Reichardt, Wolf, Müthel, Richter, Benda, Schobert etc. Mein Gedächtnis ist dabei die einzige Hilfe, um die mancherlei Stücke nicht zu verwirren." (1)
Mit 18 Jahren war Maria Theresia Paradis bereits eine berühmte Musikerin. Trotzdem konnte sich ihre Familie noch immer nicht damit abfinden, dass sie blind war. Sie soll sogar einmal vorgetäuscht haben, geheilt zu sein, da ihre Umwelt dies so sehr erwartete. Dadurch konnte sie auch vermeiden, ständig zu Ärzten geschickt zu werden, was ihr äußerst unangenehm war.
Während ihrer Konzertreisen stand sie mit verschiedenen Menschen in Briefkontakt. Da die Blindenschrift, die sogenannte Brailleschrift, erst ein Jahr nach ihrem Tod entwickelt wurde, benutzte Maria Theresia eine Handsetzerei und –druckerei. Diese hatte Wolfgang von Kempelen 1778/'79 entwickelt. Auf den Konzertreisen wurde die Pianistin von ihrer Mutter und später auch von Johann Riedinger begleitet. Riedinger war ein Librettist und Violinist, das heißt, er schrieb Texte für Opern oder Operetten und spielte Geige. Er erfand eine fühlbare Musikschrift, durch die auch Maria Theresia Noten lesen und Noten schreiben konnte. Diese fühlbare Musikschrift hatte die Form eines Notensetzbrettes.
"Eine von Riedinger erfundene Notensetzmaschine mit einer Garnitur von Pflöckchen, die auf der Kopfseite Noten-, Pausen- und sonstige wichtige Musikzeichen trugen, enthob sie der Mühe, ihre Kompositionen Note für Note zu diktieren. Sie setzte ihre Kompositionen mit Hilfe dieses Notensetzbrettes und überließ gewandten Kopisten die Übertragung in gewöhnliche Notenschrift." (2)
Die Handsetzerei und die Musikschrift ermöglichten Maria Theresia Paradis ein unabhängiges Leben mit vielen Kontakten. Sie unterrichtete auch selbst Musik. Ihre Hilfsmittel kamen der Einrichtung von Instituten zugute, in denen sehbehinderte und blinde Menschen unterrichtet wurden. Die Konzertreisen und Auftritte Maria Theresias änderten die Haltung vieler Menschen gegenüber Menschen mit Sehbehinderungen.
Quellen:
1: Kaster-Bieker, Hedwig, Mayer, Anneliese (2001): berühmt-beliebt-behindert. Außerordentliche Frauen im Porträt. Hg. Bundes Organisationsstelle behinderter Frauen, ein Projekt des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Trägerschaft von bifos e. V., S. 33
2: Melanie Unseld (2007): Website FemBio: Maria Theresia Paradis österreichische Komponistin, Pianistin und Pädagogin (abgerufen am 24.09.2010)
Website Einhandwerker: Wolfgang von Kempelen (abgerufen am 24.09.2010)
Gesetze
Gesetz über die Freizügigkeit vom 1. November 1867
Gesetz über die Freizügigkeit
vom 1. November 1867
Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages was folgt:
§ 1. Jeder Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes:
1) an jedem Orte sich aufzuhalten oder niederzulassen, wo er eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen sich zu verschaffen im Stande ist;
2) an jedem Orte Grundeigenthum aller Art zu erwerben;
3) umherziehend oder an dem Orte des Aufenthalts, beziehungsweise der Niederlassung, Gewerbe aller Art zu betreiben, unter den für Einheimische geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
In der Ausübung dieser Befugnisse darf der Bundesangehörige, soweit nicht das gegenwärtige Gesetz Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit seiner Heimath, noch durch die Obrigkeit des Ortes, in welchem er sich aufhalten oder niederlassen will, gehindert oder durch lästige Bedingungen beschränkt werden.
Keinem Bundesangehörigen darf um des Glaubensbekenntnisses willen oder wegen fehlender Landes- oder Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Niederlassung, der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grundeigenthum verweigert werden.
§ 2. Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch nimmt, hat auf Verlangen den Nachweis seiner Bundesangehörigkeit und, sofern er unselbstständig ist, den Nachweis der Genehmigung desjenigen, unter dessen (väterlicher, vormundschaftlicher oder ehelicher) Gewalt er steht, zu erbringen.
Durch Artikel 37 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vom 18. August 1896 (RGBl. S. 604) erhielt der § 2 folgende Fassung:
"§ 2. Wer die aus der Reichsangehörigkeit folgenden Befugnisse in Anspruch nimmt, hat auf Verlangen den Nachweis seiner Reichsangehörigkeit und, sofern er unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft steht, den Nachweis der Genehmigung des gesetzlichen Vertreters zu erbringen.
Eine Ehefrau bedarf der Genehmigung des Ehemanns."
§ 3. Insoweit bestrafte Personen nach den Landesgesetzen Aufenthaltsbeschränkungen durch die Polizeibehörden unterworfen werden können, behält es dabei sein Bewenden.
Solchen Personen, welche derartigen Aufenthaltsbeschränkungen in einem Bundesstaate unterliegen, oder welche in einem Bundesstaate innerhalb der letzten zwölf Monate wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter Landstreicherei bestraft worden sind, kann der Aufenthalt in jedem anderen Bundesstaate von der Landespolizeibehörde verweigert werden.
Die besonderen Gesetze und Privilegien einzelner Ortschaften und Bezirke, welche Aufenthaltsbeschränkungen gestatten, werden hiermit aufgehoben.
§ 4. Die Gemeinde ist zur Abweisung eines neu Anziehenden nur dann befugt, wenn sie nachweisen kann, daß derselbe nicht hinreichende Kräfte besitzt, um sich und seinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den nothdürftigen Lebensunterhalt zu verschaffen, und wenn er solchen weder aus eigenem Vermögen bestreiten kann, noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, diese Befugniß der Gemeinden zu beschränken.
Die Besorgniß vor künftiger Verarmung berechtigt den Gemeindevorstand nicht zur Zurückweisung.
§ 5. Offenbart sich nach dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffentlichen Unterstützung, bevor der neu Anziehende an dem Aufenthaltsorte einen Unterstützungswohnsitz (Heimathsrecht) erworben hat, und weist die Gemeinde nach, daß die Unterstützung aus anderen Gründen, als wegen einer nur vorübergehenden Arbeitsunfihigkeit nothwendig geworden ist, so kann die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden.
Durch § 30 der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl. I. S. 100) erhielt der § 5 folgende Fassung:
"§ 5. Einem Hilfsbedürftigen, dem Armenfürsorge gewährt wird, kann die Fortsetzung des Aufenthalts in einer Gemeinde versagt werden, wenn diese nicht in dem Bezirke des endgültig verpflichteten Fürsorgeverbandes liegt und die Übernahme durch den endgültig verpflichteten Fürsorgeverband verlangt werden kann (§ 14 der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13 Februar 1924, RGBl. I. S. 103). Die Versagung muß sich zugleich gegen die Personen richten, deren gleichzeitige Übergabe oder Übernahme nach der aufgeführten Verordnung verlangt werden muß.
Dies gilt auch für hilfsbedürftige Minderjährige, denen Fürsorge gewährt wird, sofern es sich nicht um uneheliche, vollverwaiste oder getrennt von beiden Elternteilen untergebrachte Minderjährige unter sechzehn Jahren handelt."
§ 6. Ist in den Fällen, wo die Aufnahme oder die Fortsetzung des Aufenthalts versagt werden darf, die Pflicht zur Übernahme der Fürsorge zwischen verschiedenen Gemeinden eines und desselben Bundesstaates streitig, so erfolgt die Entscheidung nach den Landesgesetzen.
Die thatsächliche Ausweisung aus einem Orte darf niemals erfolgen, bevor nicht entweder die Annahme-Erklärung der in Anspruch genommenen Gemeinde oder eine wenigstens einstweilen vollstreckbare Entscheidung über die Fürsorgepflicht erfolgt ist.
Landesgesetze durch reichseinheitliche Regelungen des § 20 der Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl. I. S. 103) ersetzt. Der genannte § der Verordnung wurde durch Verordnung vom 7. Oktober 1939 (RGBl. I. S. 2002) geändert.
§ 7. Sind in den in § 5 bezeichneten Fällen verschiedene Bundesstaaten betheiligt, so regelt sich das Verfahren nach dem Vertrage wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Übernahme der Auszuweisenden de dato Gotha, den 15. Juli 1851, sowie nach den späteren, zur Ausführung dieses Vertrages getroffenen Verabredungen.
Bis zur Übernahme Seitens des verpflichteten Staates ist der Aufenthaltsstaat zur Fürsorge für den Auszuweisenden am Aufenthaltsorte nach den für die öffentliche Armenpflege in seinem Gebiete gesetzlich bestehenden Grundsätzen verpflichtet. Ein Anspruch auf Ersatz der für diesen Zweck verwendeten Kosten findet gegen Staats-, Gemeinde- oder andere öffentliche Kassen desjenigen Staates, welchem der Hülfsbedürftige angehört, sofern nicht anderweitige Verabredungen bestehen, nur insoweit statt, als die Fürsorge für den Auszuweisenden länger als drei Monate gedauert hat.
Der § wurde durch die Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 13. Februar 1924 (RGBl. I. S. 100) gegenstandslos.
§ 8. Die Gemeinde ist nicht befugt, von neu Anziehenden wegen des Anzugs eine Abgabe zu erheben. Sie kann dieselben, gleich den übrigen Gemeindeeinwohnern, zu den Gemeindelasten heranziehen. Übersteigt die Dauer des Aufenthalts nicht den Zeitraum von drei Monaten, so sind die neu Anziehenden diesen Lasten nicht unterworfen.
§ 9. Was vorstehend von den Gemeinden bestimmt ist, gilt an denjenigen Orten, wo die Last der öffentlichen Armenpflege verfassungsmäßig nicht der örtlichen Gemeinde, sondern anderen gesetzlich anerkannten Verbänden (Armenkommunen) obliegt, auch von diesen, sowie von denjenigen Gutsherrschaften, deren Gutsbezirk sich nicht in einem Gemeindeverbande befindet.
§ 10. Die Vorschriften über die Anmeldung der neu Anziehenden bleiben den Landesgesetzen mit der Maaßgabe vorbehalten, daß die unterlassene Meldung nur mit einer Polizeistrafe, niemals aber mit dem Verluste des Aufenthaltsrechts (§ 1) geahndet werden darf.
Der § wurde durch das Gesetz über das Paßwesen vom 11. Mai 1937 (RGBl. I. S. 589) gegenstandslos.
§ 11. Durch den bloßen Aufenthalt oder die bloße Niederlassung, wie sie das gegenwärtige Gesetz gestattet, werden andere Rechtsverhältnisse, namentlich die Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die Theilnahme an den Gemeindenutzungen und der Armenpflege, nicht begründet.
Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den Aufenthalt oder die Niederlassung, wenn solche eine bestimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgesetzt worden, das Heimathsrecht (Gemeindeangehörigkeit, Unterstützungswohnsitz) erworben wird, behält es dabei sein Bewenden.
§ 12. Die polizeiliche Ausweisung Bundesangehöriger aus dem Orte ihres dauernden oder vorübergehenden Aufenthalts in anderen, als in den durch dieses Gesetz vorgesehenen Fällen, ist unzulässig.
Im übrigen werden die Bestimmungen über die Fremdenpolizei durch dieses Gesetz nicht berührt.
§ 13. Dies Gesetz tritt am 1. Januar 1868 in Kraft.
Dieses Gesetz wurde gemäß dem, zwischen dem Norddeutschen Bund, Baden und Hessen vereinbarten Artikel 80 der Bundesverfassung nach dem 1. Januar 1871 als Reichsgesetz fortgesetzt; wo vom "Bund" die Rede ist, wurde nach diesem Zeitpunkt automatisch vom "Reich" die Rede.
Gemäß Maunz-Düring, Komm. z .GG, Art. 11 Rdnr. 16 ist das Gesetz bis heute in Kraft und auch in der "Systematischen Übersicht zum Deutschen Recht seit 1867" vom Stand Jan. 1959 wurde das Gesetz noch genannt, im Fundstellennachweis zum Bundesrecht aus dem Jahr 2002 fehlt es aber.
Quelle: Bundesgesetzblatt 1867 S. 55
Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871
Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871
"§ 31. Die Landarmenverbände - in der Provinz Ostpreußen der Landarmenverband der Provinz - sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hülfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu tragen."
(Gesetz, betreffend Abänderung der §§ 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871, vom 11. Juli 1891, PrGBl. S. 300 )
Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung
Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung
vom 22. Juni 1889
Unfallversicherungsgesetz
Neuste Geschichte

Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1933
Nach dem Ersten Weltkrieg
Nach dem ersten Weltkrieg nahm die Zahl der durch Kriegshandlungen oder Arbeitsunfälle an den Maschinen in den großen Industriebetrieben verletzten Menschen drastisch zu. Soldaten waren im Krieg verwundet worden oder hatten Gliedmaßen verloren. In den großen Industriebetrieben verletzten sich Arbeiterinnen und Arbeiter an den Maschinen. Beides hatte zur Folge, dass die bestehenden staatlichen, kirchlichen und familiären Versorgungssysteme nicht mehr ausreichten. Viele Familien verarmten, nachdem der Ernährer oder die Ernährerin einen Arbeitsunfall hatte. Diese Armut zog wiederum häufig gesundheitliche Einschränkungen nach sich. Dadurch, dass so viele Personen von Unfällen und Verletzungen betroffen waren – häufig auch aus dem engsten Bekannten- und Verwandtenkreis –, änderte sich die Haltung vieler Menschen zu Krankheit und Behinderungen.
Die "Krüppelpädagogik" entsteht
Immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen beschäftigten sich mit den Ursachen von Krankheit, Behinderungen und ihren medizinischen und pädagogischen Behandlungsformen. Mediziner, Medizinerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen forschten und arbeiteten jetzt in speziellen Wissenschaftszweigen. In dieser Zeit wurde beispielsweise mit der sogenannten "Krüppelpädagogik" eine besondere Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen begründet. Es entstanden spezielle Heime und Anstalten, die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen besuchen mussten. Auch die medizinische Psychiatrie etablierte sich. Sie begann, Menschen mit psychischen Krankheiten, geistigen Behinderungen oder sozialen Besonderheiten nicht mehr nur in Anstalten wegzusperren, sondern dort auch medizinisch zu behandeln.
Männer in Arbeit und Kinder in Heime
Damit sich Menschen mit Behinderungen – vor allem kriegsversehrte Männer – nicht als nutzlose Gesellschaftsmitglieder empfinden mussten und um ihre Arbeitskraft weiterhin nutzen zu können, wurden neue Gesetze beschlossen. Mithilfe dieser Gesetze sollten auch Menschen mit Behinderungen, vor allem Männer mit Körperbehinderungen, die Möglichkeit bekommen, wieder arbeiten zu gehen. Arbeitgebern wurde mit dem Schwerbeschädigtengesetz von 1920 (neu gefasst 1923 und dann wieder 1953) die Pflicht auferlegt, ein Prozent ihrer Arbeitsplätze mit sogenannten "Schwerbeschädigten" zu besetzen. Das Preußische Krüppelfürsorgegesetz (1920) und das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (1924) bewirkten, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gezählt und erfasst wurden und ihre Bildung auf eine spätere Erwerbsfähigkeit ausgerichtet wurde. Nun hatten auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen die Möglichkeit, Schulen zu besuchen. Allerdings waren dies besondere, meist an Heime angeschlossene Schulen, wo sie getrennt von anderen Menschen lernen und wohnen mussten. Aufgrund dieser Trennung und Aussonderung setzte sich in dieser Zeit die Vorstellung durch, Behinderung sei etwas Medizinisches, Fremdes und rein Problematisches. Diese Vorstellung begleitet uns bis heute.
Der Beginn der Selbsthilfe-Bewegung
In dieser Zeit organisierten sich Frauen und Männer mit Behinderungen erstmalig selbst (zum Beispiel im Selbsthilfebund für Körperbehinderte von 1917) und begannen, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Sie wehrten sich gegen den Begriff "Krüppel", da dieser einen Menschen ausschließlich anhand einer Beschädigung seines Körpers - negativ - bezeichnet, statt den ganzen Menschen zu umfassen. Sie forderten statt des Begriffes "Krüppel" die Verwendung des Begriffs "Körperbehinderung".
Biografien
Marie Gruhl
Marie Gruhl (1881-1929)
Marie Gruhl wurde am 25. Mai 1881 in Barmen im Rheinland geboren. Das Kind kam ohne Füße zur Welt. Die Eltern kümmerten sich liebevoll um ihr Kind und waren bemüht, die Tochter ebenso wie ihren 12 Jahre älteren Bruder zur Selbstständigkeit zu erziehen. Marie besuchte die öffentliche Mädchenschule, das städtische Charlottenlyzeum, das nur zehn Minuten vom Elternhaus entfernt lag. Sie bewegte sich mithilfe von Prothesen und einem Rollstuhl fort. Als Tochter des Direktors eines Realgymnasiums wollte sie Lehrerin werden und legte 1901 und 1907 die dafür nötigen Prüfungen ab. 1911 wurde sie Lehrerin an der Schule, die sie selbst als Schülerin besucht hatte, dem Charlottenlyzeum.
Als einzige Frau gründete sie 1919 in Berlin gemeinsam mit mehreren Männern, unter anderem Otto Perl, den "Selbsthilfebund der Körperbehinderten (Otto Perl-Bund)". Der Bund hatte sich die geistige und wirtschaftliche Förderung behinderter Menschen zum Ziel gesetzt. Marie Gruhl übernahm neben ihrer Berufstätigkeit und ihrem sonstigen Engagement im Selbsthilfebund auch dessen Geschäftsführung. Sie beteiligte sich an den Diskussionen zur Gestaltung und Verabschiedung des "Preußischen Krüppelfürsorgegesetzes von 1920" und weiteren Gesetzen, die eine Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen darstellten. Das "Preußische Krüppelfürsorgegesetz" war das erste gesetzliche Regelwerk, das Fürsorgemaßnahmen für Menschen mit körperlichen Behinderungen als staatliche Verpflichtung festschrieb und somit den Betroffenen einen Anspruch auf Leistungen gewährte. Menschen mit Behinderungen wurden nun in sogenannten "Krüppelheimen" erzogen und ausgebildet. Marie Gruhl setzte sich besonders dafür ein, dass Kinder mit und ohne Behinderungen die Möglichkeit bekamen, gemeinsam aufzuwachsen und zusammen in die Schule zu gehen. Da sie selbst durch die Erziehung ihrer Eltern und den Besuch der öffentlichen Schule größtmögliche Selbstständigkeit erlangt hatte, wollte sie allen jungen Menschen mit Behinderungen dasselbe ermöglichen.
Über ihr Leben schrieb sie: "Es ist für meinen Körper alles Erdenkliche geschehen, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen und mich selbst möglichst unabhängig von der Hilfe anderer zu machen. Abgesehen davon aber bin ich erzogen worden wie ein normales, gesundes Kind: ich wuchs im Sonnenschein des Elternhauses auf; ich durfte die öffentliche Schule besuchen, durfte mich meiner Neigung folgend ausbilden und darf heute im öffentlichen Lehramt stehend meinen Platz im Leben neben und mit Gesunden ausfüllen." Im Gegensatz zu den nicht behinderten professionellen Fachleuten der damaligen "Krüppelfürsorge", vor allem Medizinern, Medizinerinnen, Pädagoginnen und Pädagogen, formulierte Marie Gruhl den Grundsatz, dass ein Kind mit Behinderung nach Möglichkeit in die Gemeinschaft der „Gesunden“ gehört. Ihre Überlegungen, wie eine gemeinsame Erziehung ermöglicht werden kann, lesen sich auch heute noch sehr modern. Sie sah vor allem Unterstützungsbedarf für Familien mit körperbehinderten Kindern. Die Schulen betreffend setzte sie sich für eine Vorbereitung der Lehrkräfte auf die gemeinsame Erziehung ein.
Marie Gruhl unternahm viele beschwerliche Reisen in die großen Anstalten Deutschlands und ins Ausland, um die Anstalts- und Heimfürsorge und ihren Einfluss auf Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in der Praxis zu studieren und Material für eine Dokumentation über die Ausbildungsmöglichkeiten für körperbehinderte Kinder und Jugendliche zu sammeln. Sie besuchte Waisenhäuser, Kinderheime, "Siechen"- und Altenheime, Fürsorgeanstalten für Jugendliche und Kliniken. Während einer dieser Reisen zog sie sich eine schwere Erkältungskrankheit zu, an deren Folgen sie am 21. Februar 1929 im Alter von nur 48 Jahren starb.
Margarete Steiff
Margarete Steiff (1847 – 1909)
Wer kennt nicht die Steiff-Spielzeugtiere? Ihre Geschichte begann zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit Margarete Steiff und einem Filz-Elefanten. Sie entwarf den Filz-Elefant oder "Elefäntle" als Nadelkissen und verkaufte ihn. Der erste Entwurf stammte aus einer Modezeitschrift. Kindern gefiel der Elefant so sehr, dass bald weitere Tiere hinzukamen. So entstand die "Filz-Spielwaren-Fabrik" von Margarete Steiff. Sie wurde dort von ihren Neffen unterstützt. 1902 erfand Richard Steiff einen beweglichen Bären aus Plüsch (siehe Bild). 1906 wurde dieser bekannt als "Teddybär" und zum Nationalspielzeug der USA. Sein Name war eine Anspielung auf Theodore (Teddy) Roosevelt, den 26. Präsidenten der Vereinigten Staaten.
1902 arbeiteten 200 Beschäftigte in der Spielwarenfabrik. Sechs Prozent der Mitarbeitenden waren körperbehindert. Sie hatten große Schwierigkeiten gehabt, eine Arbeitsstelle zu finden, bis sie bei den Steiffs anfingen. Da es unterschiedliche Aufgaben und Arbeitsbereiche in der Firma gab, konnten alle Mitarbeitenden einer Arbeit nachgehen, die ihren Fähigkeiten entsprach.
Auch Margarete Steiff war körperbehindert. Sie schreibt in ihrer Lebensgeschichte:
"Mit eineinhalb Jahren wurde ich von einer Krankheit befallen, nach welcher ich nicht mehr gehen konnte, der linke Fuß war vollständig, der rechte teilweise gelähmt, auch der rechte Arm war sehr geschwächt. Im Übrigen war und blieb ich von da an stets gesund." (1)
Margarete Steiff hatte sich schon als Kind an der sogenannten "Kinderlähmung" angesteckt, einer Virusinfektion, mit der sich zu dieser Zeit tausende Menschen infizierten. Heute existiert in vielen Ländern eine Impfung gegen diese Krankheit.
Sie wuchs als Tochter des Bauwerksmeisters Friedrich Steiff und seiner Frau Maria Margarete in Giengen an der Brenz in Süddeutschland auf. Die Eltern hofften jahrelang auf eine Heilung ihrer Tochter und setzten all ihre Kraft und ihr Geld dafür ein. So war Margarete mehrmals zur Kur, mit dem Ziel, gesund nach Hause zu kommen. Sie schreibt in ihrer Lebensgeschichte dazu:
"Es war ein langes Suchen nach Heilung, bis ich mir selbst sagte, Gott hat es so für mich bestimmt, dass ich nicht gehen kann. Es muss auch so recht sein… das unnütze Suchen nach Heilung lässt den Menschen nicht zur Ruhe kommen."
Margarete beschloss, dass ein schönes Leben für sie bedeutete, ein erfülltes Leben mit ihrer Krankheit zu führen und lieber arbeiten zu gehen, als weiter ihre Kraft bei Versuchen zu verbrauchen, gesund zu werden. Das war eine ausgesprochen ungewöhnliche Haltung für eine Frau in dieser Zeit. Vermutlich auch deshalb sagte ihr Vater, ihr Können und Mut seien größer als ihre Behinderung. (1) Auch in ihrer Grabrede wurde darauf hingewiesen, wie ungewöhnlich es sei, dass Margarete Steiff, die als Kind nur mit mitleidigen Blicken bedacht wurde und der man wegen ihrer Behinderung kein erfülltes, arbeitsreiches Leben, sondern eine "Existenz im Winkel", in der Stille und Vergessenheit vorausgesagt hatte, "so heraustritt an das Licht der Öffentlichkeit". (2)
Ihr ist eine Gedenktafel in der Stadt Giengen gewidmet.
Quellen:
1: Wolfgang Heger (2009): Das Tor zur Kindheit. Die Welt der Margarete Steiff. Mitteldeutscher Verlag: Saale. S. 158
2: Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. Die Spielzeugfabrikantin im Rollstuhl. Luchterhand: Neuwied; Berlin, S. 73-79
Gesetze
Preußisches Krüppelfürsorgegesetz
Preußisches Krüppelfürsorgegesetz
"§ 1. […] Die Landesarmenverbände sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur, und Pflege der hilfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen, Blinden und Krüppel, soweit sie der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu treffen. Bei Krüppeln unter 18 Jahren umfasst die Fürsorge auch die Erwerbsbefähigung der Krüppel […]
§ 8. Jeder Stadt- und Landkreis hat mindestens eine Fürsorgestelle für Krüppel zu schaffen oder sich einer solchen anzugliedern."
(Preußisches Gesetz, betr. Die öffentliche Krüppelfürsorge. Vom 6. Mai 1920)
"Jedes schulfähige Krüppelkind gehört an sich in eine besondere Krüppelschule, in der es unter Berücksichtigung der verschiedenen Gebrechen nach bestimmten Methoden auf Grund der besonderen Krüppelseelenkunde unterrichtet wird. Das aus dem Krüppelheim geheilt entlassene Krüppelkind sende man möglichst nicht in die Volksschule zurück, sondern führe es tunlichst in eine dem Heim angeschlossene ambulante Krüppelschule, die nach denselben pädagogischen und gleichen Methoden geleitet wird wie die Krüppelschulen in den Heimen." (Preußisches Gesetz, betr. Die öffentliche Krüppelfürsorge. Vom 6. Mai 1920)
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
Unterstützungswohnsitzgesetz
Unterstützungswohnsitzgesetz
"§ 31. Die Landarmenverbände - in der Provinz Ostpreußen der Landarmenverband der Provinz - sind verpflichtet, für Bewahrung, Kur und Pflege der hülfsbedürftigen Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, soweit dieselben der Anstaltspflege bedürfen, in geeigneten Anstalten Fürsorge zu tragen."
Gesetz, betreffend Abänderung der §§ 31, 65 und 68 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März 1871, vom 11. Juli 1891, PrGBl. S. 300
Nationalsozialismus
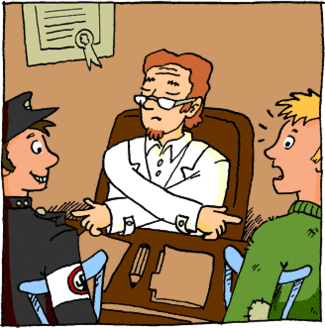
Nationalsozialismus (1933 bis 1945)
Der "Rassegedanke"
Zwischen 1933 und 1945 änderte sich wenig an den Haltungen und Gesetzen, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden waren. Jedoch änderten sich nach der Wahl der NSDAP zur stärksten Partei die Auslegung von Gesetzestexten und ihre Anwendung. Vor allem aber wurden ab 1933 systematisch nur die Haltungen, Einrichtungen, Forschungen, Bücher und öffentlichen Diskussionen unterstützt, die dem sogenannten"„Rassegedanken" entsprachen. Alle anderen Positionen wurden für unerwünscht erklärt. Dieser sogenannte "Rassegedanke" teilte Menschen ohne deren Beteiligung und nach willkürlichen Kriterien in "gut" oder "schlecht" ein. Diese Einteilung entschied häufig darüber, ob die Menschen das Recht hatten (frei) zu leben oder ob sie eingesperrt, zwangsweise sterilisiert oder sogar getötet wurden.
Die willkürliche Einteilung von Menschen
Die Menschen wurden im nationalsozialistischen System von anderen Menschen, beispielsweise Juristen oder Ärzten in Gruppen eingeteilt. Zu welcher Gruppe man gehörte, wurde nicht aufgrund von Fakten entschieden, sondern anhand von Annahmen der einteilenden über die Herkunft, über Familienmitglieder, Hautfarbe, Religion, Sprache, das Aussehen, den Körper, die finanziellen Verhältnisse, das Verhalten oder die sexuelle Orientierung. Je nachdem, welche Attribute Menschen zugeordnet wurden, kamen unterschiedliche Folgen auf sie zu: Wurden Menschen mit der jüdischen Religion in Verbindung gebracht, beispielsweise weil sie ein Familienmitglied hatten, das der jüdischen Religion angehörte, wurden sie fast immer in Konzentrationslager gesperrt und getötet. Galten Menschen als arm und gleichzeitig krank, wurden sie häufig in Heime oder Krankenhäuser eingewiesen. Dort wurden viele von ihnen gegen ihren Willen mit schmerzhaften Methoden behandelt, zwangsweise unfruchtbar gemacht und getötet.
Ärzte und Ärztinnen entscheiden über Menschen
Meist legten Medizinerinnen und Mediziner diese Auslese-Kriterien fest und ordneten zu, wer diesen entsprach. Die Betroffenen hatten keinerlei Mitspracherecht und die Kriterien wurden willkürlich angewendet. So entschieden Mediziner und Medizinerinnen, wer für die Gesellschaft "nützlich" und wer "schädlich" oder "lebensunwert" war und vernichtet werden sollte. Beispielsweise wurden die im Krieg verletzten nichtjüdischen Soldaten als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft betrachtet und vom Staat mit Geld unterstützt. Menschen hingegen, die aus armen Familien stammten und deren Verletzungen nicht vom Krieg herrührten, wurden als "minderwertig" eingestuft. In armen Familien konnten nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (von 1933 sowie seinen späteren Durchführungsverordnungen) schon Kinder unfruchtbar gemacht werden.
"Erbgesundheitsgesetz" und erzwungene Sterilisationen
Mit dem Erbgesundheitsgesetz (1933) wurde der Begriff "Erbkrankheit" eingeführt. Mediziner und Medizinerinnen definierten nach Belieben, wer "erbkrank" war. Bereits eine Seh- oder Hörbehinderung konnte als erblich eingestuft werden und zur Zwangssterilisation der betroffenen Person führen. Mit diesem Gesetz begann die vollständige Entrechtung von Menschen mit Behinderungen. Aber auch andere Bevölkerungsgruppen, wie die der Sinti und Roma, wurden als krank bezeichnet. Viele Frauen und Männer wurden auf dieser Grundlage Opfer von Zwangssterilisationen. Historiker und Historikerinnen schätzen, dass im sogenannten "Euthanasieprogramm" des Nationalsozialismus 200.000 Menschen getötet und ca. 400.000 Menschen zwangssterilisiert wurden. Die unfreiwilligen Sterilisationen hatten für die Betroffenen schwere gesundheitliche Schäden und große seelische Verletzungen zur Folge.
Wie war dieses Unrecht möglich?
Durchsetzen konnte sich diese Politik gegenüber Menschen mit Behinderungen aufgrund verschiedener Faktoren: Zum einen war es schon viele Jahre vorher üblich gewesen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderungen in Anstalten und Heimen unterzubringen, sodass Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen im Alltag keinen Kontakt miteinander hatten. Dadurch wussten viele Leute wenig über Behinderung und Krankheit, und das Wenige waren vor allem negative Dinge. Auch die Einteilung von Menschen in "gut und gesund" oder "krank und schlecht", in "arbeitsfähig und tüchtig" oder "arbeitsunfähig und faul" mit der entsprechenden Bewertung hatte sich bereits vor 1933 in weiten Teilen der Bevölkerung durchgesetzt. Zudem wurden Menschen mit Behinderungen oder Krankheiten als fürsorgebedürftig und nicht als gleichberechtigt und ernst zu nehmend betrachtet. Diese weit verbreitete Haltung war ein Grund dafür, dass selbst Angehörige von Menschen mit Behinderungen selten versuchten, gegen die menschenunwürdige Behandlung ihrer Angehörigen zu protestieren. Mit dieser Haltung sahen sich auch diejenigen konfrontiert, die nach 1945 um eine Entschädigung für das erlittene Unrecht kämpften.
Weitere Informationen, Bilder und Übungen zu diesem Thema findest du unter "Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus".
Materialien
NS-Verfolgte im Alter
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
(Andrea Zielke-Nadkarni)
NS-Verfolgte, so glauben viele, sind längst verstorben oder nach Kriegsende emigriert. Tatsächlich aber lebt noch immer eine nur zu schätzende Anzahl von etwa 100.000 verstreut unter uns: Menschen, die verfolgt wurden, weil sie beispielsweise Zeugen Jehovas, Schwule und Lesben, Frauen und Männer der Sinti und Roma, Juden und Jüdinnen sind, Regimegegnerinnen und –gegner oder Deserteure waren oder als "lebensunwert" und "asozial" im Sinn der NS-Rasse- und Gesundheitspolitik galten. Auch Christinnen und Christen wurden verfolgt, wenn sie ihren religiösen Grundsätzen entsprechend handelten und damit gegen das Regime standen. Eine weitere Gruppe sind die jüdischen Migrantinnen und Migranten aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Seit Januar 1991 ist ihnen die Auswanderung nach Deutschland ermöglicht worden, indem ihnen ein Sonderstatus als sogenannte Kontingentflüchtlinge zugebilligt wurde. Dies hatte die Einwanderung von rund 100.000 Personen zur Folge (1), eine beachtliche Zahl, bedenkt man, dass bis 1989 nur etwa 30.000 jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland lebten. Wenngleich viele von ihnen von den verschiedenen sowjetischen Regimes diskriminiert und verfolgt wurden, muss man davon ausgehen, dass unter den über 60-Jährigen viele Überlebende der Shoah sind.
Unerkannt tragen - neben dieser größeren Gruppe - viele aus anderen Gründen Verfolgte die (biografische) Last der Trauma-Erfahrung im Alter. In dieser Lebensphase wird man dünnhäutiger, die "seelischen Abwehrkräfte" lassen nach, und die zunehmenden körperlichen Beschwerden führen zu Hilfsbedürftigkeit, die die Frage nach pflegerischer Unterstützung akut werden lässt. In den westlichen Industriegesellschaften haben alte Menschen tendenziell einen niedrigen Sozialstatus und leben häufig isoliert. Bei NS-Verfolgten kommen zu den "normalen" Erschwernissen im Alter ihre Traumata und die massive soziale Meidung der NS-Verfolgungsthematik zusätzlich als isolierende Faktoren hinzu. Sie alle sind durch ähnliche Erlebnisse geprägt und haben im Alter häufig Angst vor dem Kontakt mit der Generation der Täter und Täterinnen, zum Beispiel vor dem Zimmernachbarn im Altenpflegeheim oder der Tischnachbarin im Speisesaal der Kurklinik, die vielleicht alte Nazis, Sympathisanten oder Sympathisantinnen sind.
Die gesamte Gruppe der NS-Verfolgten tritt im deutschsprachigen Raum in pflegetheoretischen Abhandlungen und in der (Alten-)Pflegeausbildung bislang kaum in Erscheinung. Damit befindet sich die Pflege in "guter Gesellschaft", denn Forschungen zur Situation von NS-Verfolgten, in erster Linie Überlebende der Shoah, wurden erst ab den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts betrieben, vor allem in den USA, wo rund sechs Millionen jüdische Bürgerinnen und Bürger leben, gefolgt von Kanada, Großbritannien und Israel. Für die pflegerische Versorgung der in Europa lebenden Menschen mit Verfolgungserfahrungen aus der NS-Zeit bestehen dagegen ausgeprägte Forschungslücken, was besonders tragisch ist, da hier die ehemals Verfolgten in den Gesellschaften der Täter und Täterinnen leben müssen.
Mit unserem Text möchten wir einen Einblick in die Lebenserfahrungen der Betroffenen geben, denn immer wieder wurde uns auf öffentlichen Veranstaltungen zu diesem Thema deutlich, dass das "Dritte Reich" für Altenpflegeschülerinnen und –schüler heute sehr weit weg ist von ihrer Gegenwart. Häufig ist ihnen nicht bewusst, dass eine Verbindung zwischen dieser für Deutschland so unrühmlichen Zeit und ihrer eigenen Arbeit mit den Menschen, die sie pflegen, besteht. Andererseits haben wir aber auch erlebt, dass gerade sie für dieses Thema besonders offen sind, denn der zeitliche Abstand zur Nazizeit erleichtert es, sich dem schwierigen Thema zu nähern. Auch haben die Schülerinnen und Schüler andere, weniger abhängige Beziehungen zu den involvierten Großeltern, worin wiederum eine Chance liegt, dieses Thema offener ins aktuelle Berufsleben zu transportieren.
Um aufzuzeigen, wie differenziert die Situation bei aller Gemeinsamkeit dennoch ist, haben wir nach Interviewpartnerinnen und –partnern gesucht, die die große Bandbreite der Verfolgungsgründe repräsentieren: So sind Fanny T., Lily P. und Chana G. Jüdinnen, Paul S. war Deserteur, Karl D. wurde als "erbkrankes" Kind mit der Pseudodiagnose "Debilitis und Psychopathie" in die Psychiatrie eingewiesen, Ryszard K. und Milan B. waren polnische Zwangsarbeiter, Josefa O. und Rosa M. sind Sintessa.
Diese Menschen, die durch Alterserkrankungen pflegebedürftig sind oder zu werden drohen, bilden aufgrund ihrer Verfolgungs- und Diskriminierungserfahrungen eine besonders verletzliche Gruppe, die erhöhte und sehr spezielle Pflegeanforderungen stellt. Sie soll daher hier zu Wort kommen.
Die Interviews, die wir mit den NS-Verfolgten geführt haben, haben wir zu Geschichten umformuliert, die jedoch zahlreiche authentische Ausschnitte aus den Interviews enthalten. Zu jedem Erzähltext wurden Vorschläge für eine Bearbeitung im Unterricht in der Altenpflegeausbildung entwickelt. Die Didaktisierung spezieller Themen aus den einzelnen Geschichten wird verbunden mit Forschungsergebnissen aus dem internationalen Raum und dem soziohistorischen Hintergrund. Dieses Vorgehen verbindet authentisches Interviewmaterial mit historischen Fakten und personenübergreifenden Kenntnissen über die Situation dieses Personenkreises, bezogen auf seine Pflegebedürfnisse.
Den authentischen Erzähltexten vorangestellt ist eine historische Darstellung über Verfolgung im "Dritten Reich", die nicht auf Vollständigkeit abzielt, sondern den Zusammenhang zwischen der Zeitgeschichte und der einzelnen Biografie herstellen möchte.
Im Anschluss an die biografischen Erzählungen und die Didaktisierungen folgt ein Menüpunkt zum Thema Trauma, in dem zunächst der Begriff des Traumas näher definiert wird, um daran anschließend die gesundheitlichen Auswirkungen von Traumatisierungen zu beschreiben. In zwei weiteren Beiträgen werden die möglichen Auswirkungen der Traumatisierungen auf das Leben im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie Wege des Umgangs mit diesen Menschen aufgezeigt. Diese Menüpunkte stehen weiter unten, weil sich die Altenpflegeschülerinnen und –schüler zunächst einmal mit den Biografien der NS-Verfolgten als solchen und mit ihren eigenen Gefühlen und Erfahrungen in diesem Rahmen auseinandersetzen sollen, ehe sie mit weiteren Sachinformationen, die wiederum von anderen stammen, zu möglichen Lösungen geführt werden. Denn über die eigenen Emotionen und Gedanken kann ein persönlicher Zugang zur Problematik geschaffen werden. Hierzu tragen auch die vielen, in den Didaktisierungsvorschlägen angeregten Diskussionen bei. Die Tabuisierung durch die Betroffenen selbst ist, wie die Texte zeigen, gut begründet. Gleichzeitig ist auch die Generation der Täter und Täterinnen Klientel der Altenhilfe bzw. -pflege. Diese Bedingungen sowie die historische Ferne der auslösenden Ereignisse für viele Pflegepersonen bewirken ein unheilvolles Schweigen und eine innere Distanzierung von diesen Vorgängen und ihren Folgen, die über den gewählten methodischen Weg durchbrochen werden können.
NS-Verfolgte im Alter: Hintergrundtext
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
Hintergrundtext
(Christina Hilgendorff)
Keine Epoche der deutschen Geschichte ist heute so gut erforscht wie die zwölf Jahre des Nationalsozialismus. Die Veröffentlichungen hierzu sind inzwischen unüberschaubar, auch im Fernsehen und Radio werden fast wöchentlich Dokumentationen und Filme gesendet. Um das historische Verständnis der Erzählungen zu erleichtern, richtet sich deshalb hier der Blick auf die NS-Verfolgten: Wer wurde verfolgt, warum, wann und wie. Zur Orientierung sind zentrale Aspekte und Begriffe hervorgehoben. In den Fußnoten und am Ende stehen Hinweise zum Weiterlesen und Weitersehen.
Die Verfolgung durch den NS-Staat war grausam und umfassend. Sie hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Aber zu allen Zeiten und in allen Situationen haben Menschen sich gegen die Zerstörung ihres Lebens und das anderer gewehrt und für ihre Freiheit gekämpft. Es existieren unzählige Zeugnisse darüber, wie Menschen versucht haben – und wie es ihnen gelungen ist –, Widerstand zu leisten: durch kleine und große Akte der Solidarität, durch das Widersetzen und Unterlaufen von Verboten, durch Sabotage, bewaffneten Widerstand, durch Flucht, durch Aufstände in Gettos und Lagern oder auch durch das beständige Bemühen, der beabsichtigten seelischen und körperlichen Zerstörung in der Lagerhaft eine selbstbestimmte innere Welt entgegenzusetzen. Diese Erfahrungen haben alle Überlebenden der NS-Verfolgung auf die eine oder andere Weise gemacht. Das gilt es immer mitzudenken, wenn man die folgende knappe Darstellung liest, um die Menschen als Subjekte und nicht nur als Opfer der Verfolgung wahrzunehmen.
Die Ideologie
Die NS-Ideologie fußte auf einem extremen Biologismus, einer Weltsicht, in der Menschen von Natur aus ungleich sind, unterteilt in "höher- und minderwertige" Individuen, in Herren und Knechte, in Führer und Geführte. Die Menschen leben in einer "Volksgemeinschaft", in der sich durch "natürliche Auslese" die "Starken als Führende" durchsetzen, als solche die "wahren Interessen des Volkes" vertreten und deshalb Verfügungsgewalt besitzen. Dieses Konzept des Kampfes zwischen Oben und Unten, zwischen Freund und Feind wird übertragen auf die Ebene der Welt. Auch hier kämpfen "höher- und minderwertige Völker" um Herrschaft und Überleben.
In einem Regime, das auf diesem Konzept gründet, liegt ein besonderes Gewicht auf der Disziplinierung, Formierung, Gleichschaltung und Ausrichtung der eigenen Gesellschaft. Im Gegenzug erleiden alle, die nicht zu dieser Gemeinschaft dazugehören sollen, und diejenigen, die nicht dazugehören wollen, Ausgrenzung, Entrechtung, Verfolgung, Ausschluss und Vernichtung.
Im Nationalsozialismus gehörten zu der erstgenannten Gruppe diejenigen Menschen, die innerhalb des deutschen Volkes entsprechend der NS-Rassenhygiene als "minderwertig" und "volksschädigend" galten: Homosexuelle, Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung aber auch vermeintliche "Asoziale" und "Gewohnheitsverbrecher". Parallel dazu wurden Menschen als "rassisch minderwertig" definiert und ausgeschlossen. Juden, Sinti und Roma, slawische Völker, hier vor allem Russen und Polen, waren in dem Konzept des anthropologischen Rassismus hierarchisch eingestuft. Die Feindschaft gegen Juden und Jüdinnen war absolut, zielte erst auf Vertreibung, dann auf Vernichtung (mörderischer Antisemitismus). Zur zweiten Gruppe – Menschen, die nicht dazugehören wollten – zählten politische Gegnerinnen und Gegner und diejenigen Männer und Frauen, die aus moralischen und religiösen Gründen dem Nationalsozialismus widerstanden.
"Machtübernahme" 1933
Nachdem Hitler 1933 vom Reichspräsidenten Hindenburg zum Reichskanzler ernannt worden war, bauten die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten die von ihnen gehasste Weimarer Republik zügig in eine totalitäre Führerdiktatur um. Hitler löste sofort den Reichstag auf und setzte Neuwahlen an. Nach dem Reichstagsbrand im Februar wurden mit der Verordnung "Zum Schutz von Volk und Staat" die Grundrechte (hierzu gehörten etwa die Meinungs-, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung) außer Kraft gesetzt. Auf scheinbar legalem Weg verhängte man so einen permanenten und während des NS-Regimes nie aufgehobenen Ausnahmezustand. So konnten danach unter anderem Gegnerinnen und Gegner ohne Anklage und Beweise in "Schutzhaft" genommen und regimekritische Zeitungen verboten werden. Die "Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung" vom März 1933 stellte danach alle kritischen Äußerungen gegen die Regierung unter Strafe. Nach seinem knappen Wahlsieg im März 1933 legte Hitler das sogenannte Ermächtigungsgesetz vor, mit dem er seine Regierung der Kontrolle des Parlaments und der verfassungsmäßigen Kontrollorgane entzog. Mit Ausnahme der SPD stimmten die abgeordneten Männer und Frauen aller Parteien für das Gesetz. Die Sitze der KPD waren zu dieser Zeit bereits annulliert. Weitere wesentliche Maßnahmen der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten waren die Gleichschaltung der Länder, der Gewerkschaften, der Jugendorganisationen, die Säuberungen der Behörden und schließlich das Verbot sämtlicher Parteien außer der NSDAP. Die erste deutsche Demokratie war damit binnen weniger Monate zerstört.
Diskriminierung, Entrechtung und Dehumanisierung
Zu den Opfern der Verfolgung dieser ersten Monate gehörten Gegnerinnen, Gegner, Kritikerinnen und Kritiker der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten, so Männer und Frauen der KPD, der SPD, der Gewerkschaften, der Verbände und zivilgesellschaftlichen Organisationen (zum Beispiel Deutsche Liga für Menschenrechte), Journalistinnen und Journalisten, Rechtsanwältinnen und -anwälte, Richterinnen und Richter, kritische Intellektuelle, Künstlerinnen und Künstler. Angehörige der SA verschleppten unzählige Menschen in sogenannte wilde Konzentrationslager und Gefängnisse, die überall im Land entstanden. Im Sommer 1933 saßen über 26.000 Menschen in "Schutzhaft". Rechtlos waren sie den Schikanen, Entwürdigungen und schweren Misshandlungen der SA-Männer ausgeliefert. (2)
Gleichzeitig begannen die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten, die "arische Volksgemeinschaft" zu propagieren und entsprechend ihrer Rassenideologie Menschen anzugreifen und zu diskriminieren. So setzte unmittelbar mit der Regierungsübernahme die rechtliche Diskriminierung jüdischer Bürgerinnen und Bürger ein. Sie wurden aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen, erste Berufsverbote und Ausschlüsse aus Berufsverbänden und -kammern erlassen. "Deutsche, kauft nicht bei Juden" forderte die SA die Bevölkerung am 1. April 1933 zu Boykott und Entsolidarisierung auf. Es kam zu Übergriffen, die sich auch gegen Ärztinnen und Ärzte, Rechtsanwältinnen und -anwälte, Richterinnen und Richter sowie Intellektuelle richteten. (3)
Ende 1934 wurde die "Verordnung zur Abwehr heimtückischer Angriffe" durch das sogenannte Heimtückegesetz abgelöst. Jede nicht konforme Äußerung konnte angezeigt werden und zu Haft- und Todesstrafe führen. Der Denunziation waren damit Tür und Tor geöffnet, und Menschen wurden durch Bekannte, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarinnen und Nachbarn, Vermieterinnen und Vermieter, Freundinnen und Freunde, Familienangehörige etc. angezeigt. Vor den sogenannten Sondergerichten gab es keine Rechtsmittel. Die Angeklagten waren damit ohne jegliche Möglichkeit der Verteidigung. Mit Kriegsbeginn 1939 traten immer neue Strafbestimmungen in Kraft: etwa gegen das Hören von Feindsendern, bei Kontakten zu Kriegsgefangenen, bei Diebstählen während der Verdunklungszeiten. Die Verurteilungen nahmen jetzt dramatisch zu. Der als Sondergerichtshof errichtete "Volksgerichtshof" fungierte ab 1936 sogar als ordentliches Gericht mit der Zuständigkeit für Landes- und Hochverrat, später auch für schwere Wehrmittelbeschädigung, Feindbegünstigung, Spionage und Wehrkraftzersetzung. Allein hier fällten die Juristen und Juristinnen bei 18.000 Urteilen 5.200 Todesurteile. (4)
Am 1. Januar 1934 trat das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" in Kraft, mit dem Menschen, die beispielsweise an Schizophrenie oder Epilepsie litten, blind oder taub waren, Fehlbildungen hatten oder alkoholabhängig waren, zwangssterilisiert werden konnten. Das Gesetz ermöglichte auch die Kastration homosexueller Männer. Auch Sinti und Roma waren als "erbkrank" und "erbkrankverdächtig" vielfach Opfer der Zwangssterilisation. Allen diesen Menschen verweigerte der NS-Staat ihr Menschsein, indem er ihre Möglichkeit der Fortpflanzung zerstörte. Bei der Umsetzung des Gesetzes arbeiteten in den folgenden Jahren Mediziner und Medizinerinnen, Juristen und Juristinnen, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sowie Pflegende der Kreisgesundheitsämter, der Erbgesundheitsgerichte, chirurgischer und gynäkologischer Kliniken sowie psychiatrischer Heil- und Pflegeanstalten eng zusammen. Man geht heute davon aus, dass mindestens 400.000 Menschen dieser körperlichen und seelischen Verstümmelung und Verletzung zum Opfer fielen. (5)
1935 verschärften die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten den Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches, der männliche Homosexualität unter Strafe stellte. Die Höchststrafe lag jetzt bei zehn Jahren statt der bisherigen sechs Monate. Etwa 100.000 Männer wurden bis 1945 verurteilt, eine unbekannte Zahl von ihnen in psychiatrische Anstalten eingewiesen, 10-15.000 Männer in Konzentrationslagern inhaftiert, in denen mindestens 6.000 umkamen. Frauen wurden nicht strafrechtlich verfolgt, waren aber genauso gezwungen, ihre Homosexualität zu verbergen. (6)
Im September 1935 wurden auf dem Nürnberger Parteitag die sogenannten Rassegesetze verkündet. Mit dem "Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre" wurden Eheschließungen zwischen Juden/Jüdinnen und Nicht-Juden/Nicht-Jüdinnen sowie der außereheliche Geschlechtsverkehr als Delikt der "Rassenschande" verboten und Verstöße mit Haft bestraft. Dieses Gesetz wurde auch auf Männer und Frauen der Sinti und Roma angewandt. Der sogenannte Arierparagraf definierte Menschen entsprechend ihrer "rassischen Abstammung" als "Volljuden", "jüdische Mischlinge 1. und 2. Grades", "Halb- und Vierteljuden", als "Geltungsjuden" und "jüdisch versippt". Der Gesetzgeber entschied ab jetzt, wer Jude und Jüdin war, diskriminierte und verfolgte die Menschen mit einem sie spaltenden Gesetzes- und Maßnahmenkatalog. Das ebenfalls verkündete "Reichsbürgergesetz" schränkte die Rechte aller Deutschen jüdischen Glaubens oder mit zwei Großeltern jüdischen Glaubens ein. Sie waren jetzt nicht mehr Bürgerinnen und Bürger, sondern Staatsangehörige ohne politische Rechte.
Es folgten in den nächsten Jahren immer mehr Gesetze, die Menschen ausgrenzten und ihre Lebensgrundlagen zerstörten. Aber noch versuchte der Staat, Bürgerinnen und Bürger damit zum Verlassen des Landes zu zwingen. So begann 1937 der staatlich organisierte Raub jüdischen Eigentums mit der sogenannten Arisierung. (7) Juden und Jüdinnen wurden gezwungen, ihren Besitz weit unter Wert zu verkaufen. Berufsverbote wurden ausgeweitet, Theater- und Kinobesuche verboten, die Zwangsnamen Sara und Israel eingeführt, Pässe gekennzeichnet. Am 9. November 1938 initiierten die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten einen reichsweiten Pogrom – noch heute oft verharmlosend "Kristallnacht" genannt – gegen Jüdinnen und Juden. Aus staatlich-administrativer Diskriminierung wurde jetzt brachiale Gewalt. Synagogen, Geschäfte und Wohnhäuser wurden zerstört und ausgeplündert, unzählige Menschen erniedrigt, misshandelt und vergewaltigt. Mindestens 91 Menschen starben. Um den Emigrationsdruck auf die deutschen Jüdinnen und Juden weiter zu erhöhen, wies man im Anschluss 25.000 Männer vorübergehend in Konzentrationslager ein, jüdische Organisationen, Zeitungen und der Schulbesuch jüdischer Kinder in öffentlichen Schulen wurden verboten. (8)
Aufgrund privatpolitischer Initiativen kam es nach dem Pogrom zu einer vorübergehenden Lockerung der britischen Einreisebestimmungen für jüdische Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre aus Deutschland. Mit den sogenannten Kindertransporten, finanziert unter anderem von den jüdischen Gemeinden Großbritanniens, kamen etwa 10.000 Kinder bis Kriegsbeginn in britische Pflegefamilien und Kinderheime. Die deutschen Behörden quälten die Menschen mit grausamen Ausreisebestimmungen. So durften die Kinder nur wenige persönliche Dinge mitnehmen, Spielsachen und Bücher waren verboten, Fotografien begrenzt. Die Eltern wussten nicht, wohin sie ihre Kinder gaben und ob sie sie je wiedersehen würden. Die kleinen und jungen Menschen verloren ihre Familie, ihr Zuhause, ihre Sprache und waren mit der neuen Situation in der Fremde völlig allein. Die Familien konnten den Kontakt nach Kriegsbeginn 1939 nicht halten, und so erfuhren sie erst nach 1945, ob die Eltern und Kinder überlebt hatten. (9)
1937/38 erweiterte das NS-Regime die Funktion der Konzentrationslager. Inzwischen reorganisiert und unter der Herrschaft der SS stehend, wurden sie jetzt auch ein Instrument der NS-Rassenhygiene. Neben politischen Gegnerinnen und Gegnern inhaftierte man nun immer mehr Menschen, die aus rassenhygienischen Gründen verfolgt wurden: angebliche "Berufs-, Sittlichkeits- und Gewohnheitsverbrecher" sowie "asoziale Elemente" – als asozial galt, wer sich nicht in die nationalsozialistische "Volksgemeinschaft" einfügte. Einen Höhepunkt dieser Verfolgungen bildete die Aktion "Arbeitsscheu Reich" im Jahr 1938. In Razzien wurden über 10.000 Menschen verhaftet, die nicht sesshaft waren, keiner geregelten Lohnarbeit nachgingen, in Obdachlosen- und Fürsorgeheimen lebten. (10)
Eine Opposition gegen die Politik und den absoluten Herrschaftsanspruch der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten kam nicht nur von ihren politischen Gegnerinnen und Gegnern. Widerstand entstand auch da, wo moralische und religiöse Werte angegriffen wurden. Neben all den Männern und Frauen, die als Gläubige in ihrem Alltag widerstanden, bildeten die Zeugen Jehovas eine besondere Gruppe, die sich konsequent der Gleichschaltung verweigerte. Ihre Mitglieder lehnten die Ideologie des Nationalsozialismus ab, traten keinen NS-Organisationen bei, verweigerten den Wehrdienst. Die Zeugen Jehovas wurden deshalb verboten, mit mehreren Verhaftungswellen massiv verfolgt und Kinder in "arische" Pflegefamilien oder Erziehungsheime verschleppt. Von den 25.000 Zeugen Jehovas wurden etwa 10.000 inhaftiert. Mindestens 1.200 Menschen starben in Konzentrationslagern, dort stigmatisiert mit einer eigenen Kennzeichnung, dem lila Winkel. Sie waren von der SS besonders gehasst, da sie auch in den Lagern standhaft an ihren religiösen Überzeugungen festhielten. (11)
Sinti und Roma brandmarkte das NS-Regime gleichermaßen als "fremdrassig" und "asozial volksschädigend". Anknüpfend an die Diskriminierungen in Deutschland vor 1933, begannen kommunale Behörden bald, Sinti und Roma gezielt zu vertreiben. So wurden Stellplätze der Wohnwagen zerstört, Mieten erhöht und die Menschen verstärkt kontrolliert. Man errichtete bewachte "Zigeunerlager", erteilte Berufsverbote und zwang die Menschen in Lohnarbeit. Ab 1937 wurden Sinti und Roma in einer Kartei erfasst und nach NS-Rassenkriterien definiert. Als das NS-Regime 1938 begann, "Asoziale" mit Disziplinierung und Strafe zu verfolgen, zählten viele Männer und Frauen der Sinti und Roma zu den Opfern. Nach Kriegsbeginn 1939 durften sie ihren Wohnort unter Androhung der Konzentrationslagerhaft nicht mehr verlassen. 1940 deportierte die SS erstmals deutsche Sinti und Roma in Gettos und Konzentrationslager im Osten, wo sie unter schlimmsten Lebensbedingungen Zwangsarbeit leisten mussten. Am 16. Dezember 1942 ordnete Himmler mit dem sogenannten Auschwitzerlass die Deportation der europäischen Sinti und Roma in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz an. Mindestens 20.000 Männer, Frauen und Kinder wurden hier ermordet. In ganz Europa sind etwa 500.000 Menschen dem Massenmord an den Sinti und Roma zum Opfer gefallen. (12)
Unzählige Menschen wurden damals aus ihrer Heimat vertrieben. Sie flüchteten, sofern sie die finanziellen Möglichkeiten hatten und Länder fanden, die sie aufnehmen wollten. Weltweit verschärften immer mehr Staaten ihre Einreisebestimmungen, um den Zustrom abzuwehren. Die Flüchtenden mussten ihr Zuhause, Familienangehörige, Freunde und Freundinnen, ihre Arbeit und ihren Besitz zurücklassen oder wurden ihres Besitzes beraubt – Juden und Jüdinnen durften bei ihrer offiziellen Emigration nur eine geringe Summe mitnehmen. Nicht selten lebten die Menschen im Ausland unter schwierigen Bedingungen und konnten dort nicht an ihr berufliches Leben anknüpfen. Viele holte die Verfolgung wieder ein, als der Zweite Weltkrieg begann, da Regierungen häufig geflüchtete Deutsche zu Kriegsbeginn in Lagern internierten und die Menschen so ihren Verfolgern und Verfolgerinnen nicht mehr entkommen konnten.
Wer nicht flüchten konnte, versuchte sich zurückzuziehen oder ging in den Untergrund und lebte versteckt. Tauchten Menschen zu Beginn der NS-Herrschaft unter, um von dort aus weiter gegen die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten zu arbeiten, taten sie es bald, um der rassistischen Verfolgung zu entgehen und ihr Leben zu retten. Dabei waren sie völlig auf die Unterstützung anderer angewiesen und abhängig von deren Verschwiegenheit. Ihre Existenz war geprägt von der ständigen Angst, entdeckt oder verraten zu werden. Ohne festes Zuhause lebten sie mit einer fremden Identität unter fremden Menschen, nie wissend, wann sie diesen Unterschlupf verlassen mussten, weil er unsicher geworden war, und ob sie in ein neues illegales Quartier vermittelt werden würden. (13)
Besonders furchtbar ist in dieser Verfolgtengruppe das Erleben der versteckten Kinder. So waren insbesondere jüdische Eltern – nach Kriegsbeginn in ganz Europa – gezwungen (sofern sie überhaupt die Möglichkeit hierzu hatten), ihre Söhne und Töchter in die Obhut fremder Familien und (vielfach kirchlicher) Institutionen zu geben, um damit das Leben ihrer Kinder zu retten. Dabei wussten sie nie, ob ihre Kinder dort geborgen und sicher sein würden. Nur sehr selten konnten die Familien anschließend miteinander in Kontakt bleiben oder überhaupt eine Nachricht voneinander bekommen. Die Kinder verloren ihre Eltern, ihr Zuhause, ihre Identität und Wurzeln. Ausgestattet mit einem neuen Namen und einer neuen Religion, waren sie den sie aufnehmenden Menschen schutzlos überlassen. Auch nach dem Krieg hörte ihr Leid nicht auf. Wenn sie überhaupt wussten, dass sie unter falscher Identität gelebt hatten – gerade damals sehr kleine Kinder können sich an ihr "erstes Leben" nicht bewusst erinnern –, war es vielen nicht möglich, ihre Eltern wiederzufinden bzw. den Leidensweg der Eltern und ihre eigene Identität nachzuzeichnen. (14)
Der Zweite Weltkrieg: Massenmord und Zwangsarbeit
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 setzte eine Radikalisierung der Verfolgung ein. Eine völlige Entgrenzung der Gewalt durch die Brutalisierung des sich ausweitenden verbrecherischen Krieges (…) setzte ein, die im Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden, an den Sinti und Roma, an Kranken und Behinderten mündete und Millionen Menschen – Zivilistinnen, Zivilisten und Kriegsgefangene – das Leben kostete, die in Gefangenschaft an Hunger und Krankheiten starben und massakriert wurden, weil sie als "minderwertig" und "weltanschauliche Feinde" galten.
Einen Monat nach dem Überfall auf Polen erließ Hitler den sogenannten Euthanasiebefehl, mit dem die systematische Tötung der als "lebensunwert" eingestuften Menschen in Deutschland begann. Ärztinnen und Ärzte der "Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten" erfassten und wählten die Opfer aus. In Grafeneck tötete das Personal Ende 1939 die ersten Menschen. Weitere Euthanasieanstalten entstanden in Hadamar, Brandenburg an der Havel, Bernburg, Schloss Hartheim und in Sonnenstein. Nach Protesten aus der deutschen Gesellschaft wurden Tötungen ab 1941 im Geheimen durchgeführt und später auf kranke, arbeitsunfähige und "rassisch minderwertige" Häftlinge in den Konzentrationslagern ausgedehnt. Bis 1945 fielen mindestens 300.000 Menschen der Euthanasie durch Vergasung, Erschießung, tödliche Injektionen sowie Hunger und systematischer Erschöpfung zum Opfer. (15)
Immer mehr Staaten gerieten mit Beginn des Krieges unter die Herrschaft der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen. Länder wurden besetzt oder auch als befreundete "Satellitenstaaten" mittels gleichgesinnt Regierender kontrolliert, die ihrerseits Oppositionelle verfolgten und rassistische Gesetze erließen.
In Polen setzten nach dem Überfall sofort Verfolgungsmaßnahmen ein. Es kam zu Exzessen an der polnischen Bevölkerung. Menschen wurden auf offener Straße gequält und ermordet, Politikerinnen und Politiker, Geistliche, Lehrende, Ärztinnen und Ärzte, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter – die Führungsschicht des Landes – in Konzentrationslager verschleppt. (16) Das Land wurde zerschlagen, Teile von Deutschland und der Sowjetunion annektiert und auf dem Restgebiet das sogenannte Generalgouvernement errichtet. Polen wurde in der Folge zu einem "Experimentierfeld" der deutschen Rassenpolitik, hier erreichte diese in den nächsten Monaten einen ersten mörderischen Höhepunkt, bevor das NS-Regime sie mit dem Krieg auf andere Länder ausweitete. Die polnische Bevölkerung wurde aus den "eingedeutschen" westlichen Gebieten in das „Generalgouvernement“ deportiert und zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Juden und Jüdinnen pferchte die SS unter katastrophalen Lebensbedingungen in Gettos zusammen, so etwa in Warschau, Lodz und Lublin. (17) Zehntausende Männer, Frauen und Kinder starben hier an Hunger und Krankheiten, während sie Zwangsarbeit für die Deutschen leisten mussten.
Mit dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde im Osten ein Krieg fortgesetzt, der von Beginn an als Rassen- und Vernichtungskrieg, als Kampf um "Lebensraum" geführt wurde. Einsatztruppen der SS und der Polizei folgten der vordringenden Wehrmacht und ermordeten unter anderem in Litauen, Estland, der Ukraine, in Rumänien und in der Sowjetunion systematisch Jüdinnen, Juden, Sinti und Roma sowie "kommunistische Funktionäre, Partisanen und Saboteure". Zehntausende Männer, Frauen und Kinder wurden bei diesen Massakern in Wäldern oder auf freiem Feld erschossen, erschlagen, verbrannt und in unzähligen Massengräbern verscharrt. Ende des Jahres hatten die Deutschen fast eine halbe Millionen Menschen ermordet. (18) Auch die Wehrmacht und inländische Helfer und Helferinnen beteiligten sich an diesen Morden. Gleichzeitig wurden auch hier wie in Polen Jüdinnen, Juden, Sinti und Roma in Gettos und Arbeitslager zusammengepfercht. (19) Diese Lager wurden danach immer wieder systematisch durchkämmt und weitere Erschießungen durchgeführt. Menschen versuchten ihr Leben zu retten, indem sie untertauchten. Sie lebten dann versteckt in Städten und Wäldern unter elenden Bedingungen, ständig in der Angst, entdeckt und verraten zu werden.
Hinter dieser Front wurden im besetzten Polen zu diesem Zeitpunkt die Vernichtungslager errichtet. Anfangs in Gaswagen, dann in den allein für die Ermordung errichteten Lagern Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka und in dem Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek tötete die SS ab Dezember 1941 die in die Gettos gezwungenen Jüdinnen und Juden. Allein in Treblinka ermordete die SS 750.000 Menschen. Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz wurde später das Zentrum der Vernichtung. Nachdem Himmler im Sommer 1942 den Ausbau befohlen hatte, tötete die SS hier in vier Gaskammern und den ihnen angeschlossenen Krematorien Jüdinnen, Juden, Sinti und Roma aus ganz Europa. Nach tagelangen quälenden Transporten ohne jegliche Versorgung wurden die Menschen nach ihrer Ankunft von der SS für Arbeitseinsätze und medizinische Versuche selektiert oder aber sofort vergast und verbrannt. (20)
Ab Winter 1941 setzte auch die systematische Deportation der deutschen und westeuropäischen Jüdinnen und Juden in die unzähligen Gettos sowie in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten ein, in denen sie massakriert, erschossen und vergast wurden. (21) Über sechs Millionen Menschen fielen insgesamt diesem Massenmord zum Opfer: Männer, Frauen und Kinder aus Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Lettland, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und Ungarn.
Deutschland beutete die im Kriegsverlauf besetzten Länder Ost- und Westeuropas gezielt für die eigenen Bedarfe aus. Millionen Menschen wurden zur Arbeit in der Kriegswirtschaft gezwungen. Ohne diese Ausbeutung wäre die deutsche Rüstungsproduktion zusammengebrochen. Ab 1939/40 leisteten so Kriegsgefangene sowie Fremd- und Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft Zwangsarbeit: im Bergbau und der (Rüstungs-)Industrie, in der Land- und Forstwirtschaft, den Kommunalbetrieben, der Verwaltung, im Handwerk und in Privathaushalten. Nahezu jeder große und kleine Betrieb beschäftigte bei Kriegsende ausländische Arbeitskräfte. Allein in Berlin gab es 1945 über 4.000 Zwangsarbeiterlager. Die Männer und Frauen, Kinder und Jugendlichen kamen aus vielen Ländern West- und Osteuropas. Sie waren entweder unter falschen Voraussetzungen als Fremdarbeiterinnen und –arbeiter angeworben oder aber verschleppt worden. Untergebracht in Zwangsarbeiterlagern – bewachten Barackenlagern – oder bei Privatpersonen, richtete sich ihre Lebens- und Arbeitssituation nicht nur nach ihrem Arbeitsort, sondern auch nach ihrer Stellung innerhalb der NS-Rassenhierarchie: Die als Ostarbeiterinnen und –arbeiter gekennzeichneten Menschen aus Polen, der Ukraine, Weißrussland, Russland etc. litten an Mangelversorgung und unterlagen einem härteren Straf- und Arbeitssystem als die sogenannten Westarbeiterinnen und –arbeiter aus beispielsweise Frankreich, Belgien oder den Niederlanden. Die Kontakte zwischen den Fremdarbeiterinnen bzw. –arbeitern und der deutschen Bevölkerung regelten detaillierte Erlasse, dabei wurden sexuelle Beziehungen vor dem Hintergrund der NS-Rassenhygiene mit Hinrichtung oder Einweisung in Konzentrationslager bestraft. (22) Bummelei und Sabotage, Arbeitsniederlegungen sowie unerlaubter Umgang mit Deutschen in den Betrieben wurden mit Arbeitserziehungslager geahndet. Die Einweisung der Menschen erfolgte ohne Gerichtsverfahren, die Haftdauer war unbestimmt. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen entsprachen denen der Konzentrationslager. (23)
Besondere Grausamkeit und Leid erlebten schwangere Osteuropäerinnen und ihre Kinder. Wurden die Frauen anfangs noch in ihre Heimatländer zurückgeschickt, ging das NS-Regime bald dazu über, Zwangsabtreibungen durchführen zu lassen. Die Neugeboren wurden ihren Müttern weggenommen und in sogenannten "Ausländerkinder-Pflegestätten" untergebracht, in denen man die Kinder an Unterversorgung sterben ließ. Nicht genug damit, dienten manche der Frauen in den Kliniken auch als Versuchsobjekte für die medizinische Ausbildung und gynäkologische Forschungen.
Die letzten Monate und Wochen des Krieges waren gekennzeichnet von einer unglaublichen Brutalität, Wut und Willkür, der noch zahllose Häftlinge, Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen kurz vor der nahenden Befreiung zum Opfer fielen. So räumte die SS die Konzentrationslager vor den heranrückenden Fronten. SS-Männer und Aufseherinnen trieben die völlig ausgezehrten und kranken Menschen in tagelangen Transporten und Märschen meist ohne jede Versorgung in Richtung Westen, von einem Lager zum anderen, oft genug auch ziellos, um dann selbst zu flüchten. Viele Häftlinge starben entkräftet auf diesen Todesmärschen oder wurden erschossen, wenn sie nicht mehr weiterkonnten. (24) Die Angst vor der Kapitulation führte auch zu immer größeren Aggressionen gegen Zwangsarbeiterinnen und -arbeiter. Die Gefahr, unmittelbar vor der Befreiung noch wegen Arbeitsvertragsbrüchen, Plünderungen, Sabotage und anderen Verdächtigungen von der Gestapo hingerichtet zu werden, war groß. (25)
Die NS-Militärjustiz ahndete bis zum Schluss die Verweigerung und Desertion aus diesem Krieg mit unnachgiebiger und grausamer Härte. Vor Militärgerichten wurden tausende Soldaten wegen Fahnenflucht, Wehrkraftzersetzung, Kriegsverrat und anderer Delikte zum Tode verurteilt, 25.000 dieser Urteile wurden vollstreckt. Alles konnte das Leben kosten: das Abhängen eines Hitlerbildes, kurzfristiges Verlassen der Einheit, Hilfe für Verfolgte oder "Kooperation mit dem Feind". Die Wehrmacht verfügte über ein komplexes Strafsystem und diverse Strafinstitutionen. So gab es etwa bewegliche Heeresgefängnisse an der Front, Feldstraflager und Bewährungseinheiten. In den letzten Monaten und Wochen des Krieges operierten die Militärjuristen und –juristinnen sogar als "fliegende Standgerichte des Führers", ließen selbst Jugendliche und alte Männer inhaftieren, erschießen und als "Feiglinge" aufhängen. (26)
Exkurs: Haftbedingungen in den Konzentrationslagern
In Deutschland und in den besetzten Ländern entstanden nach Kriegsbeginn immer mehr und immer neue Formen der Haft- und Straflager, sodass eine Aufzählung hier unmöglich ist. Im Folgenden sollen aber wichtige Haftinstrumente, die die SS in den Konzentrationslagern einsetzte, beschrieben werden, um ein Verständnis für die seelischen und körperlichen Verletzungen Überlebender dieser Lager zu bekommen.
Die Menschen befanden sich in ständiger Lebensgefahr. Die Lebensbedingungen in den KZ waren dabei so organisiert, dass man die Menschen immer grundsätzlich in ihrer Würde und ihrem Menschsein angriff. Die SS versuchte, ihnen ihre Individualität zu nehmen und ihre Persönlichkeit zu zerstören. Zugleich setzte sie sie einem Prozess sozialer Vereinzelung aus. (27) Die folgende Erinnerung eines Überlebenden spiegelt eine der tiefen Verletzungen wider, die den Menschen in den KZ durch die SS zugefügt wurde. Noch heute empfindet er (auch) tiefes Entsetzen und Scham, wenn er an seine Lagerhaft denkt: Im Lager habe man immer einen Blechtopf dabei gehabt. Wenn man etwas Essbares gesehen habe, habe man versucht, es mitzunehmen und, wenn irgend möglich, auch verträglich zuzubereiten. Er habe neben Leichen Kartoffeln in seinem Blechnapf gekocht und gegessen. Das habe er gemacht, schrecklich sei das gewesen. (28)
Transport und Aufnahme in das Konzentrationslager
Schon die fehlende Versorgung und die Misshandlung der Menschen während des Transports in die Lager waren eine erste gezielte Einschüchterung und Verletzung. Mit einem Aufnahmeritual erfolgte dann die Eingliederung des einzelnen Menschen in die Masse der Häftlinge. Die Männer und Frauen mussten ihre persönlichen Dinge abgeben, sie wurden abgeduscht, untersucht – auch genital – und rasiert, erhielten Lagerkleidung und wurden als Nummer registriert. Die SS beabsichtigte in dieser ausgeklügelten Abfolge von Erniedrigung, Gewalt und Verstümmelung die Entindividualisierung und den Zusammenbruch der Integrität der Menschen.
Hierarchisierung der Häftlinge
Mit der Aufnahme in das Lager erfolgte auch die Zuordnung der Menschen zum Kategoriesystem der SS: "Rasse", Nationalität, politische Feindschaft, soziale Abweichung. Diese Zuordnung war neben der Häftlingsnummer an der Kleidung für alle in Form von verschiedenfarbigen Winkeln sichtbar. Mit ihr wurde die soziale Stellung der Menschen im Lager festgelegt und damit gleichzeitig der Zugang zu Ressourcen wie der Arbeitsort oder die Übernahme von Funktionen definiert (zum Beispiel als Kapo, der oder die als Häftling andere Häftlinge beaufsichtigte, kontrollierte und dafür Vergünstigungen erhielt). Je niedriger die Menschen in der Lagerhierarchie standen, desto schlechter waren ihre Überlebenschancen. Durch diesen Mechanismus der Differenzierung kam es zu Abständen, Gegensätzen und sozialen Grenzlinien zwischen den Häftlingen. Die SS versuchte so, die Menschen untereinander zu spalten und zu entsolidarisieren.
Mörderische Zwangsarbeit und elementare Mangelversorgung
Die Arbeit im Lager sicherte nicht das Leben, sondern ruinierte es. Die SS vernichtete die Menschen durch Arbeit. Sie wurden zu schwersten körperlichen Tätigkeiten gezwungen, zum Beispiel im Straßenbau, zu Erd- und Grubenarbeiten, zu schwersten Arbeiten in der Rüstungsindustrie. Die Arbeitszeiten waren sehr lang, zwischen zehn und 12 Stunden, und die Ernährung völlig unzureichend; die Menschen hungerten furchtbar. Begleitet von langen Appellen sowie weiten An- und Abmarschwegen führte dies schnell zur Erschöpfung. Da die Bekleidung der Menschen bewusst ungenügend war und ihnen eine wirksame hygienische und medizinische Versorgung vorenthalten wurde, erkrankten und starben sie an Infektionen, hervorgerufen etwa durch Kälte und kleinste Verletzungen, epidemisch weitergetragen durch Läuse und Flöhe. Diese grausamen Lebensbedingungen erschwerten auch das solidarische Handeln der Menschen untereinander und griffen so wiederum Humanität und Würde an.
Kontrolle und Strafe
Das Lager war ein System gnadenloser Kontrolle. Durch die Abriegelung von der Außenwelt und die innere Gliederung entstand ein Zwangsraum, in dem der oder die einzelne in eine Masse eingliedert war. Die Menschen wurden in kompakten Einheiten (zum Beispiel Appell, Arbeitskommandos) überwacht und beherrscht. In den Baracken entstand durch Überfüllung eine Zwangsgemeinschaft, in der jede Individualität und jede Intimsphäre aufgehoben waren.
Das Lagerregime der SS war brutal und unberechenbar, das errichtete Strafsystem willkürlich, seine Anforderungen inhaltlich widersprüchlich und zeitlich nicht zu vereinbaren. Gehorsam schützte nicht vor Strafe. Die Lagerordnung war ein Terrorinstrument der SS mit dem Ziel, Strafsituationen zu schaffen. Der sadistischen Fantasie der SS-Männer und Aufseherinnen waren dabei keine Grenzen gesetzt: stundenlange Kollektiv- und Einzelappelle in Kälte und Hitze, Exerzieren, grauenvolle Schläge, Pfahlhängen, Einzelhaft, Stehbunker, Folter, Hinrichtung. Die Gewalt war keine Sanktion, sondern Selbstzweck. Die Menschen lebten in ständiger Todesangst.
Kriegsende und "Neubeginn": Kampf der NS-Verfolgten um Anerkennung und Gerechtigkeit
Bei Kriegsende befanden sich mehrere Millionen verschleppter Menschen auf deutschem Boden. Die westlichen Alliierten errichteten sogenannte Displaced-Persons-Camps (DP-Lager), um ihre Versorgung zu gewährleisten und sie von hier aus möglichst schnell in ihre Heimat zurückzubringen. Die DP-Lager entstanden nicht nur häufig in unmittelbarer Nähe der ehemaligen NS-Lager, sondern diese wurden auch direkt genutzt. Es gelang den Alliierten bis Herbst 1946, den Großteil der Menschen zurückzuführen. Sowjetische Staatsbürgerinnen und –bürger wurden entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Alliierten auch zwangsweise repatriiert. Dies geschah mit dem Wissen der westlichen Alliierten, dass die Rückkehrenden der Kollaboration verdächtigt wurden und von Repressionen, Umerziehungsmaßnahmen, Lagerhaft und schlimmstenfalls mit Hinrichtung bedroht waren. Deshalb versuchten Menschen aus allen Gebieten des sowjetischen Einflussbereichs, in Deutschland zu bleiben, sie widersetzten oder entzogen sich der Rückführung. Zurück blieben auch Jüdinnen und Juden, die nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren konnten, weil es diese nicht mehr gab und sie auf Auswanderungsmöglichkeiten nach Übersee und Palästina warteten. (29) Manche DP-Lager wandelten sich im Laufe der Jahre langsam in Wohnsiedlungen um, in denen manchmal noch heute ehemalige Zwangsarbeiterinnen und –arbeiter leben. Das letzte DP-Lager wurde 1959 geschlossen.
Mit Kriegsende setzte aber auch eine umgekehrte Bewegung ein: In die Emigration und zur Flucht gezwungene Deutsche kehrten in ihre Heimat zurück. Männer und Frauen, die sich am Aufbau eines neuen, besseren Deutschlands beteiligen wollten, aber auch Menschen, die sich nach ihrer Heimat sehnten und hofften, dort wieder zuhause sein zu können. (30) Besonders für Jüdinnen und Juden, die in ihre Heimat zurückkehrten, war dies kein leichter Weg. In ihrem Alltag mit Anti- und Philosemitismus konfrontiert, entstand bei manchen von ihnen auch ein Schuldgefühl, im Land der Täter und Täterinnen zu leben. (31) Deutschland hat sich weder um die Rückkehr der vertriebenen Menschen besonders bemüht noch sie offen aufgenommen. Weder in Ost- noch in Westdeutschland war man an einer Auseinandersetzung mit den Verbrechen oder an politischen Ideen interessiert, die die politischen und gesellschaftlichen Weichenstellungen und Entwicklungen in Frage stellten.
Zurück kam auch eine andere Gruppe: diejenigen Deutschen, die die Konzentrationslager und Gefängnisse überlebt hatten. Entkräftet, verletzt an Körper und Seele, trafen sie in ihren Städten und Dörfern ein. Vielfach schlug ihnen hier Ablehnung entgegen. So wollte man etwa Sinti und Roma oder Jüdinnen und Juden nicht in die Gemeinden aufnehmen, und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen versuchten, die Rückkehrenden weiterzuschicken. Die Überlebenden der mörderischen Verfolgung erlebten im Anschluss an ihre Befreiung oft Ausgrenzung und Gleichgültigkeit und mussten – sofern sie nicht auswanderten – unter diesen Bedingungen ihr Leben wieder aufbauen. (32)
Die deutsche Bevölkerung wollte nach dem Krieg in der großen Mehrheit vom Leid der überlebenden Menschen der Konzentrationslager, der Zwangsarbeit, der Flucht und Vertreibung nichts hören. Nicht nur Berichte und Gerüchte von gewalttätigen Ausschreitungen und Plünderungen beherrschten die Wahrnehmung, sondern die Überlebenden wurden ob ihrer angeblich privilegierten Stellung in der Obhut der Alliierten auch mit Neid betrachtet. Viele Deutsche sahen sich selbst als Opfer und nicht als Täterinnen und Täter: Opfer der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten, Opfer des Bombenkrieges, Opfer der Flucht und Vertreibungen, die 1944/45 in den ehemals besetzten Ländern Mittel-Osteuropas einsetzen. Hannah Arendt, deutsch-jüdische Philosophin und 1933 vertrieben, reiste 1951 nach Deutschland und beobachtete: "Doch nirgends wird dieser Alptraum von Zerstörung und Schrecken weniger verspürt und nirgendwo wird darüber weniger gesprochen als in Deutschland. Überall fällt einem auf, daß es keine Reaktion auf das Geschehene gibt, aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine irgendwie absichtliche Weigerung zu trauern oder um den Ausdruck einer echten Gefühlsunfähigkeit handelt. (...) Dieser allgemeine Gefühlsmangel, auf jeden Fall aber die offensichtliche Herzlosigkeit, die manchmal mit billiger Rührseligkeit kaschiert wird, ist jedoch nur das auffälligste äußerliche Symptom einer tief verwurzelten, hartnäckigen und gelegentlich brutalen Weigerung, sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen und sich damit abzufinden." (33)
Die Alliierten führten 1945/46 in Nürnberg einen Prozess gegen die NS-Führung, in dem sie deren Mitglieder als Hauptkriegsverbrecher anklagten und sie zu Todes-, lebenslangen und langjährigen Haftstrafen verurteilten. Es folgten zwölf weitere Prozesse gegen Eliten aus Wirtschaft, Verwaltungen und NS-Organisationen, die das Regime gestützt hatten. Die politische Säuberung der deutschen Gesellschaft durch Entnazifizierungsverfahren dagegen scheiterte. Die Mehrheit der Deutschen lehnten die Verfahren ab und stellte sich stattdessen gegenseitig "Persilscheine" aus. In den 50er-Jahren kam dann die Strafverfolgung von NS-Täterinnen und -Tätern praktisch gänzlich zum Erliegen. Diese fehlende politische und juristische Ahndung führte zu vielfachen (personellen) Kontinuitäten in Politik und Behörden, transportierte die NS-Ideologie in politische Entscheidungen und in den gesellschaftlichen Umgang mit den Verfolgten und ihren Familien. So erlebten beispielsweise Sinti und Roma in Westdeutschland eine Fortsetzung der Diskriminierung, indem unter anderem ihre polizeiliche Überwachung und Erfassung weitergeführt wurde und westdeutsche Juristinnen und Juristen bis 1965 deutsche Sinti und Roma nicht als NS-Verfolgte nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG) anerkannten und sie damit in weiten Teilen von der Entschädigung ausschlossen. Und erst 1982 anerkannte man hierzulande den Massenmord an den Sinti und Roma als Völkermord. (34)
Bis in die 80er-Jahre hinein verhinderten fehlendes Unrechtsbewusstsein, Abwehr von Schuld und Verantwortung in der Bundesrepublik eine tiefer gehende und breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Verfolgung, die heute auf den ersten Blick so selbstverständlich erscheint. Der Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961, der Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963-65 (35), die US-amerikanische TV-Serie "Holocaust" 1978 waren wichtige Ereignisse, die eine Auseinandersetzung langsam vorantrieben. Ebenso gelang es den Deutschen in der DDR, mit ihrer antifaschistischen Gründungserzählung eine gesellschaftliche Auseinandersetzung und juristische Aufarbeitung mit dem Nationalsozialismus zu umgehen. Die Verantwortlichkeiten wurden in die kapitalistische Bundesrepublik verschoben: Die DDR war der neue, bessere deutsche Staat der kommunistischen Widerstandskämpferinnen und -kämpfer, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft hatten. (36)
Auch die Entschädigung der NS-Verfolgten war in beiden deutschen Staaten nicht selbstverständlich. Sie musste erkämpft und erzwungen werden, und bis heute gibt es Gruppen Verfolgter, die keine Entschädigung erhalten haben. Immer bestimmten die Ideologien und die wirtschaftliche Situation die Definition der Entschädigungsgesetze, in denen man bewusst viele Menschen von Zahlungen ausschloss. Dazu kamen in der damaligen Bundesrepublik komplizierte Antragstellungen und kurze Antragsfristen. Der Ausschluss gleicher Opfergruppen zeigt, dass Urteile und Werte der NS-Ideologie (natürlich) in beiden deutschen Staaten weiterwirkten. Auch schlossen beide Staaten in vielen Fällen die Entschädigung der ausländischen Verfolgten aus. In der DDR hat es, anders als in der Bundesrepublik, keine Entschädigung der im Ausland lebenden Jüdinnen und Juden gegeben. (37) In den westdeutschen Entschädigungsverfahren, insbesondere in Bezug auf das Gesundheitsschadensrecht des Bundesentschädigungsgesetzes, mussten viele NS-Verfolgte erleben, dass Ärztinnen, Ärzte, Richter und Richterinnen den Zusammenhang zwischen ihren Erkrankungen und der erlittenen Verfolgung hartnäckig und bar jeder Menschlichkeit leugneten und damit eine Entschädigung verhinderten.
Vorerst letzter Erfolg in diesem Kampf um Anerkennung war 1999 der Beginn der Entschädigungszahlung unter anderem an ehemalige Zwangsarbeiterinnen und –arbeiter und Opfer der Arisierungen aus den Geldern der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", die aus Mitteln deutscher Unternehmen, des Bundes und der Länder finanziert wird und nur auf gesellschaftspolitischen Druck hin gegründet wurde. (38)
Die Überlebenden der Verfolgung haben nach 1945 in beiden deutschen Staaten immer wieder Zurückweisung, Diskriminierung und Missachtung erfahren. Die Lebensgeschichten der NS-Verfolgten wurden mehrheitlich lange tabuisiert und beschwiegen. Heute dagegen kennen wir NS-Verfolgte: an Gedenktagen, bei Ausstellungseröffnungen und in Jugendprojekten berichten sie als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von ihren Erfahrungen. Sie übernehmen im kollektiven Gedächtnis Deutschlands inzwischen eine zentrale Rolle in der Erinnerungskultur an die Verfolgung während des Nationalsozialismus. Das Gleiche gilt für die Präventionsarbeit gegen Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus. Dennoch warten Männer und Frauen verschiedener Verfolgtengruppen – und ihre Kinder – wie die Sinti und Roma, die Homosexuellen, "Asoziale", die Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten, die Zeugen Jehovas und die Opfer der nationalsozialistischen Militärjustiz noch heute auf ihre gesellschaftliche und/oder rechtliche Anerkennung.
NS-Verfolgte im Alter: Anmerkung zu den Erzählungen
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
(Christina Hilgendorff)
Anmerkung zu den Erzählungen
Die folgenden Texte sind aus Interviews entstanden, die ich 2006 und 2007 geführt habe. Begleitet von Vorbereitungsgesprächen, dauerten diese Interviews zwischen zwei und zwölf Stunden. Manchmal fanden mehrere Treffen statt. Immer gab es im Anschluss an das Interview weitere Gespräche ohne Mikrofon, am Telefon oder auch zuhause. Aus all diesem Material setzen sich die entstandenen Erzählungen zusammen. Auf Wunsch und in Absprache mit den Erzählenden sind die Texte anonymisiert worden. Zwei der Interviewpartnerinnen bzw. –partner stimmten einer Veröffentlichung nicht zu. Ängste, aber auch die wiederkehrende Intensität und Nähe der Erinnerung durch die Veröffentlichung waren groß und belasteten beide zu sehr.
Wenn wir Menschen über unser Leben erzählen, dann konstruieren wir aus all unseren Erfahrungen in diesem Moment eine Geschichte über uns. Unsere Erinnerung ist in Bewegung und erfährt immer wieder Änderungen in ihren inhaltlichen und zeitlichen Bezügen, in Sinn und Kontinuität von Erfahrungen. Deshalb sagen Erinnerungen nicht nur etwas darüber aus, wie Dinge gewesen sind, sondern vielmehr etwas darüber, wie Lebenserfahrungen und Themen heute wahrgenommen werden. Gerade das macht die Erzählungen der Verfolgten für die Pflegenden so wertvoll. Wenn man zuhört, kann man Wesentliches erfahren über den gewählten Umgang mit der schmerzhaften Vergangenheit und über die Bedürfnisse und Unterstützung, die Verfolgte sich vor diesem Hintergrund wünschen und brauchen. Die alten Frauen und Männer haben mich in den Gesprächen sehr berührt und beeindruckt. Ihre Geschichten sind geschrieben mit der Idee, dass durch die Auseinandersetzung mit ihnen ein respektvoller Umgang, der die Grenzen des alten Menschen wahrt, gestärkt wird.
Transkribierte (übertragene) Interviews sind nicht leicht zu lesen, und so habe ich zur besseren Lesbarkeit in den Zitaten Sätze umgestellt, Wiederholungen gestrichen und Gedankengänge zusammengeführt, die im Gespräch auseinanderflossen. Dabei habe ich versucht, den Charakter des jeweiligen Interviews zu wahren.
NS-Verfolgte im Alter: Begegnung mit Karl D.
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
"Du musst dich wehren, du musst dein Leben verteidigen" – Begegnung mit Karl D.
(Christina Hilgendorff)
"(...) Ich weiß wohl, dass ich keine menschliche Zuwendung erwarten kann, sondern nur notwendigste Pflege, die ich ja nun reichlich genossen habe und weiß, was das heißt. Und da ist natürlich der Willkür Tür und Tor geöffnet. Ich weiß von Bekannten, eine gute Bekannte in L., die einen über 90-jährigen Vater hatte, der fast bis zum letzten Jahr fit war, geistig sowieso, aber auch körperlich. Aber im letzten Jahr brauchte der Pflege und da hatte sie einen Pflegedienst, und sie passte da sehr drauf auf, sagte: 'Da kann etwas nicht stimmen, das hat der Pflegedienst nicht gemacht, er hat ihn nicht trocken gelegt.' Und da war es nachher so, dass sie das auch nicht durch die Aussagen ihres Vaters kontrollieren konnte. War der da? Hat der dies oder jenes gemacht? Und sie hat viermal die Pflegedienste gewechselt.
Einmal kam da jemand, ich selber habe ihn auch gesehen, kannst du dir das vorstellen, einer mit ’ner Glatze und total tätowiert, in Lederhose usw. Muss ja nicht, kann aber sein, dass hier jemand, der überhaupt nicht qualifiziert dafür ist, dann solch eine Aufgabe wahrnimmt bzw. nicht wahrnehmen kann. Und das wäre natürlich ideal, wenn man in solch einem Falle, wo man hilflos und pflegebedürftig ist, solch einen Kontrolleur dort an der Seite hätte. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das hab' ich leidvoll erfahren. Das blüht dir, wenn du hilflos bist, auch wieder in deinem Alter. Hilflos kommt der Mensch zur Welt, hilflos geht er aus der Welt, und wenn man nicht das Glück hat, schön friedlich einzuschlafen. (...)." (39)
Die Situation erscheint aussichtslos, und die Befürchtungen scheinen unumstößlich: Inhumane und inkompetente Pflege erwarte ihn. Karl D. ist ganz ruhig, wenn er diese Einschätzung formuliert, und sie basiert auf einem grausamen Hintergrund. Karl D. ist als Kind in den 30er- und 40er-Jahren erst in einem Waisenhaus und später in einer psychiatrischen Anstalt groß geworden. Fern von jeder familiären Geborgenheit hat er dort eine gezielte und systematische Mangelversorgung in allen menschlichen Bedarfen erlebt, verbunden mit schwerer Arbeit, Terror und Misshandlungen. Man-made-desaster: "Erzähl mir was von den Menschen, mir kann keiner was von den Menschen erzählen."
Karl D. wird 1934 geboren. Seine Familie lebt damals auf dem Land, und als der Vater gewahr wird, dass Karl D. nicht sein leibliches Kind ist, reagiert er mit Gewalt. Die Mutter ist verzweifelt und versucht schließlich, sich mit ihren Kindern das Leben zu nehmen. Die Selbsttötung misslingt, sie wird in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Die Kinder – Karl D. ist damals ein Jahr alt – werden auf katholische Waisenhäuser verteilt. Für Karl D. beginnt damit eine lange Leidensgeschichte. Nonnen führen das Waisenhaus, und Karl D. erzählt von Unterwerfung und Zerstörung kindlicher Lebenslust und -entfaltung im Namen der Kirche: Schläge, Hunger, Schweigen, Frieren. Als er dann in die Schule kommt, wird ein Lehrer auf ihn aufmerksam. Der Mann ist Verfechter des "rassenhygienischen" Programms, mit dem die Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten den "arischen Volkskörper" von "Minderwertigen" befreien wollen. Er meldet das Kind aufgrund seiner Familiengeschichte den Behörden mit dem Hinweis auf "erblichen Schwachsinn". Karl D. gerät in das tötungswillige "Räderwerk" der NS-Rassenhygiene: 1939 erließ Hitler den sogenannten Euthanasiebefehl, mit dem die systematische Tötung derjenigen begann, die nach den Kriterien der Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten als lebensunwert eingestuft wurden. Zwei Jahre später führten Proteste aus der Gesellschaft zur formalen Einstellung der Tötungen, die daraufhin im Geheimen fortgesetzt wurden. Bis 1945 fielen etwa 300.000 Menschen der Euthanasie durch Vergasung, Erschießung, tödliche Injektionen sowie durch Hunger und systematische Erschöpfung zum Opfer. (40)
Ein Mediziner stellt bei Karl D. die unter den Rassenmedizinerinnen und –medizinern beliebte Diagnose "Debilitis und Psychopathie" – ein Befund, der in der Wissenschaft nicht beschrieben ist –, und Karl D. wird in die Kinderfachabteilung einer psychiatrischen Anstalt gebracht. Hier entscheiden Ärzte und Ärztinnen, ob "erbkranke" Kinder getötet oder in andere Heilanstalten verlegt werden. Karl D. ist damals neun Jahre alt:
"(...) Mein Schullehrer war Rektor der Schule, war spezialisiert auf Rassenhygiene, wie das meist die Volksschullehrer waren. Er hat dann durch die Nonnen über die tragische Geschichte meiner Geburt erfahren und hat dann gleich einen Antrag, einen Euthanasieantrag gestellt. Und Herr Dr. W. hat den Antrag genehmigt, ich sei geisteskrank und müsse in eine Anstalt eingewiesen werden. Das war April 1943, und das hieß dann mehr oder weniger, dass ich lebensunwert war, dass ich euthanatisiert werden sollte. Kam dann in die Kinderfachabteilung im Mai, 9. Mai 1943, und wurde dort per Lumbalpunktion untersucht. Das war die einzige Untersuchung, die sie gemacht haben, außer noch einen Intelligenztest einer Psychologin – das gab es dazumal noch, auch in der Kinderfachabteilung in K. –, und die stellte dann da fest, dass ich absolut nicht hilfsschulbedürftig sei, ein normal aufgewecktes Kind. Änderte aber nichts an der Diagnose des Herrn Professor, nicht Professor, Doktor W. Ich kam dann im September 1943 in die Idiotenanstalt L., der spezielle Name "Anstalt für Geisteskranke und geistes-schwache Kinder“, und dort bin ich bis September 1953 geblieben. (...)"
Karl D. überlebt, schwer verletzt an Körper und Seele. Bis heute ist nicht sicher feststellbar, wie viele Kinder in dieser von der katholischen Kirche geführten Anstalt gestorben sind. Als Deutschland im Mai 1945 kapituliert, ist für Karl D. das Leiden aber noch nicht beendet. Die NS-Psychiatrie ist kein Thema in der Nachkriegsgesellschaft, die wenigen Prozesse gegen Mediziner, Medizinerinnen und Pflegepersonal enden oft mit Freisprüchen.
"(...) Ich habe keine Schule besuchen können, d. h. die Verwahrschule der geistes-schwachen und schwachsinnigen Kinder, die nicht von Lehrern geleitet wurden, sondern von unausgebildeten Nonnen des Ordens. Das ist ein Faktum, mit dem sich die Größen des Landeshauses heute noch beschäftigen und da etwas unternehmen wollen, wie so etwas möglich war. Eben weil es noch bis in die 70er-Jahre der Fall war, dass für über tausend Kinder nicht ein Schullehrer bzw. Lehrerin dort war, das ist der Skandal. (...) Ja, um es kurz zu machen, ich bin da auf dem Bildungsstand eines achtjährigen Kindes stehen geblieben. Ich konnte lesen und schreiben, wie ich nach L. kam, und von daher hatte ich Glück, sonst hätte ich das wahrscheinlich auf dieser Idiotenschule nicht gelernt (...).
Natürlich mussten wir Kinder schwerstens dort arbeiten, das war das Programm, nicht nur Ora, sondern auch Labora. Und das Labora ging natürlich einträchtig mit dem Naziprogramm einher, das war kein Widerspruch. Wir triebhafte Wesen müssen rund um die Uhr so beschäftigt werden, damit wir absolut nicht zum Denken kommen. Wenn wir denken, denken wir nur Abscheuliches, eben Sexualität. Das war so die monströse Projektion, nicht nur der Pfaffen, ob katholisch oder evangelisch. Ich kenne die Literatur, ich weiß, wo meine Zeugen stehen, -zigtausende in der Bibliothek, kilometerlang stehen sie dort, und es ist nicht L. allein.
Und um es kurz zu machen, wie schrecklich die Zustände in dieser Anstalt waren, ein Krankenpfleger aus K., bei einer Gedenkveranstaltung in den 90er-Jahren erzählte er den Presseleuten, die da zahlreich erschienen waren – Anlass war die Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus dieser Anstalt, der euthanasie-ermordeten Kinder – der erzählte dann den Presseleuten, er war noch sehr emotional bewegt: 'Etwas ganz Schreckliches habe ich in den 50er-Jahren erlebt. Da kam ein Kindertransport aus L., die Kinder waren in einem solchen unmenschlichen Zustand, dass wir erschrocken und hilflos waren. Die waren so misshandelt und malträtiert, dass wenn wir den Tagesraum betraten, die zu zittern anfingen, sich in die Hose machten und sich unter dem Tisch versteckten. Wir waren hilflos. Was machen wir? Wir sind mit hoch erhobenen Armen in den Tagesraum gegangen, um ihnen zu zeigen, wir haben nicht irgendwelche Schlaginstrumente.' Er sagte, die Kinder hatten auch Narben auf den Köpfen, Narben, die genäht worden waren. Man sah es als Krankenpfleger, dass dort schwere Verletzungen waren. Oder aber einige hatten noch blaue Flecken usw., Blutergüsse. Und das Schändlichste, sagt er, sie kamen von Nonnen, aus L., dass Nonnen so pervers sind mit Kindern, so etwas anstellen. Was aber war die Reaktion der Pressevertreter? Sie waren verschwunden, das war nicht zu vermarkten. (...)
Um es kurz zu machen, das war noch nach meiner Zeit. Ich habe sehr großes Glück gehabt, dass ich aus dieser Schlangengrube relativ unbeschädigt, nein, das ist falsch, natürlich war ich schwerstens geschädigt. Ein 18-jähriger Mensch, der auf dem Bildungsstand eines achtjährigen Kindes stehen geblieben ist. Das war es ja nicht nur allein, ich war ja durch das Malträtieren, das tägliche, so schwerst geschädigt, das saß. Dass ich ein schwerst hospitalismusgeschädigter Mensch war, der Angst hatte, wenn er einem Fremden begegnete, der nicht geradeaus sehen konnte, sondern immer nur auf den Boden. Der Angst hatte, dass ihm etwas geschehen konnte, eben weil er unentwegt misshandelt worden war. Ohrfeigen waren das Gelindeste, der dicke Nussbaumknüppel usw. usf.
Das lief ja noch in den 60er-Jahren in ganz normalen Heimen und nicht in einer idiotischen Verwahranstalt und das ist das. Na ja, wie kam ich da heraus aus der Anstalt? Ich bin dann im September '53 als chronisch Kranker, d. h. als debiler Psychopath zur endgültigen Unterbringung nach O. in die Heil- und Pflegeanstalt V. gekommen. Da sollte ich dann die restlichen Tage meines Lebens verbringen. (...)"
Diese Verlegung ist eine Unterbringung auf Lebenszeit, ohne Aussicht, jemals ein freies Leben führen zu können. In V. ist er wie lebendig begraben. Aber in V. begegnet Karl D. auch einer völlig neuen, ihm fremden und wunderbaren Welt, die immer ein wichtiger Antrieb für seinen "Über-Lebenskampf" gegen den Ausschluss sein wird: Unter den Patientinnen und Patienten sind Künstler, Künstlerinnen, Akademikerinnen und Akademiker, die ihn an ihren Gesprächen teilhaben lassen. Karl D. fühlt sich wie ein Schwamm, saugt alles auf, Sprache, Gedanken, Gefühle. Einer dieser Männer setzt sich nachhaltig für ihn ein, schreibt für Karl D. Entlassungsgesuche an das Vormundschaftsgericht. Und tatsächlich erreicht er etwas: 1954 darf der 20-jährige Karl D. die Anstalt verlassen und wird als so genannter Familienpflegling auf einem Bauernhof als Knecht untergebracht. Wenn er heute daran denkt, spiegeln sich Fassungslosigkeit und Wut angesichts der Inhumanität und Gleichgültigkeit, mit der die Verantwortlichen auch in dieser Situation wieder mit ihm umgingen:
"(...) Ich hatte keine normale Sprache, ich sprach den Jargon, den ich von den Nonnen hatte. Und das alles sehr verhalten und furchtsam, man nannte mich immer den Jesus. Das war eine ganz abfällige Bemerkung, jemand, der Jesus, der musste nicht ganz dabei sein, der musste zurückgeblieben sein usw. Und das ist also das Problem. Einen lebenslänglich Hospitalisierten, den kann man ja doch nicht einfach vor die Anstaltsmauer jagen, und jetzt sieh mal zu, wie du fertig wirst. Es ist wie der Fisch auf trockenem Lande, der dann nach Luft schnappt, und der dabei in der Regel, wenn ihn keiner wieder in sein Element befördert, verreckt, nicht, und das war die Situation. (...)"
Auf dem Hof sammelt er wieder bittere Erfahrungen, wieder hungert er und muss schwerste Arbeiten übernehmen. Es gibt noch andere Hilfsarbeiter auf dem Hof, die ihm das Leben schwer machen, die Männer sind untereinander aggressiv. Aber es sind auch diese jungen Männer, die ihm ein zweites Tor zur Welt eröffnen, seinen Widerstandsgeist weiter herausfordern und damit Veränderungen anstoßen. Unter ihnen fängt er an, sich gegen andere zu wehren, zuerst gegen ihre Gewalt, dann gegen Ausbeutung:
"(...) Du musst dich wehren, du musst dein Leben verteidigen. Und so hab’ ich das dann im Laufe meines Lebens gelernt. (...) 'Bist du verrückt, umsonst zu arbeiten, du machst uns den Lohn kaputt, wenn du so wenig bekommst, dann brauchen wir ja auch nicht mehr, geh mal hin und fordere mal Geld.' Konnte ich nicht. Konnte ich nicht, aufgrund meiner Sozialisation: Alles meinem Gott zu Ehren, in der Arbeit, in der Ruh'. Unanständig ist es, für Arbeit Geld zu verlangen. Und das hatte ich so verinnerlicht. Und natürlich ist man ja auch zu einem billigen, d. h. einem Arbeiter, der einen nichts kostet, sehr nett und sehr lieb. Und das waren natürlich erhebliche Barrieren psychologischer Art, jetzt zu sagen, diesen netten Bauern da anzuhauen: 'Nun gib mal mehr.' (...) Ich hab' es dann doch eines Tages geschafft, erst zehn Mark im Monat, und nachher hab' ich sogar 100 Mark im Monat bekommen. Ja, das war natürlich sehr schlecht für meine Rente. Ein Ungebildeter, Hospitalismusgeschädigter, der muss die dreckigste, die schmutzigste, die schwerste und natürlich die schlechtest bezahlteste Arbeit ausführen. Das ist heute noch so, noch dazu, wenn da kein Kläger ist. (...)"
Drei Jahre schuftet Karl D. auf diesem Hof, bis er sich zum Auszug aus diesem Leben entschließt. Die Sehnsucht nach einem erfüllten und geborgenen Leben, nach Nähe und wirklichen Beziehungen zu Menschen, nach Bildung ist größer als alle Ängste und alle zerschlagenen Gefühle. 1957 bewilligt das Gericht endlich die Aufhebung der Vormundschaft, und Karl D. ist frei. Er ist 23 Jahre alt, und es fehlt ihm an vielem, was für junge Menschen ganz selbstverständlich ist: praktisches und intellektuelles Wissen über das Leben in unserer Gesellschaft. Aber es fehlt ihm nicht an Hoffnung und Mut. Karl D. arbeitet als Hilfsarbeiter und versucht, in Abendkursen vieles nachzuholen, was man ihm in seinem Kinderleben verweigert hat. Anfangs ist er damit völlig allein:
"(...) Dann bin ich von der Zeche ins Ruhrgebiet, verschiedene Industriebetriebe, Krupp zum Beispiel, Videa, immer als Hilfsarbeiter in der Transportkolonne usw. usf., erbärmliches Leben, schwere Arbeit, wenig Geld. Und wie verbrachte ich meine Freizeit? Mit Lesen, ja, natürlich mit Edgar Wallace, Agatha Christie und was weiß ich, da verbrachte ich meine Zeit, ganz isoliert, abgeschieden. Später habe ich dann begonnen, Abendkurse in der Volkshochschule zu besuchen. (...)"
Schließlich sucht er Hilfe, denn die Aufgabe ist zu groß für einen Menschen allein. Er findet Unterstützung bei einer Psychiaterin, die weiß, welche Erfahrungen hinter ihm liegen. Gemeinsam beginnen sie, um seine Rechte zu kämpfen.
"(...) 'Das ist ein Verbrechen, das an Ihnen begannen worden ist, und da lassen Sie sich nur nichts einreden.' Das wusste sie alles, dass da an den Leuten... (...) Der erste Mensch, der mir das so sagte: 'Mensch, man wird wahnsinnig, wenn man daran denkt, dass das auch meinen Kindern geschehen könnte.' Sie hatte zwei kleine Jungen. (...) 'Ist doch ganz aussichtslos, Herr D., dass Sie da die Ihnen vorenthaltene Bildung auf diese Weise nach Schwerstarbeit am Feierabend nachholen können, schreiben Sie da eine Petition und nennen Sie da Ross und Reiter.' Wusste ich, was eine Petition ist? (...)"
Aber Karl D. schreibt eine Petition und erreicht 1966, nicht ohne diverse psychologische und psychiatrische Tests machen zu müssen, dass das Land ihm eine Schulbildung bezahlt. 1971 besteht Karl D. das Abitur, vier Jahre hat er unentwegt gelernt. Diese Zeit ist schwer, weiter lebt er in Einsamkeit und Isolation, mit den anderen Schülern verbindet ihn nichts:
"(...) Das war eine private Abendschule. Und das war eine schreckliche Zeit. Ich hatte doch gar nicht das Vorwissen, große Lücken, das waren Auflagen, binnen vier Jahren muss ich dann fertig sein. (...) Da war keine Hilfe usw. Und die da auf das Abendgymnasium gingen, das waren Lümmel, die das gezwungenermaßen machten, weil ihre Eltern das wollten, weil sie von der Schule runtergeflogen waren. (...)"
Später beginnt er ein Studium der Germanistik und Philosophie und möchte Gymnasiallehrer werden. Der Wunsch nach Bildung erfüllt sich jetzt über alle Maßen, er studiert um der Bildung wegen und genießt jeden neuen Impuls. Aber es mischt sich Enttäuschung in die Entdeckung und Aneignung dieser so lang ersehnten Welt. Auch hier erlebt er das Gefühl von Fremdheit und Isolation:
"(...) Ich, als total Entfremdeter, musste die Welt nun als total entfremdet erleben und war entsetzt, dass die anderen noch entfremdeter waren als ich. Dass die Wissen als Ballast ansahen und dass das ein Übel war, das man auf sich nehmen musste, um einen halbwegs angenehmen Job als Lehrer zu haben. Ganz eingleisig, schmalspurig, was rechts und links war, interessierte absolut nicht. Wer weiß wie oft hab' ich den Rat bekommen, das brauchte ich doch alles gar nicht als Lehrer, die ganzen Bücher. (...)
Ich hatte da einen ganz sympathischen Professor, den Professor N., in einem Spinoza-Seminar hab' ihn da angesprochen: ‚Die Isolation, die ist doch sehr groß.' Das war das Problem, besonders hier an der Uni, eine Massenuniversität, wo viele Studenten sich umbrachten, eben wegen der Totalisolation. Das riesige Studienbüro mit zehn Psychologen, die da die Studenten betreuten und noch betreuen, ich glaube, es ist noch größer geworden. Da hab' ich das mal dem N. erzählt, dem Philosophieprofessor. 'Herr D., wenn Sie Isolation nicht ertragen können, dann brauchen Sie auch keine Philosophie zu studieren.' Ja, das bringt das Studium der Philosophie so irgendwo mit sich, aber dass man dann auch unbedingt diese bittere Pille da schlucken muss? Aber was wollte ich? Ich bin ein soziales Wesen, Bücher können für mich nur ein Ersatz sein. Wenn der Plato, der Rousseau und der Sokrates usw., wenn die mir persönlich begegneten, dann brauchte ich die Schwarten dort nicht. Das gibt es ja, dass man schon mal eine Sternstunde hat, dass man einem Menschen begegnet, der einen einen ganzen Abend herrlichst unterhalten kann. Nicht die Weltweisheiten usw., das erwarte ich ja gar nicht, aber doch so irgendetwas Substanzielles, noch dazu, wenn es humorig ist. Ich liebe Humor sehr. Eben weil ich den immer habe entbehren müssen, ich lache auch gern, wenn ich Grund dazu habe. Eben weil das verboten war in dem Irrenhaus, bei den perversen Nonnen: Lachen ist etwas sehr, sehr Böses in der Tradition der Klöster, im Kloster darf nicht gelacht werden. Gestern hab’ ich das noch gelesen, das war ein Vergehen, das mit Züchtigung von den Oberen bestraft wurde. (...)"
Spätestens in den 80er-Jahren holt ihn seine Kindheitsgeschichte endgültig wieder ein. Als er das Zweite Staatsexamen machen will, wird ihm dieses verweigert mit der Begründung seiner NS-Psychiatriediagnose von 1943; die Ärzte und Ärztinnen bescheinigen sogar ein Gefahrenpotenzial. Er kommentiert diese Erfahrung gefasst, vielleicht auch ironisch:
"(...) Ich hab’ schon Schlimmeres erlebt. Ich war dann Gott sei Dank nicht mehr ein hilfloses Kind von zwei Jahren auf der Krabbelstation des Waisenhauses, wo eine Geisteskranke bzw. eine ältere Patientin aus der Heilanstalt uns Kinder betreute. (...)"
Er geht juristisch gegen diese Entscheidung vor und gewinnt. Aber den Beruf darf er nie ausüben, keine Schulbehörde stellt ihn ein. Wieder erlebt Karl D., dass ihm Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, Ärztinnen und Ärzte seine Teilhabe und Entwicklung in der deutschen Gesellschaft verweigern. Er unterrichtet dann viele Jahre als Dozent an Volkshochschulen. Und auch wenn ihm diese Arbeit viel Freude und Erfüllung gegeben hat, so hat dieser erneute Ausschluss neben den seelischen gerade auch weitreichende materielle Folgen. Heute lebt er von Sozialhilfe, der damalige Verdienst reichte nicht für eine private Rentenversicherung. Erst 2003 hat sein Bundesland ihn als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt und zahlt ihm seitdem eine kleine Entschädigungsrente. Bis heute kämpft er für die Belange dieser Opfergruppe: Menschen die durch die kirchlichen Einrichtungen und den Nationalsozialismus verletzt, terrorisiert und ermordet wurden und deren Anerkennung in Deutschland noch immer aussteht.
Karl D. ist heute Mitte 70, er lebt in einer kleinen Wohnung in einem großen Häuserblock am Rand von M. Seit 20 Jahren wohnt er hier und fühlt sich immer noch wohl. Seine Nachbarinnen und Nachbarn sind überwiegend Studierende, denn die Uni ist nicht weit. Die Kontakte sind unverbindlich, aber offen und freundlich. Karl D. versorgt sich allein, wäscht, kocht, putzt, hat ein Auto, mit dem er vielfach unterwegs ist. Letztes Jahr hat diese Unabhängigkeit einen Riss bekommen. Karl D. hatte einen Herzinfarkt, von dem er sich nicht wie erwartet wieder erholen kann. Er ist wetterfühlig geworden und hat nicht mehr die gleiche Kraft: Dinge, die ihm leicht von der Hand gingen, erschöpfen ihn heute. Nach dem Aufräumen muss er sich ausruhen, auch längere Fahrten mit dem Auto fordern ihren Tribut. Gedanken kommen auf, zum Beispiel, ob er auf Dauer eine Putzfrau braucht, das muss er doch noch alleine schaffen. Auch die Einstellung der Medikamente ist noch nicht gelungen, er fühlt sich unwohl wegen der Nebenwirkungen. Aber er scheut davor zurück, seinen Arzt aufzusuchen und das Problem zu thematisieren, manchmal nimmt er deshalb die Medikamente erst gar nicht ein. Das Misstrauen gegenüber Ärzten und Ärztinnen ist groß, die Angst vor Entwürdigung und Demütigung nicht wegzudenken:
"(...) Deswegen bin ich ja auch nicht ins Krankenhaus gegangen zur Operation, vergangenes Jahr im Dezember. (...) Um acht Uhr morgens hatten sie mich bestellt, um halb zwei kam dann erst die ganz simple Untersuchung, Ultraschall. Wie ich da nachfragte, ich hab' mich nicht beschwert, ich bin schon ein Dussel, ein Lamm, zur Schlachtbank lass' ich mich aber nicht führen. Da bekam ich dann diese sehr aufschlussreiche Auskunft: 'Ja, wir bestellen die Patienten alle morgens hierher, die da untersucht werden sollen, und wenn die Ärzte dann mal Zeit haben, dann untersuchen die die Patienten.' Das habe ich dort im Krankenhaus erlebt, zweimal, dass man wirklich noch auf diesem wirklich ganz unmenschlichen Standpunkt steht, der Patient ist auf uns angewiesen, ihn können wir zappeln lassen. Der Arzt erzieht seinen Patienten, in der Zeitschrift für Psychologie kann man es nachlesen. Besser noch, wenn man den Patienten nackt warten lässt. Das ist die Erziehungsmethode, es gibt doch nichts Hilfloseres als einen nackten Menschen, der warten muss. (...)"
Er stellt eine Verbindung zwischen seinen Herzproblemen und seinen Verfolgungserfahrungen her und dabei weitere Gedanken in den Raum:
"(...) Ich möchte das natürlich absolut nicht ausschließen, dass einen die Vergangenheit, ob bewusst oder unbewusst – meist ist es unbewusst – auf Schritt und Tritt verfolgt. Das hat nichts irgendwie Psychopathologisches, um es schlicht mit Freud zu sagen. Ich weiß, dass ich hin und wieder noch Alpträume habe und ich da entsetzt bin. Das ist jetzt umso schlimmer, denn ich habe kein gesundes Herz mehr. Wenn ich dann aufwache und sage: Mensch, wann wirst du bei solch einem Alptraum einen Infarkt bekommen, einen tödlichen? Na ja, es ist dann kein schlimmer Tod. Lieber an einem Alptraum krepieren, um es mal salopp zu sagen, als von fremden Personen irgendwo gepflegt zu werden, wenn es böse ist, geschunden zu werden. Und da gibt es ja nun wahrlich Berichte genug über die Altenheime. (...)"
In der Rehabilitation habe man ihm gesagt, er solle sich regelmäßig bewegen, aber es ist schwer, sich allein zu motivieren:
"(...) Ich gehe viel spazieren, wenn es das Wetter erlaubt, wenn ich mich aufraffen kann, mich von meinen Büchern trennen kann... (...) Doch, natürlich, wenn man Anstoß bekommt, dann ist das leichter, aber dann muss ich mich selber anstoßen: der unbewegte Beweger. (...)"
Sich durch die Teilnahme an einer sogenannten Herzgruppe hierin unterstützen zu lassen, lehnt er ab:
"(...) Und ich weiß auch nicht, ob es das irgendwo angebracht ist bei mir, durch meinen Werdegang bzw. meine geistigen Interessen. Ich gehe gern spazieren mit jemandem. Beispielsweise, mein Freund, mit dem ich mich da unterhalten kann, über dieses und jenes, nicht irgendwelchen Tratsch und Klatsch, sondern was er in dieser oder jener Zeitung oder Zeitschrift gelesen hat. Das ist wirklich ein dialogisches Gespräch. (...)"
Zwei gute Freunde, Kommilitonen aus der Studienzeit, hat Karl D., aber beide wohnen in einer anderen Stadt, sodass man sich nicht so oft sehen kann, wie es allen gut tun würde. Die beiden waren es auch, die sich bei seinem Infarkt um ihn gesorgt, ihn im Krankenhaus besucht und sich um seine Wohnung gekümmert haben. Karl D. hat in M. nicht viele Bekannte und ist gegenüber seiner eigenen Generation misstrauisch, im Gegensatz zur Jugend, von deren noch spielerischer Uneindeutigkeit er begeistert ist:
"(...) Leute, die ihre Sozialisation im Obrigkeitsstaat, im Polizeistaat, im NS-Staat erfahren haben, da kann ich nichts anderes mehr erwarten, als dass sie mit dieser Mentalität wieder von dieser Welt gehen. Ja, das steckt da drin. (...) Und das kann man im Alter dann natürlich nicht mehr ablegen, ein hartes männliches Gesicht. (...) Sensibilität war ja total pervers, unmenschlich, rassisch minderwertig, usw. usf. (...) Als Kinder mussten wir schon mal marschieren. Und ich hasste das Marschieren. Ich hasste das Marschieren. Ein Kind will nicht marschieren, ein Junge will spielen, das ist aber doch nicht: eins, zwei, eins, zwei, rechts, links. Und wenn das ein Subjekt, ein Junge, akzeptiert und dann da hinein wächst, das prägt auch. Stahlharte Gesichter. 'Das will ich, eine stahlharte Jugend, schnell wie Windhunde und hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder'. Und das kann man ja heute an den Jugendlichen sehen, nicht, die Haarschnitte, die schönen langen Haarschnitte usw. usf. Das ist das Schöne, dieser Unisex, dieses Androgyne, nicht wahr, das mir persönlich junge Menschen so sympathisch macht, ob nun Junge oder Mädchen. (...)"
NS-Verfolgte im Alter: Einleitung zu den Aufgaben
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Didaktisierung für die Pflegeausbildung: Karl D., der lernen musste, sein Leben zu verteidigen
(Andrea Zielke-Nadkarni, Märle Poser)
Schon kurze Zeit nach der Machtübernahme der Nazis beginnt die systematische Vorbereitung der Vernichtung psychisch kranker und geistig behinderter Menschen: Im Januar 1934 tritt das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" in Kraft. Im Herbst 1939 unterschreibt Hitler eine Ermächtigung zur Euthanasie. Speziell ausgewählte Pflegende werden ab 1940 in die Tötungsabsichten eingeweiht und vertraglich zu Stillschweigen und Kooperation verpflichtet.
Viele professionell Pflegende kooperieren während des "Dritten Reiches" mit den Nazis. Dies geschieht zum Teil zunächst aus Unwissenheit und Obrigkeitsgläubigkeit. Hier die Aussage einer Pflegeperson vor Gericht:
"Auf den Gedanken, mich den getroffenen Anordnungen zu widersetzen, bin ich nicht gekommen, da ich davon überzeugt war, zur damaligen Zeit auf meinem Posten genauso seine Pflicht tun zu müssen, wie man sie von den Soldaten an der Front verlangte." (41)
Zum Teil kooperieren Pflegende aus Überzeugung und zum Teil aus sadistischem Vergnügen, das mit politischer Überzeugung getarnt wird. Historische, christlich begründete Werte der Krankenpflege, wie Dienen, Opfern, Gehorsam, Gutes tun, werden uminterpretiert. Das Dienen gilt dem Führer und dem Volk, Gutes tun beinhaltet nun auch Mord, da er als "Erlösung" für die Kranke oder den Kranken bzw. als Dienst an der Gesellschaft dargestellt wird. Nachweislich waren Pflegende an den folgenden Aufgaben beteiligt:
- Vorbereitung zum Abtransport, Richten und Auflisten der persönlichen Gegenstände; Kennzeichnung der Patientinnen und Patienten mittels Pflasterklebestreifen oder direkt auf die Haut, wobei mit Tintenstift zwischen die Schulterblätter Angaben zur Person geschrieben wurden, Entkleiden der Patientinnen und Patienten.
- Begleitung der Transporte zur Zwischen- oder Tötungsanstalt; während der Fahrt wurden unruhige Patientinnen und Patienten mit Fesseln oder Medikamenten "beruhigt".
- Begleitung der Patientinnen und Patienten in die Tötungsanstalten, Hilfe beim Entkleiden und der Vorführung bei Ärzten und Ärztinnen.
- Begleitung der Patientinnen und Patienten bis zur Gaskammer.
- Entgegennahme der persönlichen bzw. anstaltseigenen Sachen der Patientinnen und Patienten nach der Ermordung. (42)
NS-Verfolgte im Alter: Aufgabe 1
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
Arbeitsaufgabe 1:
Sucht in dem Geschichtswerk "Krankenpflege im Nationalsozialismus" von Hilde Steppe ab S. 146 Berichte sowohl von Pflegepersonen heraus, die an den Euthanasievorgängen beteiligt waren, als auch von Pflegepersonen, die sich diesen Vorgängen entzogen haben.
- Sucht nach den Rechtfertigungen des Pflegepersonals für die eigene Beteiligung: Welche Begründungen werden angeführt?
- Welche Argumente werden gegen eine Beteiligung vorgebracht?
- Diskutiert eure Ergebnisse miteinander.
NS-Verfolgte im Alter: Aufgabe 2
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
Arbeitsaufgabe 2
Karl D. äußert folgendes Problem, das ihn u. a. davon abhält, den Gedanken an ein Pflegeheim für sich selbst überhaupt zuzulassen:
"(...) Und sie hat viermal die Pflegedienste gewechselt. Einmal kam da jemand, ich selber habe ihn auch gesehen, kannst du dir das vorstellen, einer mit 'ner Glatze und total tätowiert, in Lederhose usw. Muss ja nicht, kann aber sein, dass hier jemand, der überhaupt nicht qualifiziert dafür ist, dann solch eine Aufgabe wahrnimmt bzw. nicht wahrnehmen kann. Und das wäre natürlich ideal, wenn man in solch einem Falle, wo man hilflos und pflegebedürftig ist, solch einen Kontrolleur dort an der Seite hätte. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das hab' ich leidvoll erfahren. Das blüht dir, wenn du hilflos bist, auch wieder in deinem Alter. (...)"
Diskussion, zunächst in Partnerarbeit, Ergebnisse in der Gesamtgruppe:
- Welche Probleme hat Karl D. mit diesem Pfleger?
- Was sind seine Erwartungen an das Äußere eines Pflegers oder einer Pflegerin?
- Worauf basieren sie?
- Sind sie berechtigt?
NS-Verfolgte im Alter: Aufgabe 3
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
Arbeitsaufgabe 3 (Gesamtgruppe)
Erläutert miteinander die in der Grafik unten genannten Faktoren und ergänzt die Aspekte gemäß eurer eigenen Erfahrung.
NS-Verfolgte im Alter: Aufgabe 4
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
Arbeitsaufgabe 4 (arbeitsteilige Kleingruppen)
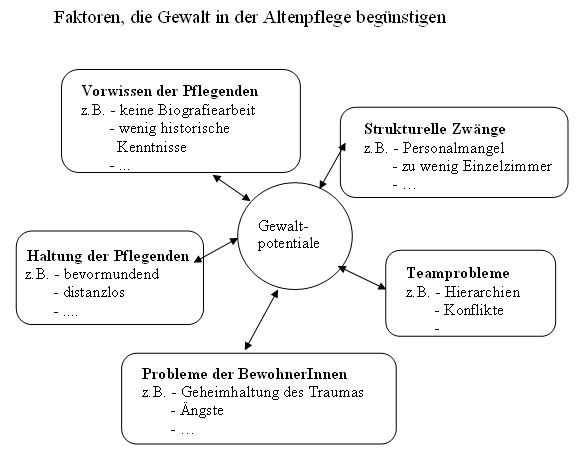
Überlegt, wie diesen Faktoren entgegengewirkt werden könnte (pro Gruppe ein Bereich/eine Liste).
NS-Verfolgte im Alter: Aufgabe 5
"Man sieht nur, was man weiß" - NS-Verfolgte im Alter
Arbeitsaufgabe 5 (arbeitsteilige Kleingruppen)
Erstellt ein Arbeitspapier mit euren Ergebnissen für die Leitung des Altenheims mit dem Ziel, die vorliegenden strukturellen Mängel zu beheben.
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Vorgeschichte und Zwangssterilisationen
(Uta George)
Die folgenden Texte und Übungen thematisieren die nationalsozialistische Verfolgung von Menschen, die als krank oder behindert galten. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Jahrzehnte vor dem Beginn des Nationalsozialismus: Bereits zu dieser Zeit wurden diese Menschen ausgegrenzt und in der Propaganda negativ dargestellt. Behauptet wurde beispielsweise, dass sie für die Gesellschaft eine wirtschaftliche Belastung darstellten, weil sie aufgrund ihrer Krankheit oder Behinderung nicht arbeiten konnten.
Darüber hinaus waren um 1900 durch die Erkenntnisse der Genetik Utopien der Menschenzüchtung entstanden. Das heißt, einzelne Wissenschaftler, zum Beispiel Mediziner, Biologen und Anthropologen, hofften, sie könnten Einfluss auf das Fortpflanzungsverhalten der Menschen und damit auf das Bevölkerungswachstum nehmen. Dies bedeutete für sie, dass Menschen, die sie als "hochwertig" einstuften, möglichst viele Kinder bekommen sollten. Menschen, die von ihnen als "minderwertig" bezeichnet wurden, sollten möglichst ohne Nachkommen bleiben. Diese Lehre nennt man Eugenik. Das Ziel dieser Wissenschaftler war eine Gesellschaft ohne kranke oder behinderte Menschen. Dabei gingen sie davon aus, dass Behinderungen, Krankheiten und auch soziale Verhaltensweisen vererbt werden. Zur Umsetzung der Idee einer krankheits- und behindertenfreien Gesellschaft waren ihnen auch Zwangsmaßnahmen recht. Im Visier waren dabei besonders Menschen, die als unheilbar und nicht arbeitsfähig galten. Bereits 1920 schlägt sich dieses Gedankengut in der öffentlichen Diskussion nieder, wie im folgenden Text deutlich wird. Die Autoren waren der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche.
Euthanasie: Text Binding und Hoche
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Text Binding und Hoche:
"(…) es ist eine peinliche Vorstellung, daß ganze Generationen von Pflegern neben diesen leeren Menschenhülsen dahinaltern, von denen nicht wenige 70 Jahre und älter werden.
Die Frage, ob der für diese Kategorien von Ballastexistenzen notwendige Aufwand nach allen Richtungen hin gerechtfertigt sei, war in den verflossenen Zeiten des Wohlstandes nicht dringend; jetzt ist es anders geworden, und wir müssen uns ernstlich mit ihr beschäftigen. Unsere Lage ist wie die der Teilnehmer an einer schwierigen Expedition, bei welcher die größtmögliche Leistungsfähigkeit Aller die unerläßliche Voraussetzung für das Gelingen der Unternehmung bedeutet, und bei der kein Platz ist für Halbe-, Viertels- und Achtels-Kräfte. Unsere deutsche Aufgabe wird es für lange Zeit sein: eine bis zum höchsten gesteigerte Zusammenfassung aller Möglichkeiten, ein Freimachen jeder verfügbaren Leistungsfähigkeit für fördernde Zwecke. Der Erfüllung dieser Aufgabe steht das moderne Bestreben entgegen, möglichst auch die Schwächlinge aller Sorten zu erhalten, auch den zwar nicht geistig toten, aber doch ihrer Organisation nach minderwertigen Elementen Pflege und Schutz angedeihen zu lassen – Bemühungen, die dadurch ihre besondere Tragweite erhalten, daß es bisher nicht möglich gewesen ist, diese Defektmenschen von der Fortpflanzung auszuschließen.
Die ungeheure Schwierigkeit jedes Versuches, diesen Dingen irgendwie auf gesetzgeberischem Wege beizukommen, wird noch lange bestehen, und auch der Gedanke, durch Freigabe der Vernichtung völlig wertloser, geistig Toter eine Entlastung für unsere nationale Überbürdung herbeizuführen, wird zunächst und vielleicht noch für weitere Zeitstrecken lebhaftem, vorwiegend gefühlsmäßig vermitteltem Widerspruch begegnen, der seine Stärke aus sehr verschiedenen Quellen beziehen wird. (Abneigung gegen das Neue, Ungewohnte, religiöse Bedenken, sentimentale Empfindungen usw.)."
Quelle
Binding, Karl; Hoche, Alfred (1922): Die Freigabe der Vernichtung lebenswerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form. 2. Aufl., Leipzig, S. 55f.
Fragen zum Text von Binding und Hoche
Euthanasie: Fragen zu Text Binding und Hoche
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Fragen zu Text Binding und Hoche
- Um einen Eindruck davon zu bekommen, was damals viele Menschen dachten, könnt ihr in Einzelarbeit aus dem Text diejenigen Begriffe heraussuchen, die für Menschen mit Behinderungen oder psychisch Kranke verwendet werden.
- Welche Probleme nennen die Autoren, welche Lösungen schlagen sie vor? Notiert eure Ergebnisse.
- Überlegt, ob auch heute noch Menschen so denken und besprecht dies mit drei anderen.
- In Deutschland wurde Anfang des 20.Jahrhunderts das Wort "Rassenhygiene" verwandt. - Untersucht die Teile dieses Wortes: Schreibt auf je ein Blatt die Begriffe "Rasse" und "Hygiene" und ordnet eure Gedanken, die euch dazu einfallen, um die Begriffe herum an. Legt dann die Blätter nebeneinander und schaut, ob neue Wortzusammensetzungen möglich sind. Was erfahrt ihr daraus über eure eigene Beziehung zu dem Begriff?
- Überlegt, ob der Begriff "Rasse" heute noch benutzt wird. Wenn ja, in welchen Zusammenhängen? Welche Möglichkeiten und Argumente gibt es, den Begriff in Zukunft nicht mehr zu verwenden? Lest hierfür folgenden Text: Policy Paper No. 10: "... und welcher Rasse gehören Sie an?" Zur Problematik des Begriffs "Rasse" in der Gesetzgebung
Euthanasie: Fragen zur Gesamtauswertung
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Fragen zur Gesamtauswertung
- Was hat sich durch die Informationen und Diskussionen für euch Neues ergeben?
- Was wusstet ihr noch nicht, was hattet ihr euch schon gedacht?
- Informiert euch darüber, ob es früher Tötungsanstalten in eurem Wohnort gab. Welche anderen Einrichtungen gab es zur Zeit des Nationalsozialismus in der Gegend, in der ihr wohnt?
- Wo leben Menschen mit Krankheiten und Behinderungen heute, wo gehen sie zur Schule? Wo arbeiten sie, wo sind sie untergebracht? Sprecht mit ihnen und befragt sie in Gruppen zu ihrem Leben. Mit welchen Schwierigkeiten haben sie heute zu kämpfen? Was freut sie besonders? Stellt die Ergebnisse der Gruppe vor.
Euthanasie: Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Die sogenannten Rassehygieniker wollten, dass Menschen, die sie als "hochwertig" einstuften, möglichst viele Kinder bekommen sollten. Menschen, die von ihnen als "minderwertig" bezeichnet wurden, sollten möglichst ohne Nachkommen bleiben. Das Ziel dieser Wissenschaftler – es handelte sich bei den theoretisch arbeitenden Wissenschaftlern zu dieser Zeit ausschließlich um Männer - war eine Gesellschaft mit möglichst wenigen kranken oder behinderten Menschen. Zur Umsetzung ihrer Idee einer krankheits- und behindertenfreien Gesellschaft waren ihnen auch Zwangsmaßnahmen recht. Dies vertraten sie schon vor der Zeit des Nationalsozialismus.
Sobald die Nationalsozialisten die Macht hatten, begannen sie damit, die Vorstellungen der Rassenhygieniker in die Tat umzusetzen. Um die Bevölkerung auf die zukünftigen Maßnahmen gegen Kranke und Menschen mit Behinderungen, wie die zwangsweise Unfruchtbarmachung oder Tötung, vorzubereiten, setzte ab 1933 eine massive Propaganda ein. Mithilfe von Ausstellungen, Plakaten und Ähnlichem wurde ein bestimmter Teil der Bevölkerung diffamierend dargestellt und ausgegrenzt.
Bereits im Juli 1933 erließ Hitlers Kabinett ein Zwangssterilisationsgesetz, das so genannte "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses". Wie der Name bereits andeutet, gingen die Autoren von einer Erblichkeit der Krankheiten und Behinderungen aus. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wurden von 1934 bis 1945 ca. 400.000 Menschen gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht.
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Fragen zum Text:
- Welche Menschen waren von dem Gesetz betroffen? Sucht die euch unbekannten Krankheiten und Behinderungen, die in Paragraf 2 (2) genannt werden, im Internet.
- Schreibt den Titel des Gesetzes auf eine Wandzeitung. Sammelt Assoziationen zu jedem einzelnen Wort des Titels. Warum wohl wählten die Gesetzgeber diesen Namen? Was wollten sie damit deutlich machen?
- Bei dem "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" handelte es sich um ein Gesetz, dass wir heute als Unrecht bezeichnen, da es nicht vereinbar ist mit den Menschenrechten; in diesem Gesetz wurden bestimmte Personengruppen zu Menschen mit weniger Rechten erklärt. - Welche Voraussetzungen waren notwendig, um ein solches Unrechtsgesetz überhaupt erlassen zu können? Tauscht euch mit eurer Nachbarin, eurem Nachbarn aus.
- Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Massenmorde wurde 1948 von den Vereinten Nationen die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" verkündet. - Schaut in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nach: Wo und wie versuchen die Verfasserinnen und Verfasser, durch die internationale Einigung auf allgemein gültige Menschenrechte in Zukunft solches Unrecht zu verhindern?
Euthanasie: Zwangssterilisationen
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Zwangssterilisationen
Georg B. war 1936 Patient der Heil- und Pflegeanstalt Gießen. Bei Patientinnen und Patienten, die entlassen werden sollten (weil es ihnen wieder gut ging), wurde zuvor geprüft, ob sie zwangsweise sterilisiert werden sollten. Dies entschieden zwei Ärzte und ein Jurist in einer Verhandlung vor einem so genannten Erbgesundheitsgericht. Dafür erstellten die Ärzte der Anstalt ein Gutachten über den betreffenden Patienten oder die Patientin, das als Grundlage für die Entscheidung galt. Hier ein Auszug aus der Akte von Georg B.:
Aufnahmebogen:
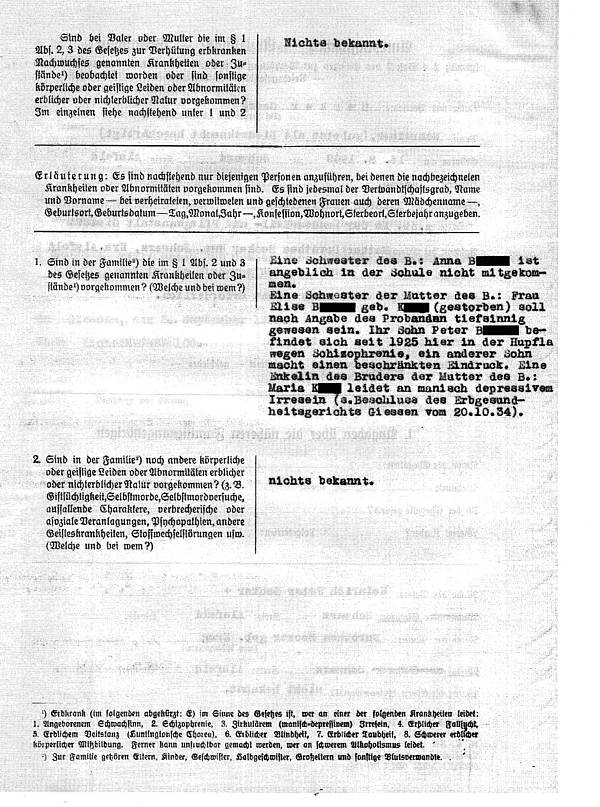
Fragen zum Aufnahmebogen:
Überlegt zu zweit: Wie wird die Familie von Georg B. beschrieben? Sucht die Ausdrücke heraus, die euch auffallen. Welchen Eindruck hinterlassen sie bei euch?
Beschluss Erbgesundheitsgericht Gießen
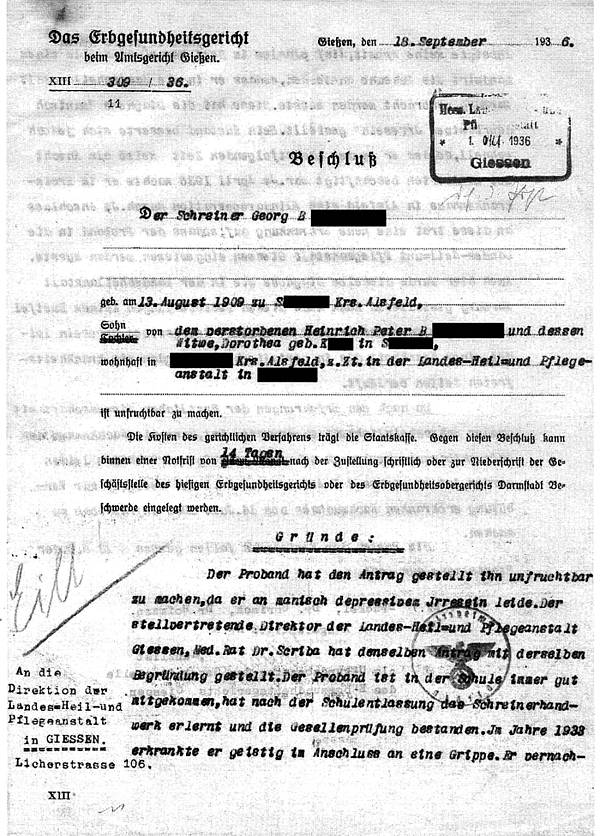
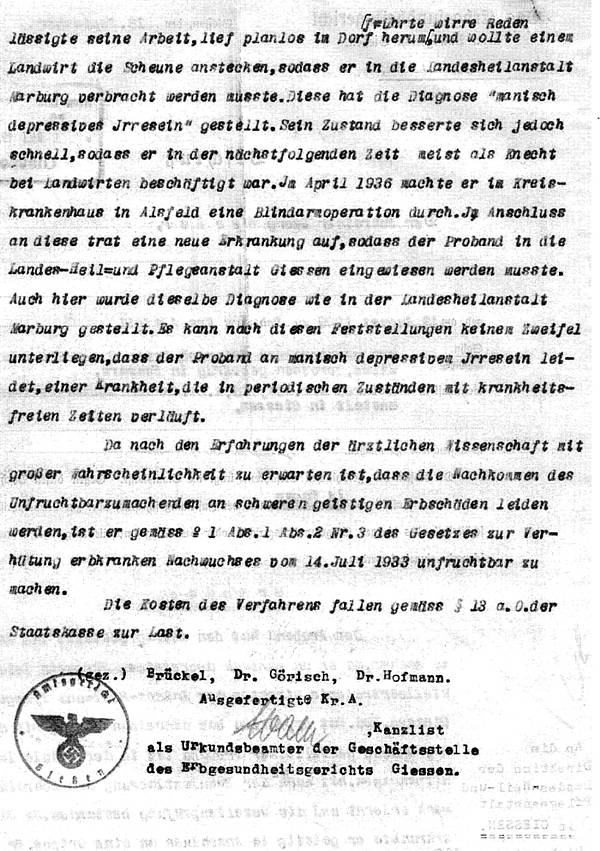
Fragen zum Beschluss:
- Lest die Begründung für die Entscheidung des Erbgesundheitsgerichtes Gießen. Welche Gründe nennt es für die Sterilisation von Georg B.? Haben diese etwas mit der Beschreibung seiner Familie (siehe Dokument "Aufnahmebogen") zu tun?
- Stellt euch vor, Georg B. und seine Geschwister hätten diese Begründung gelesen. Wie hätten sie ihre Gefühle wohl beschrieben?
- Wie schon der Titel verrät, gingen die Verfasser des Gesetzes davon aus, dass alle im "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" erwähnten Krankheiten und Behinderungen erblich seien. Welche Ängste und Überlegungen könnte das bei der Familie von Georg B. ausgelöst haben?
- Denkt noch einmal an den Beginn der Verfolgung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen: Was hätten Angehörige an bedrohlichen oder problematischen Einstellungen oder politischen Veränderungen für ihre Angehörigen bemerken können? Schreibt eure Überlegungen auf Kärtchen und hängt sie an eine Pinnwand.
Heute wissen wir, dass etwa 50 Prozent der Menschen, die sterilisiert wurden, die Diagnose "angeborener Schwachsinn" erhielten. Dies bedeutete in der Regel, dass diese Menschen als sozial unangepasst oder missliebig angesehen wurden. Darunter fielen zum Beispiel Menschen, die häufig den Wohnort wechselten, die keiner regelmäßigen Arbeit nachgingen und kinderreiche Familien, die von Sozialhilfe lebten. Das bedeutet, de facto spielten das soziale Umfeld und das Verhalten der Menschen eine sehr große Rolle für die Entscheidung, ob sie unfruchtbar gemacht wurden.
Euthanasie: "Aktion T4"
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
"Aktion T4": Die erste Phase der Anstaltsmorde am Beispiel Hadamar
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges begannen die Tötungen von Patientinnen und Patienten der psychiatrischen Einrichtungen. Alle, die schwere Krankheiten bzw. Behinderungen hatten, schon lange in Anstalten lebten, die als kriminell oder nicht-deutsch galten, wurden mithilfe eines Erhebungsbogens erfasst und begutachtet. Die bürokratische Zentrale des Mordens war in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Nach dieser Adresse wurde die Mordaktion - nach dem Krieg - bezeichnet: Aktion T4. Besonders oft wurden Patientinnen und Patienten psychiatrischer Einrichtungen ermordet, die als unheilbar und nicht arbeitsfähig galten.
Ab Januar 1940 wurden nacheinander sechs Tötungsanstalten in Betrieb genommen: Brandenburg, Grafeneck, Hartheim, Sonnenstein/Pirna, Bernburg und Hadamar. Bis auf eine waren alle ursprünglich Heil- und Pflegeanstalten oder Heime, Brandenburg war ein leerstehendes Zuchthaus. Die Täterinnen und Täter waren Ärzte, Schwestern, Pfleger und Verwaltungsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen.
In die Gebäude bzw. auf die Gelände bauten Handwerker je eine Gaskammer, einen Sezierraum und Verbrennungsöfen. Busse der gemeinnützigen Krankentransportgesellschaft (Gekrat) brachten die Opfer in die Gasmordanstalten, wie zum Beispiel nach Hadamar im heutigen Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen. Für die Angehörigen war nicht nachvollziehbar, wohin ihr Familienmitglied gebracht wurde, dies wurde geschickt verschleiert. In knapp acht Monaten, von Januar bis August 1941, tötete das Personal in Hadamar mehr als 10.000 Menschen. Die Gasmorde endeten im August 1941. Bis zu diesem Zeitpunkt waren in den sechs Tötungsanstalten ca. 70.000 Menschen ermordet worden.
Brief von Adolf Hitler vom 1. September 1939:
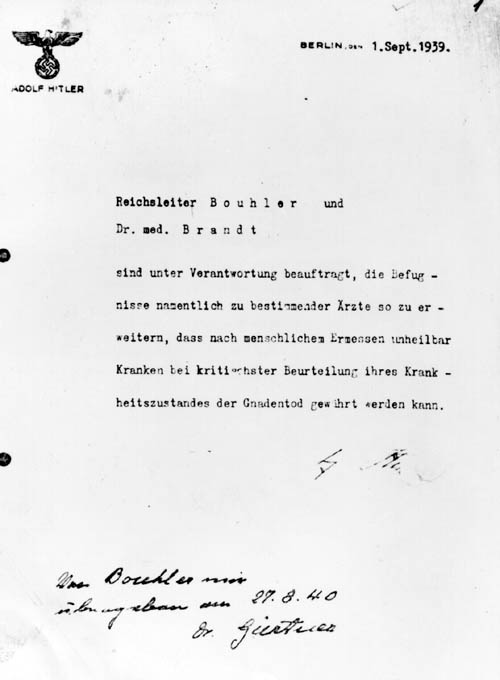
Fragen zum Brief von Adolf Hitler:
- Lest den Brief von Adolf Hitler und versucht mit zwei anderen, den Text wörtlich in heutige Sprache zu übersetzen. Überlegt gemeinsam, warum Hitler diesen Brief verfasste und was er mit ihm deutlich machen wollte. Tauscht euch zunächst mit den zwei anderen und danach alle gemeinsam darüber aus, wozu Hitler die Ärzte und Ärztinnen mit diesem Brief bewegen wollte.
Euthanasie: Verschleierung und Tarnung der Morde
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Verschleierung und Tarnung der Morde
Wichtig war die Verschleierung und Tarnung der Morde, denn niemand - weder Angehörige noch die Bevölkerung - sollte von ihnen erfahren bzw. über sie sprechen. Daher sollte ein natürlicher Tod der Opfer, in der Regel durch eine ansteckende oder entzündliche Krankheit, vorgetäuscht werden. Der Verwaltungsabteilung kam hierbei eine besondere Rolle zu: Sie schickte den Angehörigen eine Sterbeurkunde und einen so genannten Trostbrief mit der angeblichen Todesursache.
Trostbrief:
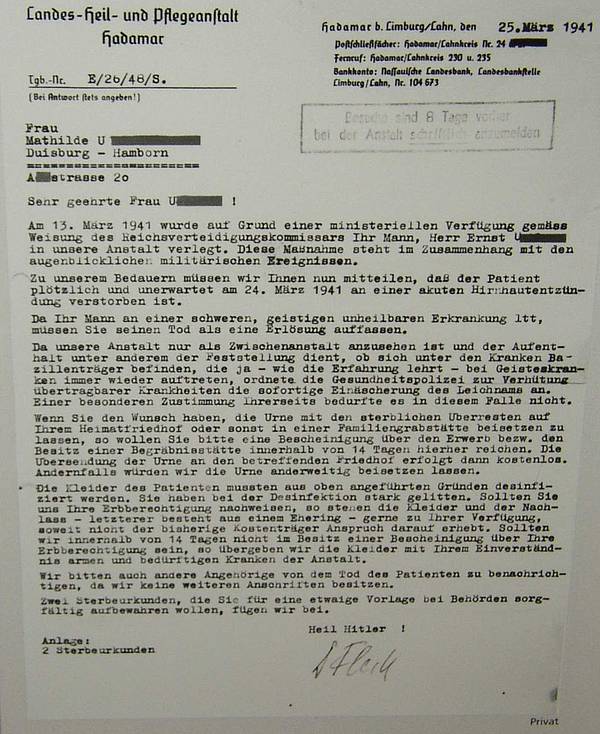
Fragen zum Trostbrief:
Seht euch den "Trostbrief" an. Was steht dort geschrieben? Findet ihr einen Hinweis auf die Ermordung von Ernst U.?
Zur Weiterarbeit:
Euthanasie: Jenseits der Trostbriefe
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Jenseits der Trostbriefe: Tatsächliche Umstände der Morde
Der Landeswohlfahrtsverband Hessen ist den Schicksalen der in der Tötungsanstalt Hadamar Ermordeten nachgegangen und hat die wahren Umstände ihres jeweiligen Todes herausgefunden. Als Beispiel findet ihr hier einen Text über die Hintergründe zum Tod von Ernst U., dessen Ehefrau Mathilde den Trostbrief erhielt.
Leben und Ermordung von Ernst U.:
Ernst U., Jahrgang 1899, wurde in Bulmke/Gelsenkirchen geboren und erlernte nach der Volksschule das Bäckerhandwerk. 1923 heiratete er und wurde in den Jahren 1924-1932 Vater von sechs Kindern. 1929 begab sich Ernst U. freiwillig erstmals in ein Krankenhaus und von dort in die Psychiatrische Klinik Bedburg. Nach drei Monaten wurde er wieder entlassen, mußte jedoch im Dezember 1933 erneut in die Psychiatrische Klinik, wahrscheinlich mit der Diagnose "Schizophrenie". Er hatte bis dahin in der Brotfabrik seines Onkels gearbeitet, wo bis 1933 seine Krankheitssymptome noch toleriert worden waren. Ab 1933 blieb Ernst U. in dauernder Anstaltsbehandlung in Bedburg. Seiner Frau wurde mitgeteilt, sie müsse dieser dauernden Anstaltsunterbringung zustimmen, sonst kämen ihre Kinder in ein Heim. Ernst U. wurde regelmäßig von seinen Verwandten in der Klinik besucht, die Tochter erinnert sich heute noch an die immer weinende Mutter nach solchen Anstaltsbesuchen. Wahrscheinlich wurde er schon 1940 im Rahmen von Verlegungen aus dem Rheinland in eine südhessische Anstalt verlegt. Anfang 1941 ahnt er Schlimmes: er schrieb seiner Mutter und bat um Abholung aus der Anstalt, und kurz darauf schrieb er seiner Frau eine Karte mit der dringenden Bitte um Besuch. Die Karte trug den Stempel "Besuche nicht erwünscht". Ende März erhielt seine Frau die Nachricht von seinem Tod. In einem langen Trostbrief wurde ihr mitgeteilt, er sei am 13. März 1941 nach Hadamar verlegt worden und dort am 24. März "plötzlich und unerwartet" an einer "akuten Hirnhautentzündung" verstorben. Ernst U. wurde tatsächlich in der Gaskammer von Hadamar ermordet.
Trostbrief:
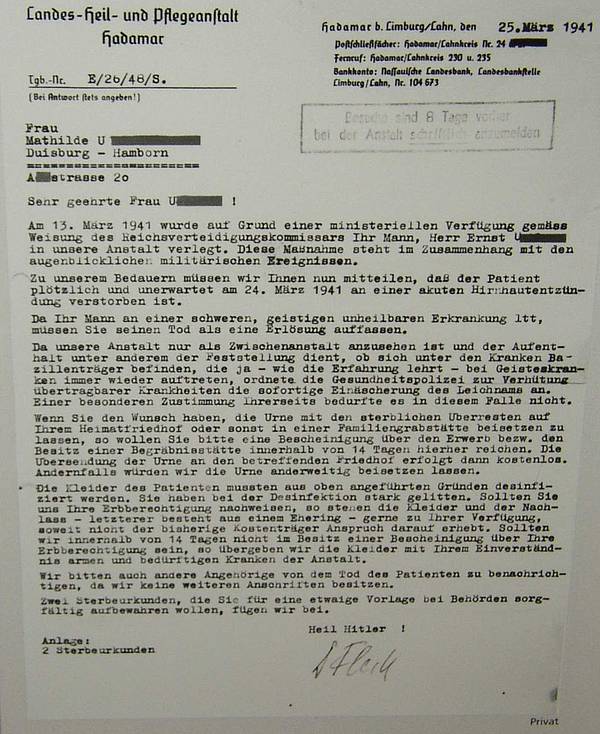
Fragen zum Text "Leben und Ermordung von Ernst U".:
- Vergleicht gemeinsam die Angaben im Trostbrief mit dem Bericht des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Überlegt, welche Funktionen die Trostbriefe hatten. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Angehörigen fühlten, wenn sie solch einen Brief erhielten? Wie werden sie sich verhalten haben?
Zur Struktur und Funktion der Trostbriefe (H. Friedländer):
"Der erste Absatz des Trostbriefes benachrichtigte die Angehörigen über den Tod des Patienten. Ein Brief aus Grafeneck begann folgendermaßen: 'Es tut uns aufrichtig leid, Ihnen mitteilen zu müssen, daß Ihre Tochter (…) plötzlich und unerwartet an einer Hirnschwellung verstorben ist.' Gelegentlich wurde eine Standardphrase hinzugefügt, die andeuten sollte, daß das medizinisch Machbare versucht worden sei. So endete beispielsweise der erste Absatz eines Briefes aus Brandenburg mit folgendem Satz: 'Es gelang uns trotz aller ärztlichen Bemühungen nicht, Ihren Mann am Leben zu erhalten.' Und in einem Brief aus Hartheim heißt es: 'Eine ärztliche Hilfe war leider nicht mehr möglich.' Der zweite Absatz des Trostbriefes sollte die Verwandten beruhigen. Er erwähnte die Argumente, die durch die offizielle Euthanasiepropaganda bereits populär gemacht worden waren. Der oben zitierte Brief aus Brandenburg enthielt folgenden Abschnitt: 'Da jedoch bei der Art und Schwere des Leidens Ihres Mannes mit einer Besserung (…) nicht mehr zu rechnen war, kann man seinen Tod, der ihn von seinen Leiden befreite (…), nur als Erlösung für ihn ansehen.' (…) In einer anderen Version heißt es: 'Er ist ruhig und ohne Schmerzen gestorben. Bei seiner schweren unheilbaren Krankheit war sein Tod für ihn eine Erlösung.' (…)
Im dritten Absatz ging es um den Verbleib der sterblichen Überreste. Im Normalfall konnte man von einer Anstalt erwarten, daß sie den Angehörigen den Leichnam des oder der Verstorbenen zur Bestattung überstellte. Hier jedoch war es unmöglich, die Körper der Ermordeten an ihre Familien zurückzugeben, weil sonst die Angehörigen und die Ärzte ihres Vertrauens die wirkliche Todesursache hätten feststellen können. Die Mordzentren teilten daher den Angehörigen mit, die Leiche habe 'aus seuchenpolizeilichen Gründen' eingeäschert werden müssen. (…)
Der letzte Teil des Trostbriefes behandelte schließlich bürokratische Einzelheiten. Man bot die Übersendung einer Urne mit der Asche (…) an und bat um eine Antwort der Angehörigen innerhalb von 14 Tagen. (…) Wenn die Angehörigen darauf nicht reagierten, kam die Urne in irgendein Massengrab im Mordzentrum. (…) Weiterhin hieß es in dem Brief, man werde den Angehörigen Wertgegenstände und Erinnerungsstücke übersenden, die Kleidung aber habe man der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt übergeben, da sie bei der Desinfektion beschädigt worden sei. Tatsächlich jedoch eigneten sich die Mordzentren diese Besitztümer häufig unrechtmäßig an. So wurden Mitarbeiter für ihre Leistungen beim Massenmord häufig mit Kleidungsstücken belohnt. Schließlich schreckte der Brief ein weiteres Mal vor Besuchen ab: Um Ansteckung zu vermeiden, hieß es, müssten alle Anfragen schriftlich erfolgen."
Fragen zum Text von Friedländer:
- Der Historiker Henry Friedländer hat Trostbriefe aus Tötungsanstalten wie Hadamar analysiert, um die dahinter stehende Absicht zu beschreiben. Lest Friedländers Beschreibung und vergleicht seine Erkenntnisse über die Trostbriefe mit euren Gedanken. Was habt ihr ähnlich beurteilt, was anders?
- Wie würdet ihr die Aufgaben der Verwaltung im Rahmen der "Aktion T4" beurteilen? Haben sich die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter durch ihre Mitarbeit schuldig gemacht? Wenn ja, wodurch?
Quellen:
Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hg.): Verlegt nach Hadamar. Die Geschichte einer NS-"Euthanasie"-Anstalt, 3. Aufl. Kassel 2002, S. 107
Friedländer, Henry: Der Weg zum NS-Genozid. Von der Euthanasie zur Endlösung, Berlin 1997, S. 180-183
Euthanasie: Die Grauen Busse
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Rund um die Tötungsanstalten: die Grauen Busse
Fragen zum Foto:
Schaut euch das Foto an, das vor der Zwischenanstalt Eichberg aufgenommen wurde. Unter anderem von dort fuhren die Transporte mit den "Grauen Bussen" los nach Hadamar. Die Opfer waren von ihren ursprünglichen Anstalten in die Zwischenanstalten gebracht worden und blieben dort in der Regel einige Wochen. Die Fenster der Busse waren verhängt, so dass niemand sehen konnte, wer darin saß.
- Stellt gemeinsam Vermutungen zu den folgenden Fragen an: Die Tötungsanstalt Hadamar lag am Rande der Stadt. Was könnte die Hadamarer Bevölkerung angesichts der grauen Busse und des rauchenden Schornsteins gedacht haben?
- Was könnte sich der Bäcker gedacht haben, als er monatelang für nur ca. 100 Personen Brot lieferte, aber fast täglich drei bis sechs Busse mit Menschen zur Anstalt fahren sah?
- Formuliert einen möglichen Tagebucheintrag, den eine Hadamarer Bürgerin oder der Bäcker über ihre Beobachtungen an einem beliebigen Tag gemacht haben könnten. Bildet Zweiergruppen und tragt euch die Notizen gegenseitig vor.
Weiter zu "1942-1945: Die zweite Phase der Anstaltsmorde in Hadamar"
Euthanasie: 1942-1945: Die zweite Phase der Anstaltsmorde in Hadamar
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
1942-1945: Die zweite Phase der Anstaltsmorde in Hadamar
Das Ende der Gasmorde bedeutete nicht das generelle Ende der Tötungen in den Anstalten. Vielmehr begann nach den Gasmorden die regionale oder dezentrale Ermordung der Patientinnen und Patienten in psychiatrischen Einrichtungen. In unzähligen Anstalten tötete das Personal die Opfer durch Nahrungsmittelentzug und überdosierte Medikamente, meist Beruhigungsmittel. Dies war wesentlich unauffälliger als die Tötung in sechs Mordzentren, zumal die Leichen nicht mehr verbrannt, sondern verscharrt wurden. Insgesamt starben bei den „Euthanasie“-Morden zwischen 1940 und 1945 bis zu 200.000 Menschen.
In Hadamar begann diese zweite Phase der Anstaltsmorde im August 1942. Scheinbar wurden wieder regulär Patientinnen und Patienten aus dem ganzen Gebiet des damaligen "Deutschen Reiches" aufgenommen. Viele von ihnen überlebten nur kurze Zeit in Hadamar, andere einige Monate oder sogar Jahre. Der Arzt konferierte täglich mit der Oberschwester und dem Oberpfleger, um zu überlegen, welche Patientinnen und Patienten abends getötet werden könnten. Die Nachtschicht verübte den Mord durch die Gabe überdosierter Beruhigungsmittel. In dieser Zeit gab es kaum Entlassungen; einige wenige Patientinnen und Patienten konnten fliehen.
Die Aussagen einiger Überlebender beschreiben den grausamen Alltag in der Tötungsanstalt Hadamar:
Aussagen Überlebender:
Das Gros der Patienten erhielt die denkbar schlechteste Versorgung. Sie waren nicht nur auf engstem Raum zusammengepfercht, "… daß man oft kaum durch die Krankensäle hindurchgehen konnte", sondern mußten auf Strohsäcken schlafen und bekamen eine absolute Hungerkost. Nach Aussage der Schwester Huber "… gab es dünne Suppen, von denen niemand leben konnte. Arbeitende Kranke erhielten besseres Essen…"
Charlotte H., die zu den arbeitenden Kranken zählte und die Mordaktion (…) überlebte, schrieb in einem Brief: "… Das Essen bestand morgens aus zwei dünnen Schnitten, mittags einer dünnen Suppe, ohne Fett und Mehl mit schwimmenden Kartoffelschalen, abends wieder eine Wassersuppe… Daß bei dieser Ernährung eine schnelle Abmagerung eintreten mußte, ist wohl erklärlich." Die zur Ermordung bestimmten Kranken erhielten außer dieser Wassersuppe vermutlich keine andere Nahrung. Bei Kranken, die durch den Nahrungsentzug bereits körperlich stark geschwächt waren, genügte eine geringe Dosis Tabletten, um sie zu töten. (…)
Über die hygienischen Verhältnisse in Hadamar berichtete Charlotte H.: "Wenn Transporte ankamen, reichten die Betten nicht aus, es mußten Strohsäcke heruntergebracht werden…" Die Strohsäcke befanden sich in einer Kammer im ersten Stock, neben dem Tagesraum der Patienten. "… Die verseuchten und urindurchtränkten Strohsäcke wurden niemals erneuert. Weder gewaschen noch mit frischem Stroh erneuert. Die Schlafdecken wurden nie gelüftet.
Es gab nur alle 14 Tage frische Leibwäsche. Das Personal hat sich besonders vor den schmutzigen Arbeiten gedrückt. Alles mußten die sogenannten Arbeitskranken tun. Mit einem Kasernenton wurden uns von ihnen die Anordnungen zugeteilt. Und wehe, wer es wagte zu widersprechen. Der fiel in Ungnade. Die meisten Menschen… hatten einen sehr quälenden Hautausschlag. Frau M. hatte sich mit dem Hautausschlag angesteckt. Wodurch sie Schmerzen hatte. Und dadurch nicht mehr so arbeiten konnte. Statt wo diese Krankheit in sehr kurzer Zeit heilbar ist, hat man dieses sonst so frohe und hilfebereite Menschenkind auch ermordet. Also wurden auch die Insassen, wenn sie die körperlich schwere Arbeit nicht mehr leisten konnten, ermordet. Sie nützten die Not und die Krankheit, solange es möglich war, körperlich und finanziell aus…"
Die Zeugin beobachtete auch die Tötungsvorgänge und schilderte: "… Es wurden täglich mehrere ins Ermordungszimmer nach hinten gebracht. Mir schrie das Herz bei dem Anblick… Nachdem die Totgeweihten dort hineingebracht waren, erhielten diese zuerst die berüchtigten Tabletten in Wasser aufgelöst… Diese Tötung mit den Tabletten dauerte meistens 2-3 Tage. Wenn dies geschah, wußten alle, was vorging…" Nach mehreren Aussagen von Patienten sollen die Tabletten auch im Essen aufgelöst und verabreicht worden sein. (…)
Männliche Patienten zwang man, als Leichenträger zu arbeiten. Die Zeugin Erika B. hatte beobachtet, "… wie Kranke aus der Männerabteilung mehrmals täglich einen Sarg aus der Anstalt auf den Friedhof brachten, wo der Tote dann herausgenommen worden sei und der leere Sarg in die Anstalt zurückgebracht wurde…". (1)
Quelle
1. Daum, Monika (1996): Arbeit und Zwang, das Leben der Hadamarer Patienten im Schatten des Todes. in: Roer, Dorothee; Henkel, Dieter (Hg.): Psychiatrie im Faschismus. Die Anstalt Hadamar 1933-1945. Mabuse-Verlag, S. 173- 213, hier S. 199-202.
Fragen zu den Aussagen der Überlebenden:
Besprecht die Aussagen in Kleingruppen.
- Beschreibt die Arbeiten, die die Patientinnen und Patienten verrichten mussten. Wie war ihre Versorgung, was bekamen sie zu essen? Was mussten sie durch das Personal befürchten? Wie verhielt sich das Personal der Einrichtung insgesamt?
- Versucht die Gefühle, die der Text in euch auslöst, durch ein gemaltes Bild, einen Text, eine Skizze oder eine andere künstlerische Form darzustellen.
Euthanasie: Die Angehörigen
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Die Angehörigen
Viele Menschen, die als Patientin oder Patient in Anstalten lebten, hatten wenig oder keinen Kontakt zu ihren Angehörigen. Manche Angehörige hingegen besuchten ihr Familienmitglied, wann immer es möglich war. Je weiter der Krieg voranschritt, desto schwieriger war dies, zum Beispiel, da sich die Verkehrslage verschlechterte. Im Folgenden sind zwei Beispiele von sich sorgenden Angehörigen dargestellt. Es handelt sich um die Eltern des Mädchens Edith Sch. und um die Ehefrau von Georg S.. Sowohl Edith Sch. als auch Georg S. waren nur wenige Wochen Patientin bzw. Patient in Hadamar.
Beispiel 1: Edith Sch.
Edith Sch. wurde am 12. Juni 1936 in Gießen geboren und bereits am 30. Juni 1940 in der Landesheilanstalt Scheuern aufgenommen. Die Diagnose lautete Hydrozephalus (Wasserkopf). Aus dem Briefkontakt der Eltern mit der Anstaltsleitung geht hervor, dass sie sich regelmäßig meldeten und ihr Kind besuchten, sooft es möglich war. Nach einem dieser Besuche schrieb Ediths Vater an den Anstaltsdirektor der Landesheilanstalt Scheuern:
Briefwechsel von Ediths Eltern mit dem Anstaltsdirektor der Landesheilanstalt Scheuern:
02.12.1941
"Sehr geehrter Herr Direktor!
(...) Meine Frau und ich waren dann auch nicht wenig erstaunt über das abgemagerte und schwache Kind. (...) Mir scheint, als ob Sie für diese Kinder nicht das erhalten, was anderen Kindern ausserhalb der Anstalt zugebilligt wird." (5)
Der Direktor antwortete daraufhin:
19.12.1941
"Sehr geehrter Herr Sch.!
(...) Ich kann Ihre und Ihrer Frau Sorge gut verstehen. Die Ernährung gerade dieser ganz schwachen Kinder ist durch die Kriegsverhältnisse besonders schwierig geworden. Da diese Kinder nicht kauen (...) verdaut der Körper nicht richtig und es gibt Verdauungsstörung. (...) Ich habe wegen Ihrer Besorgnisse eingehend mit dem Arzt gesprochen, der eine zweckentsprechendere und bekömmlichere Beköstigungsweise angeordnet hat, und nehme an, dass die Kleine daraufhin wieder besser verdauen und wieder kräftiger werden wird. (...) Ebenso lasse ich Ihnen die übersandte Milchkarte hierbei wieder zugehen. Es ist nicht angebracht, die Milch Ihrem gesunden Kind zu entziehen." (6)
Etwa ein Jahr später wandte sich die Mutter an die Anstaltsleitung:
24.11.1942
"Ich habe meinem vorletzten Paket ein Schreiben beigelegt, in dem ich Schwester Lina bat, mir doch einmal Nachricht zu geben über das Befinden meines Töchterchens Edith. Bis jetzt habe ich noch keinen Bescheid erhalten und bin in Sorge ob meine Pakete dort angekommen sind. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn sie mir in Kürze einmal schreiben würden, ob die Päckchen eingetroffen sind und ob Edith gesundheitlich auf der Höhe ist." (7)
Antwort des Direktors:
28.11.1942
"Sehr geehrte Frau Sch.!
Wenn Ihnen Schwester Lina auf Ihre Anfrage nicht geantwortet hat, dann liegt das wohl daran, dass es unserm Pflegepersonal im allgemeinen nicht gestattet ist, mit den Angehörigen der Pfleglinge in direkte briefliche Verbindung zu treten. Die Pakete sind jedenfalls alle eingegangen. Edith ist körperlich soweit ganz gut in Ordnung. Etwas besonderes liegt nicht vor bei ihr." (8)
Am 18. Februar 1943 wurde Edith nach Hadamar verlegt. Mit Datum vom 19. Februar 1943 informierte der Direktor der Landesheilanstalt Hadamar, Dr. Adolf Wahlmann, die Mutter darüber, es bestehe Lebensgefahr.
19.02.1943
"Sehr geehrte Frau Sch.,
Das körperliche Befinden Ihres Töchterchens Edith hat sich hier verschlechtert. Da ausgesprochene Herzschwäche besteht, ist Lebensgefahr nicht ausgeschlossen. Besuch ist gestattet." (9)
Frau Sch. eilte nach Hadamar und holte ihr Kind am 22. Februar 1943 gegen den Willen des Arztes aus der Landesheilanstalt.
"Ich bescheinige, dass ich mein Kind Edith Sch., geb. 12.6.36 zu Giessen, gegen den Willen des Arztes der Landesheilanstalt Hadamar aus der Anstalt genommen habe und darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass ich für alle Folgen die aus dieser Entlassung entstehen, aufzukommen habe." Unterschrift: Aenne Sch. (10)
Dr. Wahlmann vermerkte in der Akte: "Mutter kommt heute zu Besuch. Ganz uneinsichtig. Will das Kind mitnehmen. Entlassen." (11)
Edith Sch. starb wenige Tage später. Offenbar hatte sie bereits zu viele Beruhigungsmittel vom Personal erhalten. Nach Ediths Tod ermittelte die Staatsanwaltschaft Limburg gegen Aenne Sch.
Fragen zum Briefwechsel von Ediths Eltern mit dem Anstaltsdirektor:
Lest die Briefausschnitte aufmerksam durch.
- Was erfahrt ihr über die Ernährungssituation in den Anstalten?
- Warum schickte der Arzt die Milchkarte für das „gesunde Kind“ der Familie Sch. zurück?
- Edith war zum Zeitpunkt ihres Todes noch nicht einmal sieben Jahre alt. Setzt euch in Fünfergruppen zusammen und gestaltet eine Collage: Was meint ihr, welche Wünsche und Hoffnungen hatte Edith für ihr Leben? Was mochte sie gerne, was vermisste sie in den Jahren in Scheuern und Hadamar?
Beispiel 2: Georg S.
Die folgenden Briefausschnitte dokumentieren die Auseinandersetzung der Ehefrau von Georg S. mit der Anstaltsleitung in Hadamar.
Georg S., geboren am 8. November 1907 in Langen, wurde am 13. November 1942 von der Universitätsnervenklinik Frankfurt am Main in die Landesheilanstalt Eichberg aufgenommen. Elf Monate später, am 13. Oktober 1943, verlegte man ihn nach Weilmünster. Ein weiteres knappes Jahr später, im September 1944, kam er nach Hadamar.
Briefwechsel der Ehefrau von Georg S. mit der Anstaltsleitung in Hadamar:
Schreiben der Ehefrau an die Anstaltsleitung Hadamar:
04.10.1944
"Ich bin sprachlos das mein Mann Georg S. nach dort gekommen ist. Da ich weiss von anderen Seiten das Hadamar die letzte Station für diesen Mann ist, möchte ich Sie bitten die Leiche meines Mannes zu verbrennen die Urne hole ich mir dann Persönlich ab. Für die Kosten der Beerdigung komme ich Persönlich aus. Sie verlangen von mir eine Heiratsurkunde, leider kann ich Ihnen dieselbe nicht besorgen. Mein Traubuch gebe ich nicht aus den Händen. Da Sie dort ja auch wissen, dass Frankfurt a. M. nur aus Trümmern besteht. Jetzt nach Frankfurt zu fahren ist mit dem leben gespielt, denn die Züge werden zuviel beschossen. Auch möchte ich in die Stadt nicht zurück wo ich alles verloren hab, denn nochmals meine Trümmer ansehen nein." (12)
Antwort durch den Verwaltungsleiter Klein:
06.10.1944
"Ich bestätige den Empfang Ihres Briefes vom 4. ds. Mts. Es tut mir leid, Sie wegen Ihrer Bemerkung, dass Hadamar die letzte Station sei für Ihren Mann, gerichtlich belangen zu müssen. Sie werden dann Gelegenheit haben zu sagen, von wem Sie derartige Verleumdungen wissen. Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass wir eine staatliche Anstalt sind und wir uns derartige Verunglimpfungen nicht gefallen lassen können. Bezeichnender Weise haben Sie bereits im März und Juni d.Js. der Anstalt Eichberg mitgeteilt, dass Sie im Falle des Ablebens Ihres Mannes die Feuerbestattung der Leiche wünschen. Es sieht fast so aus, als würde der Tod Ihres Mannes gewünscht." (13)
Schreiben der Ehefrau an die Verwaltung der Landesheilanstalt Hadamar:
09.10.1944
"(...) Sie dürfen mich ruhig anzeigen. Ich weiss es von einem Pfleger der Nervenklinik. Der Pfleger B. hat mir erzählt, das mein Mann ein Jahr nach dem Eichberg kommt, ein Jahr nach Weilmünster und dann nach Hadamar, das wäre die letzte Station. Es hat auch alles zugetroffen. Sie Schreiben da als ob ich den Tod von meinem Mann wünsch, ich wünschte ich wäre noch mit meinem Mann zusammen denn wir haben eine sehr glückliche Ehe gehabt, sonst hätte ich nicht 7 Monate mein Mann in diesem Zustand daheim behalten. Hätte ich heut noch ein Heim (ist ausgebombt, die Verfasserin) dann würde ich mein Mann wieder nach hause holen. Ich habe aber in allen Heimen für meinen Mann gesorgt, und gehungert damit ich ihm zu Essen schicken konnte." (14)
Georg S. starb am 17. November 1944 angeblich an Marasmus paraliticus (Schwächezustand, Lähmung).
Fragen zum Briefwechsel der Ehefrau von Georg S. mit der Anstaltsleitung:
- Warum drohte der Verwaltungsleiter der Ehefrau, Frau S.?
- Wie erklärt ihr euch ihren Mut?
- Schreibt einen fiktiven Brief, den Frau S. nach dem Krieg an das Gericht hätte schreiben können. Wie hätte sie darin ihren Konflikt mit dem Verwaltungsleiter beschrieben?
Quellen:
4: Daum, Monika: Arbeit und Zwang, das Leben der Hadamarer Patienten im Schatten des Todes, in: Roer, Dorothee; Henkel, Dieter (Hg.): Psychiatrie im Faschismus. Die Anstalt Hadamar 1933-1945, S. 173-213, hier S.199-202
5: Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen (= LWV-Archiv), Bestand K12, AN 1585, Schreiben des Vaters an die Direktion v. 02.12.1941.
6: Ebd., Schreiben des Direktors an den Vater v. 19.12.1941.
7: Ebd., Schreiben der Mutter an die Direktion v. 24.11.1942.
8: Ebd., Schreiben des Direktors an die Mutter v. 28.11.1942.
9: Ebd., Schreiben Wahlmanns an die Mutter v. 19.02.1943.
10: Ebd., Bescheinigung der Entlassung Ediths gegen den Willen des Arztes v. 22.02.1943.
11: Ebd., Krankengeschichte v. 22.02.1943.
12: LWV-Archiv, Bestand 12, AN 2298, Schreiben der Ehefrau an die Direktion Hadamar v. 04.10.1944, orthographische Fehler im Original.
13: Ebd., Schreiben der Direktion an Ehefrau v. 06.10.1944.
14: Ebd., Schreiben der Ehefrau an Direktion v. 09.10.1944. Orthographische Fehler im Original.
Euthanasie: Gedenken - der Anstaltsfriedhof Hadamar
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Gedenken: Der Anstaltsfriedhof Hadamar
Die sogenannte "zweite Phase" der "Euthanasie"-Morde war nicht auf einzelne Anstalten begrenzt. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass in fast jeder psychiatrischen Einrichtung Patientinnen und Patienten zumindest grob vernachlässigt wurden. Dies führte in vielen Fällen zu ihrem Tod.
In einigen Einrichtungen, darunter Hadamar, wurde gezielt gemordet. Die ca. 4.500 Toten der Jahre 1942-1945 ließ das Hadamarer Personal auf einem eigens dafür angekauften Friedhof in Massengräbern beerdigen. Ermordet wurden in dieser Zeit aufgrund noch einmal erweiterter Kriterien zunehmend auch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sowie ihre Kinder, Menschen, die als sozial unangepasst galten, Kinder mit einem jüdischen Elternteil und Soldaten. Die US-Armee befreite die Anstalt am 26. März 1945.
Der Friedhof Hadamar seit 1945


Fragen zum Friedhof Hadamar seit 1945:
Vereinzelt waren Angehörige bei Beerdigungen anwesend. Sie sahen das Gräberfeld, mit einigen frischen Gräbern.
- Schreibt in Stichworten auf, was sie gedacht haben könnten. Tauscht eure Einträge mit eurer Nachbarin oder eurem Nachbarn aus.
- Schreibt einen Brief, den Herbert W. 1943 an einen Freund geschrieben haben könnte. Herberts Schwester ist Patientin der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar. Welche Befürchtungen wird Herbert W. seinem Freund mitgeteilt haben? Sah er einen Ausweg?
Fragen zum Friedhof 1945 und 2006:
Schaut euch die Fotos von 1945 und 2006 an.
- Diskutiert mit eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin, warum wohl das Psychiatrische Krankenhaus 2006 den Friedhof verändert hat.
- Diskutiert oder notiert euch, was Besucherinnen und Besucher, die 1970 zufällig auf den Friedhof gelangten, dort wohl sahen.
Fragen zu Gedenken:
Stellt euch vor, Henriette B., getötet 1943 in Hadamar durch überdosierte Beruhigungsmittel und begraben auf dem Friedhof, wäre die Großmutter eurer Nachbarin gewesen.
- Besprecht in kleinen Gruppen, wie ihr eure Nachbarin dabei unterstützen könnt, angemessen zu gedenken. Stellt eure Überlegungen in einer Statue dar, fertigt ein Bild oder eine Collage an. Stellt eure Ergebnisse den anderen Gruppen vor.
- Diskutiert anschließend, warum 1964 anders an die Opfer gedacht wurde als heute. Was vermutet ihr?
- Wäre der Friedhof 1964 anders gestaltet worden, wenn Angehörige dafür verantwortlich gewesen wären? Beachtet dabei, dass viele Angehörige wegen der NS-Rassenlehre auch noch viele Jahre nach dem Krieg nicht mit psychischen Krankheiten in Verbindung gebracht werden wollten. Notiert eure Ergebnisse und hängt sie an eine Pinnwand.
Euthanasie: Aussagen der Tatbeteiligten der ersten Mordphase
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der ersten Mordphase (Gasmorde) im zweiten Hadamar-Prozess 1947
Die nachfolgenden Texte sind Teile der Aussagen, die die in Hadamar Tatbeteiligten 1947 vor dem Frankfurter Landgericht machten. Es war der zweite Hadamar-Prozess. Bereits 1945 hatte es einen ersten Hadamar-Prozess gegeben, in Zuständigkeit der US-Armee.
Fragen zum zweiten Hadamar-Prozess:
- Lest die vier Aussagen durch. Wie empfindet ihr die Art und Weise dieser Schilderungen durch die Angeklagten? Angemessen oder eher unangemessen? Begründet eure Einschätzungen.
- Stellt anschließend gemeinsam Vermutungen darüber an, warum Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und Verwaltungsangestellte sich entschieden haben könnten, am Morden teilzunehmen bzw. ihren Anteil dazu beizutragen. Überlegt, welche Möglichkeiten und Zeitpunkte es für sie gegeben haben könnte, sich zu verweigern. Welche Möglichkeiten hätten sie in ihrer jeweiligen Position wohl gehabt, auszusteigen?
- In vielen Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg stellten die Gerichte fest, dass den Ärzten und Ärztinnen, Schwestern und Pflegern, die sich bei Mordaktionen verweigert hatten, in der Regel nichts passiert war. Warum meint ihr, gab es dennoch so wenige, die damals Nein sagten?
1. Angeklagter Gorgaß (Arzt):
"2-3 Autobusse mit verhängten Fenstern, die fuhren an der Seitentür vor. Wenn die Kranken zur Aufnahme kamen, dann setzte ich mich in den Untersuchungsraum; (…) Dann kamen sie in den sogenannten Warte- und Auskleideraum, da wurden sie entkleidet. Die Omnibusse waren meist mit Gleichgeschlechtlichen geladen, die kamen rein und wurden ausgezogen und weitergeführt zum Photographieren, dann dem Bürobeamten vorgeführt, der die Identifizierung vornahm. Das Photographieren geschah aus dokumentarischen Gründen, natürlich auch aus wissenschaftlichen Gründen. (…) Die Krankengeschichte und Photokopie des Meldebogens lagen dabei. An Hand dieses Bogens wurde der Kranke noch einmal exploriert. Bei schizophrenen Endzuständen, bei Schwachsinn bedarf es in den meisten Fällen keiner langen weiteren Untersuchung, um die Schwere der Erkrankung festzustellen. (…) Sie wurden unten in den Vergasungsraum geführt, der wie ein Duschraum aussah. Der Raum war als Duschraum eingerichtet, gekachelt. (…) Die Kranken nahmen dort Platz und glaubten, die würden gebadet, jawohl. (…)
Wenige Minuten dauerte der Vorgang. (…) Der Tod ist ein friedlicher. Es ist ein einfaches Schlafen. (…) Die Leute ermüden und verlieren alle Verbindungen mit der Außenwelt und schlafen dann ein. (…) Nach 5-10 Minuten waren sie tot, jawohl. Nach etwa 1-2 Stunden wurde frische Luft zugeführt und dann später konnte erst die Zelle geöffnet werden. Die Leichen wurden dann herausgebracht und in das Krematorium gebracht und eingeäschert.
Das Krematorium war ebenfalls im Keller. (…) Mehrere Leichen lagen da zusammen zur Verbrennung, so daß die Asche festzustellen da nicht möglich war, nein. (…) Jawohl, es stimmt, daß die Leute da gar nicht die Asche ihres Verstorbenen bekamen (…)." (15)
2. Angeklagter R. (Krankenpfleger):
"Ich habe die Kranken auskleiden helfen und brachte die bis zum Flur. Von dort aus kamen sie zum Arzt durch andere Pfleger. Vom Arzt wurden sie gewogen, gemessen, photographiert, und dann kamen sie in den Keller. Wir gingen mit ihnen nur bis zur Kellertreppe (…). Die Vergasung? Da waren ungefähr nach meiner Schätzung 30 oder 40, oder 50-60 drin, jedenfalls keine hundert und auch keine 90. Herr Gorgaß erklärte mir dann den Vorgang an der Gasvorrichtung, und ich schaute auch durch das Fenster zum Gasraum hinein. Es dauerte auch nicht lange, nachdem Gorgaß die Leitung aufgedreht hatte, dann fielen die Leute, die gestanden haben, die fielen um, und die anderen, die gesessen haben. Und dann war bald kein Leben mehr zu sehen." (16)
3. Angeklagte S. (Verwaltungsangestellte):
"Ungefähr 4-6 Wochen habe ich Trostbriefe geschrieben. Darüber hinaus hatte ich dann Urkunden, Trostbriefe und die Karteikarten zu machen, da standen die Todesursache und alles drin. Ich hatte also Karteikarten anzulegen, Sterbeurkunden zu schreiben und Trostbriefe. Die Trostbriefe wurden nach einem bestimmten Schema geschrieben; die Arbeit war ziemlich stur. (…) Die Ärzte haben manchmal Decknamen geführt. (…) Dr. Gorgaß den Namen Kramer (?) und Direktor Berner, glaube ich, Barth. Die Namen wurden lediglich bei den Unterschriften der Trostbriefe geführt." (17)
4. Angeklagte Sch. (Verwaltungsangestellte):
"In den Trostbriefen wurde noch angegeben, daß die Angehörigen eine Bescheinigung der Friedhofsverwaltung mitschicken sollten, und diese Bescheinigung bekam ich dann. Die eingehende Post habe ich darauf durchgesehen, wenn etwas von Urnen drin stand und die Bescheinigung der Friedhofsverwaltung da war, da habe ich das Nötigste dazu geschrieben. (…) Dann war noch eine Gruppe da, schrieben die Angehörigen da, daß sie damit einverstanden wären, wenn die Urne auf irgendeinem Friedhof beigesetzt wurde, da habe ich anhand eines Atlasses und einer Liste die größere Stadt herausgesucht, auf deren Friedhof Urnen beigesetzt wurden. (…) Da, wo die Angehörigen nichts bestimmten, das wurde auf dem Anstaltsfriedhof bestattet." (18)
Quellen:
15: 2. Hadamarprozess beim Landgericht Frankfurt am Main, 26.2.1947; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 12-14 und 17-19.
16: Ebd., S. 19.
17: 2. Hadamarprozess beim Landgericht Frankfurt am Main, 3.3.1947; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 17.
18: Ebd., S. 21 f.
Euthanasie: Aussagen der Tatbeteiligten der Jahre 1942-1945
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der Jahre 1942-1945 im zweiten Hadamar-Prozess 1947
Auch die Tatbeteiligten der zweiten Mordphase in Hadamar standen 1947 vor Gericht.
Um den grausamen Alltag in der Tötungsanstalt Hadamar nachzuvollziehen, an dem das Personal beteiligt war, könnt ihr zunächst die Aussagen einiger Überlebender lesen.
Teilt die Gruppe anschließend in drei Kleingruppen ein. Jede Gruppe stellt eine der folgenden Personen dar:
- Anwalt bzw. Anwältin des oder der Tatbeteiligten,
- Freund oder Freundin des oder der Tatbeteiligten,
- Mitangeklagter oder -angeklagte und Zellennachbar oder -nachbarin des oder der Tatbeteiligten.
Fragen zu den Tatbeteiligten:
- Überlegt in den Gruppen, was diese Person vor Gericht über die Tatbeteiligten und die Taten ausgesagt haben könnte. Lest euch gegenseitig eure fiktiven Aussagen vor. Überlegt, wie überzeugend sie euch erscheinen, ob ein Gericht auf dieser Grundlage die Angeklagten frei gesprochen hätte. Lest sie danach den anderen Gruppen vor. Erstellt gemeinsam eine erste Liste der verwendeten Argumente und Erklärungen. Diskutiert diese.
- Lest anschließend jeder und jede für sich die vier Aussagen der Täter und Täterinnen aus den Prozess-Protokollen. Erstellt anschließend gemeinsam eine zweite Liste mit verwendeten Erklärungen und vergleicht sie mit der ersten. Wo sind Ähnlichkeiten, wo Unterschiede?
- Überlegt für euch selbst: Woher kommen meine Vorstellungen über die Täterinnen und Täter? Besprecht eure Überlegungen mit eurer Sitznachbarin oder eurem Sitznachbarn.
Angeklagter Wahlmann (Arzt):
"Ich bin 1876 geboren, bin 70 Jahre alt. Seit 1903 bin ich Arzt. (…) Im Jahre 1933 trat ich zur Partei über. (…) Alles trat über und da habe ich mich auch entschlossen. Ich hatte keine innere Bindung und Ideen dafür und habe das auch zu meinem großen Nachteil bewiesen. (…) Nun kam ich nach Hadamar und blieb dort bis 1936. Und zwar mußte ich 1936 mit 60 Jahren in Pension gehen, weil ich schwere Herzmuskelentartung hatte, furchtbares Herzklopfen und Schwächezustände. (…) Meine Zeit der Pensionierung dauerte bis zum Jahre 1940. (…) Eines Tages (1942, die Verf.) erschien B. (…) und sagte mir, Hadamar ist wieder neu eingerichtet als Anstalt. (…) Ich ernenne Sie in Hadamar zum Chefarzt. Ich sagte zunächst: Herr Landesrat, das ist ja sehr ehrend für mich, aber warum werde ich nicht zum Direktor ernannt? (…) Ich habe im Einzelfall der Oberpflegerin oder dem Oberpfleger erklärt, daß der und der hin ist und der und der nicht. (…) Die Konferenz war vor der Visite. Es kann sein, daß ich dann gesagt habe, der und der kommt morgen dran, und daß diese Fälle dann am anderen Morgen bei der Konferenz durchgesprochen wurden. Ich glaube, die Oberpflegerin oder der Oberpfleger gaben mir einen Zettel für die, die heute gemacht werden sollten, im Anschluß an die gestrige Besprechung." (19)
Angeklagte S. (Verwaltungsangestellte):
"Ich heiße Paula S. und bin 35 Jahre alt. (…) Ich war lediglich auf die Partei gestoßen, weil ich Angestellte der Gauleitung Frankfurt a. M. wurde. (…) Ich war seinerzeit in Urlaub und brachte meine jüngste Schwester zum Landjahr weg. Ich wurde aus dem Urlaub zurückgerufen, da ich den Auftrag erhielt, nach Berlin zu fahren. (…) (S. arbeitete drei Jahre in Mordanstalten, die Verf.) Darauf gab ich meine Kündigung. Landesrat Bernotat kam dann eines Tages und Bernotat meinte, ich solle nicht gleich so heftig sein, und außerdem sei Personalmangel überall und ich sollte in der Anstalt verbleiben. Da sagte ich Bernotat, ich hätte wiederholt versucht, herauszukommen, er möchte mich gehen lassen. Daraufhin wurde mir meine Kündigung genehmigt zum September 1943. (…)
Ich habe es nachher auch nicht gewagt, einfach dem Dienst fernzubleiben, wie ich da eingesperrt worden wäre, also eine Möglichkeit auf diese Weise wegzukommen, wäre mir nicht gegeben gewesen. Ich habe immer wieder gekündigt, aber ohne Erfolg. Daß man mich in ein Konzentrationslager sperrt, das war mir auch gesagt worden. (…)" (20)
Angeklagter R. (Krankenpfleger):
"Es mag auch sein, daß ich in die Partei ging, daß ich vielleicht Arbeit bekäme. (…) Es hat aber lange gedauert, bis 1936, bis ich Arbeit in der Landesheilanstalt Weilmünster bekam. (…) Als Lernpfleger kam ich nach Weilmünster. Das Examen haben wir einheitlich mit „ausreichend“ bestanden. (…) Eingesetzt wurde ich in Herborn als Pfleger. (…) Am 28. Juli 1941 wurde ich versetzt nach Hadamar. (…) Das Gewissen geschlagen? Das schon. Aber es hatte doch alles gar keinen Zweck, sich darüber zu äußern, denn wo gab es für einen Pfleger eine Stelle, wo er sich beschweren konnte?! (…)
Dann habe ich mir wieder gesagt: der Arzt, der die Anordnungen gibt als Vorgesetzter, der trägt die Verantwortung. Denn es wird wohl jedem von den Pflegern und Pflegerinnen bekannt sein, daß es bei den Schulungen immer geheißen hat: den Anordnungen des Arztes ist unbedingt Folge zu leisten als Vorgesetzter. Weigert sich ein Pfleger oder führt er irrtümlicherweise etwas Falsches aus, so wird der betreffende Pfleger als unbrauchbar bezeichnet. (…) Für richtig gehalten, daß man Geisteskranke in dem Zustand nicht mehr weiter ernährt? Ja, Gedanken habe ich mir schon gemacht. Aber die Patienten, die man hatte, die waren körperlich so schlecht, daß sie manchmal überhaupt nicht mehr stehen konnten, daß sie zum großen Teil verhungert sind. Und da war es doch eine Wohltat von meiner Auffassung aus, daß solche Leute möglichst schnell starben.
Daß sie verhungert waren? Diese schlechte Ernährung. Die Leute bekamen weiter nichts wie Wassersuppe, (…) Brennnesselsuppe und dergleichen." (21)
Angeklagte K. (Krankenschwester):
"Nach Kriegausbruch erhielt ich durch den Polizeipräsidenten in Berlin einen Bereitstellungsschein, ich sollte mich für einen Einsatz, der u. U. einige Wochen dauern könne, bereithalten. Im Dezember 1939 folgte dann die Aufforderung, mich am 04. Januar 1940 im Columbushaus zu melden. (…) Wir wurden von einer Frau A. und Herrn H. empfangen, dann eröffnete uns Herr Blankenburg (…), welche Aufgabe uns erwartete. Er stellte uns vor die Tatsache, daß wir zur Durchführung einer Euthanasieaktion einberufen seien. Es wurde dabei vorgestellt, daß wir als erfahrene Pfleger aus den Heil- und Pflegeanstalten die Krankheitsbilder ja genau kennten und beurteilen könnten, daß es für die Schwerstkranken eine Erlösung sei, wenn man ihr Leben vorzeitig beende. Wir wurden dann gefragt, ob wir mitarbeiten wollten und nach einer Viertelstunde Bedenkzeit vereidigt, und unter Androhung schwerster Strafen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Herr Blankenburg hatte uns vorher gesagt, Hitler habe ein Gesetz ausgearbeitet, das bereits fertig vorliegt, es werde allerdings mit Rücksicht auf den Krieg zunächst nicht veröffentlicht werden; deshalb sei die Geheimhaltung notwendig.
(…) daß ich des Mordes angeklagt werde, bitte ich das Gericht um Gerechtigkeit! Man kann mich unmöglich verantwortlich machen, für diese Gesetze des Dritten Reiches, daß dessen Bestimmungen nicht vollkommen waren, ist schließlich nicht Sache einer Schwester. Vor der Schwester am Krankenbett steht der Arzt. Ob er ein Brustwickel, Einlauf, Herztropfen oder Schlafmittel verordnet. In diesem Falle den Gnadentod. Ich habe den Gnadentod nicht als Mord betrachtet. Und bilde mir ein, daß wirklich nur der, wer Mitleid hat und mitleiden kann dieses versteht. (…) Ich möchte hiermit darauf hinweisen auf die schwere Verantwortung. Infektion und schwer Geisteskranke zu pflegen (sic!). Dazu kommt, daß auf meine Station nur hoffnungslose Fälle kamen. Ich bitte, dieses alles zu berücksichtigen." (22)
Quellen:
19: 2. Hadamarprozess vor dem Landgericht Frankfurt am Main, 24.2.1947, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 2,3,22,25,26.
20: 2. Hadamarprozess vor dem Landgericht Frankfurt a. M., 3.3.1947, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 17,19.
21: 2. Hadamarprozess vor dem Landgericht Frankfurt am Main, 26.2.1947, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 17,18,22,23.
22: Steppe, Hilfe: „Mit Tränen in den Augen zogen wir dann die Spritzen auf …“, in: Steppe, Hilde (Hg.): Krankenpflege im Nationalsozialismus, 6. Aufl., Frankfurt am Main 1991, S. 135 f.
Euthanasie: Widerstand
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Widerstand
Einige Menschen wagten es, ihre Meinung über das Morden zu äußern. Manche waren bekannte Persönlichkeiten, wie der Münsteraner Bischof Clemens Graf von Galen, andere waren einfach „normale“ Bürger und Bürgerinnen, wie Paula F. aus Hadamar. Graf von Galen war innerhalb der Kirchen vermutlich der erste, der öffentlich über die NS-„Euthanasie“-Verbrechen predigte. Seine Predigt trug mutmaßlich zur Beendigung der Tötungen durch Gas bei.
Predigt von Bischof Clemens Graf von Galen:
"Seit einigen Monaten hören wir Berichte, daß aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden. Regelmäßig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, die Leiche sei verbrannt, die Asche könne abgeliefert werden. Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, daß diese zahlreichen unerwarteten Todesfälle von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, daß man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe sogenanntes 'lebensunwertes' Leben vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert. Eine furchtbare Lehre, die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen will, die die gewaltsame Tötung der nicht mehr arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel, unheilbar Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt. (…)
So müssen wir damit rechnen, daß die armen wehrlosen Kranken über kurz oder lang umgebracht werden? Warum? Nicht weil sie ein todeswürdiges Verbrechen begangen haben, nicht etwa, weil sie ihren Wärter oder Pfleger angegriffen haben, so daß diesem nicht anderes übrig blieb, als daß er (…) in gerechter Notwehr dem Angreifer mit Gewalt entgegentrat. (…) Nein, nicht aus solchen Gründen müssen jene unglücklichen Kranken sterben, sondern darum, weil sie nach dem Urteil irgendeines Amtes, nach dem Gutachten irgendeiner Kommission „lebensunwert“ geworden sind, weil sie nach diesem Gutachten zu den 'unproduktiven Volksgenossen' gehören. Man urteilt: Sie können nicht mehr Güter produzieren, sie sind wie eine alte Maschine, die nicht mehr läuft, sie sind wie ein altes Pferd, das unheilbar lahm geworden ist, sie sind wie eine Kuh, die nicht mehr Milch gibt. (…) Arme Menschen, kranke Menschen, unproduktive Menschen meinetwegen! Aber haben sie damit das Recht auf das Leben verwirkt? Hast du, habe ich nur solange das Recht zu leben, solange wir produktiv sind, solange wir von anderen als produktiv anerkannt werden? Wenn man den Grundsatz aufstellt und anwendet, daß man den „unproduktiven“ Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach werden! Wenn man die unproduktiven Menschen töten darf, dann wehe den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre gesunden Knochen eingesetzt, geopfert und eingebüßt haben! Wenn man die unproduktiven Mitmenschen gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren braven Soldaten, die als Schwerkriegsverletzte, als Krüppel, als Invaliden in die Heimat zurückkehren! Wenn einmal zugegeben wird, daß Menschen das Recht haben, „unproduktive“ Mitmenschen zu töten, (…) dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben." (24)
Fragen zur Predigt:
- Lest den Text der Predigt. Arbeitet die Gründe heraus, die von Galen gegen die Tötung von Menschen mit Behinderungen aufführt.
- Welche Argumentation, glaubt ihr, leuchtete den Zuhörenden damals am meisten ein? Begründet Eure Entscheidungen, diskutiert sie in Vierergruppen. Schreibt die Argumente und Eure Begründungen in Stichworten auf Kärtchen und ordnet sie alle zusammen an einer Pinnwand an.
Fragen zu Paula F.:
Lest den Text über Paula F. und überlegt, warum sie so viel Mut hatte.
Text über Paula F.:
Paula F., Jahrgang 1919, aus Hadamar, arbeitete 1941 als Verkäuferin in Limburg. Sie wußte von den Gasmorden und den Verbrennungen auf dem Mönchberg (Hügel, auf dem die Heil- und Pflegeanstalt sich befand, die Verfasserin) und hatte auch miterlebt, wie die Kranken erst mit der Bahn und dann mit den Bussen ankamen. Während einer Mittagspause im Spätsommer 1941 fand in Limburg folgende Unterhaltung zwischen ihr und den Kolleginnen statt: Der Vater von zwei Kolleginnen, der als Patient auf dem Hofgut Schnepfenhausen (gehörte zur Anstalt, die Verfasserin) gelebt hatte, verstarb plötzlich. Die Kolleginnen fragten Paula F., ob es wahr sei, daß in Hadamar Menschen vergast und dann verbrannt würden. Paula F. antwortete, daß es stimme und sich der Bischof von Münster in seiner Predigt heftigst gegen diese Krankenmorde ausgesprochen hätte. Einige Wochen später fragte die Gestapo Paula F. in einem Verhör nach der von Galen-Predigt, von der sie eine Abschrift besaß. Am 6. November 1941 wurde sie verhaftet und in das Frankfurter Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Dort hielt man sie bis zum 7. Februar 1942 gefangen. Ohne Gerichtsverhandlung kam die damals 22-jährige anschließend für ein halbes Jahr in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Nach ihrer Entlassung aus dem KZ, am 15. August 1942, mußte Paula F. in Frankfurt ein Papier unterschreiben, daß es ihr gutgegangen sei und sie nichts über das Lager berichten würde. Wieder in Hadamar wurde Paula F. vorerst von den Leuten gemieden; sie durfte nicht mehr als Verkäuferin arbeiten und wurde deshalb zur Akkordarbeit in einer Blechwarenfabrik verpflichtet. Nach eigener Einschätzung ist Paula F. als abschreckendes Beispiel für die restliche Hadamarer Bevölkerung verhaftet und in ein KZ gesperrt worden. (25)
Paula F. lebte bis zu ihrem Tod (2004) in Hadamar. Sie trat häufig als Zeitzeugin auf und berichtete über ihre Erlebnisse von 1941/42.
Fragen zum Verhalten der Bevölkerung:
Überlegt euch, wie die Hadamarer Bevölkerung es fand, dass Paula F. immer wieder als Zeitzeugin über ihre Erlebnisse von 1941/42 berichtete. Diskutiert alle zusammen darüber.
Quellen:
24: Zitiert nach Klee, Ernst (Hg.):Dokumente zur "Euthanasie", Frankfurt am Main 1986, S. 194-198.
25: Landeswohlfahrtsverband Hessen (Hg.): Verlegt nach Hadamar a.a.O., S. 159
Euthanasie: Nach dem Krieg
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Nach dem Krieg: Verweigerte Entschädigung für "Euthanasie"-Opfer
Nach dem Ende des "Dritten Reiches" gab es eine Reihe von Prozessen gegen viele Angestellte von Tötungsanstalten und "T4"-Gutachter ("Aktion T4" bezeichnet die erste Phase der Anstaltsmorde). Einige von ihnen bekamen Haftstrafen, andere wurden freigesprochen. Diejenigen, die verurteilt worden waren, wurden meist sehr frühzeitig aus der Haft entlassen. Manche von ihnen übernahmen bald wieder verantwortliche Aufgaben im Bereich der Psychiatrie.
Die "Euthanasie"-Opfer hingegen erhielten nach dem Krieg – und bis heute – keine Entschädigung. Sie galten lange Jahre nicht als Verfolgte des Nationalsozialismus.
Text Bund der "Euthanasie"-Geschädigten:
1987 gründete sich der Bund der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten, eine Opfervereinigung. Er erreichte mehr öffentliches Interesse für die Belange der Opfer und konnte im Laufe der Jahre die rechtliche Situation verbessern.
Selbstdarstellung des Bundes der "Euthanasie"-Geschädigten
Vor der Gründung des Bundes hatten Zwangssterilisierte und "Euthanasie"-Geschädigte keinen Kontakt untereinander. Während der NS-Zeit war es verboten, über das Erlebte zu reden, aber auch nach der Zeit des Nationalsozialismus blieb bei den Opfergruppen diese Isolation.
Situation der Betroffenen heute
Zwangssterilisierte und "Euthanasie"-Geschädigte, die durch den nationalsozialistischen Massenmord an Kranken, Behinderten und sozial Stigmatisierten ihre nächsten Angehörigen verloren haben, gehören zu den ausgegrenzten NS-Opfern und sind bis heute nicht den anerkannten NS-Verfolgten gleichgestellt. Sie tragen zudem schwer an dem Vorurteil, sie selbst oder ihre Familien seien "minderwertig" oder "lebensunwert" gewesen.
Die Opfer der damaligen Zwangsmaßnahmen sind hochbetagt, viele leben sehr zurückgezogen. In Gesprächskreisen versuchen wir, sie aus ihrer Isolation herauszuführen, damit sie untereinander über ihre Probleme reden können. Wir leisten betreuende Hilfe. Bei Anträgen und Behördenangelegenheiten helfen wir und forschen in Archiven nach Beweisunterlagen.
Durch unsere Arbeit haben wir schon vielen Betroffenen helfen können. Falls Ihnen zwangssterilisierte Menschen oder Angehörige von "Euthanasie"-Opfern bekannt sind, weisen Sie bitte auf unseren Bund hin. (26)
Gefühle: Scham und Ausgeliefertsein
Menschen, die unfreiwillig sterilisiert, also unfruchtbar gemacht wurden, fühlten in der Regel eine große Scham. Deshalb verheimlichten sie ihre Sterilisation vor anderen. Der Bund der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten hat viele Interviews geführt, um Aussagen von Opfern zu erhalten. Im folgenden Text schildert ein Mann seine persönlichen Erlebnisse.
Text Anonymer Bericht eines Opfers
"Meine Kinderzeit verlebte ich bei meiner Mutter. Sie hatte sich als junge Frau scheiden lassen. 1937 hatte ich eine Arbeitsstelle in einer Maschinenfabrik. Dort wurde ich sehr ausgenützt, was Folgen hatte. Wochenlang konnte ich nicht richtig schlafen und hatte starke Kopfschmerzen. Am 1. Oktober war ich mit meiner Mutter bei Bekannten zu einer kleinen Feier eingeladen. Das war ein schöner Nachmittag. Wir kamen gegen Mitternacht nach Hause und ich konnte nicht einschlafen. Etwa eine Stunde danach bekam ich plötzlich Herzschmerzen und fast gleichzeitig einen Schüttelfrost. Mutter machte sich sehr große Sorgen und brachte mir erst mal Baldriantropfen. Mein Zustand besserte sich nicht, sondern ich bekam große Angstzustände und dachte, ich müsste sterben. Als meine Mutter merkte, daß sie mich nicht beruhigen konnte, ging sie mit mir zum Arzt in das nahegelegene Heiligengeist-Hospital. Dort wurde ich nicht aufgenommen, sondern in ein weiteres Krankenhaus verlegt. Zwei Tage danach konnte ich erfahren, daß ich mich in der Frankfurter Nervenklinik befand. Meine Mutter wurde beruhigt, und man sagte ihr, daß sie mich bald wieder abholen könnte. Nach der Untersuchung bekam ich ein Beruhigungsmittel, ein Pfleger brachte mich zur Station Nr. 6, wo ich auf einem Feldbett noch ein paar Stunden schlafen konnte. Nachdem es mir wieder besser ging, hoffte ich, bald entlassen zu werden. Am Tag bekam ich dann in dem Saal ein Bett. Es fiel mir auf, daß sich einige Kranke merkwürdig benahmen. (…) Erst als es mir wieder besser ging, ich mich gesund fühlte, merkte ich, daß alle Türen abgeschlossen waren. Ich bat einen Pfleger, mir doch meine Kleider zu bringen, er sagte aber, ich müßte erst behandelt werden und darum noch hier bleiben. Es war sehr schockierend und traurig, daß man mich hier eingesperrt hatte. In der Nacht vom 5. zum 6. Oktober konnte ich nicht schlafen, trotz Schlafmittel. Ich war durstig und wollte zur Toilette gehen. Als ich aufstand und hingehen wollte, lief mir ein Pfleger nach, legte mir von hinten ein Handtuch um den Hals und zog so fest, daß ich fast keine Luft bekam und auf den Rücken fiel. Ein zweiter Pfleger kam dazu, kniete sich auf mich und preßte mir einen Becher mit einer schrecklichen Flüssigkeit an den Mund, die ich austrinken mußte. Dann wurde ich wieder ins Bett gebracht, und am nächsten Tag stand im Pflegebericht: ‚W. hat das Bett eingenäßt’. Nach diesem Erlebnis wurde ich sehr ängstlich und habe mein Bett nur verlassen, wenn ich dazu aufgefordert wurde. (…) Danach bekam ich 23 Insulinschockbehandlungen, die angeblich gut vertragen wurden. Meine Mutter stellte den Antrag, mich zu entlassen. Die Insulinbehandlung wurde dann langsam eingestellt und am 23.12. konnte Mutter mich mit nach Hause nehmen, mußte aber einen Revers unterschreiben.
Der behandelnde Arzt hatte nach diesem Aufenthalt die Sterilisation beantragt. Mutter hat alles versucht, die Sterilisation zu verhindern. Sie hat sogar einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der uns beim Erbgesundheitsgericht vertreten hat. Die Verhandlung wurde dann vom Erbgesundheits-Obergericht in Frankfurt entschieden. In dieser Verhandlung wurde unsere Beschwerde gegen den Beschluß zurückgewiesen. Es war nicht daran zu rütteln, ich sollte eine Schizophrenie haben. Nach diesem Urteil schrieb Mutter noch einen Brief an den Reichs- und Preußischen Minister des Inneren, in dem sie darum bat, meine Sterilisation zu unterlassen. Hier bekam sie aber wieder einen abschlägigen Bescheid. Gleichzeitig kam die Aufforderung, daß ich zur Unfruchtbarmachung umgehend in ein Krankenhaus gehen muß. Wir waren sehr enttäuscht, daß es nicht gelungen war, die Sterilisation zu verhindern. Nachdem ich wieder gesund war, hielt ich es für ein Unrecht, daß man mich zu lebenslanger Unfruchtbarkeit verurteilt hat, nur weil ich einmal 83 Tage lang in einer Nervenklinik behandelt wurde. Mit der ärztlichen Diagnose Schizophrenie war ich schon ausreichend bestraft. Das Wertvollste, was ein Mensch außer seinem Leben besitzt, die Möglichkeit, sich fortzupflanzen, wurde mir durch das Urteil genommen. Ich mußte mich damit abfinden. (…)
Im Dritten Reich durfte ich keine gesunde Frau heiraten und habe durch Zufall eine sterilisierte Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet, aber die Ehe war nicht gut, und 1948 trennten wir uns wieder. Bald danach lernte ich meine jetzige Frau kennen. Nach geraumer Zeit erzählte ich ihr, daß ich sterilisiert wurde, und zu meiner größten Überraschung berichtete sie, daß auch sie wegen einer Schizophrenie im Dritten Reich unfruchtbar gemacht wurde.
Trotz der damaligen Diagnose Schizophrenie konnte ich mit Gottes Hilfe 46 Jahre, davon 44 Jahre in einer Firma, berufstätig sein. Mit meiner zweiten Frau bin ich nun schon 40 Jahre glücklich verheiratet. Aber die Spuren des Eingriffs haben sich trotz aller Zweisamkeit nicht auslöschen lassen und belasten uns immer wieder aufs neue." (27)
Fragen zum Anonymen Bericht:
- Streicht die Textpassagen an, in denen der Mann über seine Gefühle spricht. Versucht eine Geste oder Pose für seine Empfindungen zu finden. Welches Gefühl überwiegt? Könnt ihr euch erklären, warum der Bericht anonym verfasst wurde?
- Menschen in den psychiatrischen Einrichtungen fühlten sich in der Regel sehr ausgeliefert. Arbeitet aus dem Text die Schilderungen heraus, die sich auf die Erfahrungen des Mannes in der Nervenklinik Frankfurt beziehen, bevor er zwangsweise sterilisiert wurde.
- Schreibt seine Erfahrungen, die ihr mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins verbindet, auf Kärtchen. Analysiert den Ausdruck „sich ausgeliefert fühlen“, schaut euch dazu die einzelnen Teile an. Versucht, das Gegenteil zu definieren. Was, glaubt ihr, musste sich in psychiatrischen Einrichtungen verändern, damit Menschen sich nicht mehr ausgeliefert fühlten?
Das Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein
Der Text "Psychiatrie-Reform: Auf halbem Weg stecken geblieben" wurde 2001 im Deutschen Ärzteblatt von Petra Bühring veröffentlicht.
Fragen zum Gefühl von Ohnmacht und Ausgeliefertsein:
- Lest zunächst den Text. Streicht dann die Passagen an, in denen in den 1970er Jahren die Zustände in psychiatrischen Großkrankenhäusern kritisiert wurden. Unter welchen Umständen denkt ihr, fühlten sich in den 1970ger Jahren Menschen in der Psychiatrie ausgeliefert? Vergleicht dies mit euren vorherigen Ergebnissen.
- Überlegt alle zusammen: Wie ist heute das Leben von Menschen, die eine psychische Erkrankung haben? Wo begegnen sie euch im Alltag? Wie kann es gelingen, dass sie von der Gesellschaft mit Respekt behandelt werden?
Text Psychiatrie-Reform: Auf halbem Weg stecken geblieben
Die 1971 vom Deutschen Bundestag eingesetzte Expertenkommission "Psychiatrie-Reform" untersuchte die Zustände in den psychiatrischen Großkrankenhäusern. Sie beklagte katastrophale Zustände: Viele psychisch Kranke und Behinderte lebten damals unter elenden, zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen. Knapp 60 Prozent der Patienten fristeten dort mehr als zwei Jahre ihres Lebens. Fast 40 Prozent waren in Schlafsälen mit mehr als elf Betten untergebracht – für ihre persönlichen Habseligkeiten stand oftmals nur eine Schachtel unter dem Bett zur Verfügung. Die hygienischen Verhältnisse waren unzumutbar, die Personaldecke dünn, Möglichkeiten zur Nachsorge kaum vorhanden.
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Heinz Häfner, (…) erinnert sich an seinen Eintritt 1949 als Doktorand auf der Männerstation der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München: "Ich konnte meine Erschütterung kaum verbergen. Einige Männer schrieen laut, rüttelten an der Tür oder bedrängten den Stationsarzt mit Entlassungswünschen. Die Stimmung schwankte zwischen Resignation und Aggression. Zeitweilig konnten die Pfleger den Saal nur mit vorgehaltener Matratze betreten."
(…) Viele chronisch psychisch Kranke leben am Rand der Armutsgrenze. Sozialrechtlich sind sie längst nicht körperlich Kranken gleichgestellt. Am wenigsten verändert hat sich am Verständnis der Gesellschaft für Krankheiten, die nicht sichtbar sind und deshalb bedrohlich wirken, für Menschen, die anders sind. Vor der Psychiatrie-Reform wurde das Andersartige einfach weggeschlossen. Das ist zumindest heute nicht mehr selbstverständlich. (28)
Quellen:
26: euthanasiegeschaedigte-zwangssterilisierte.de/bez_wir-ueber-uns.html (17.09.2010).
27: Bund der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten e.V. (Hg.): Ich klage an. Tatsachen- und Erlebnisberichte, Detmold 1989, S. 18-21.
28: www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp (8.9.2010)
Euthanasie: Politische Teilerfolge
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Politische Teil-Erfolge
Der Bund der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten e. V. schreibt:
"Am 24. Mai 2007 haben wir endlich die Rehabilitation der Zwangssterilisierten und "Euthanasie"-Geschädigten erreichen können, d. h. sie von dem Stigma zu befreien, in der NS-Zeit als "lebensunwert" gegolten zu haben und durch das rassistische Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verfolgt worden zu sein. Die Erklärung, über die im Bundestag in unserem Sinne abgestimmt wurde, hat die Bezeichnung Bundestagsdrucksache 16/3811(PDF, KB, nicht barrierefrei). Diese Rehabilitation der Zwangssterilisierten und "Euthanasie"-Geschädigten ist, das muss man klar sagen, ein Kompromiss, der mit den Stimmen der CDU/CSU und SPD erreicht wurde.
Die jetzt gültige Rechtssituation geht davon aus, dass das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses nie in der Bundesrepublik Deutschland gegolten habe und dass es von Anfang an nicht mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar gewesen sei. Man geht aus heutiger Sicht davon aus, dass diese Rechtssituation seit Beginn der Bundesrepublik Deutschland bestanden habe. Dies ist die juristische Sicht aus der Perspektive des Jahres 2007.
Dass die historische Entwicklung eine andere war, haben die Opfer durch die vielen vergeblich geführten Prozesse und die Einschätzung ihres Erlittenen in der Vergangenheit als "nicht-typisches NS-Unrecht" erfahren.
Die Interpretation dieser Bundestagsdrucksache und die dazugehörenden Kommentare bedeuten für die Opfer außerdem, dass sie ab Mai 2007 als rassisch verfolgte Opfergruppe gelten müssen. Ein seit vielen Jahren angestrebtes Ziel haben wir damit erreicht." (29)
Fragen zur Entschädigung (1):
Wie aus den Texten des Bundes der "Euthanasie"-Geschädigten deutlich wurde, erhielten die Opfer keine Entschädigung.
- Recherchiert in Gruppen im Internet, welche Opfergruppen durch das Bundesentschädigungsgesetz entschädigt wurden. Welche anderen Opfergruppen (außer den "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten), die nicht entschädigt wurden, fallen euch ein? Kennt ihr Menschen in eurer Umgebung, die Familienmitglieder, Freundinnen oder Freunde oder Bekannte hatten, die Opfer des Nationalsozialismus gewesen sein könnten?
- Lest den Text-Auszug aus dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz (AKG). Überlegt, warum die Bundesregierung den Opfern durch dieses Gesetz eine geringe finanzielle Unterstützung zugesprochen hat.
- Überlegt in euren Gruppen, warum nach dem Ende des Nationalsozialismus nicht alle Opfer gleich behandelt wurden.
Text: Allgemeines Kriegsfolgengesetz (AKG) - Härterichtlinien
a) Geltungsbereich
Leistungen nach den Richtlinien der Bundesregierung über Härteleistungen an Opfer von nationalsozialistischen Unrechtsmaßnahmen im Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG) - AKG-Härterichtlinien - vom 1. September 2004 (BAnz. S. 20921), zuletzt geändert am 13. September 2005 (BAnz. S. 15698), sollen Personen zugute kommen, die nicht Verfolgte im Sinne des § 1 BEG sind, aber wegen ihrer körperlichen oder geistigen Verfassung oder wegen ihres gesellschaftlichen oder persönlichen Verhaltens vom NS-Regime als Einzelne oder als Angehörige von Gruppen angefeindet wurden und denen deswegen Unrecht zugefügt wurde. Die Leistungen sollen Härten mildern, die trotz der gesetzlichen Entschädigungsregelung nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz wegen Versäumung gesetzlicher Antragsfristen oder aus anderen Gründen verblieben sind.
Nach den AKG-Härterichtlinien können einmalige Beihilfen bis zu 2.556,46 € gewährt werden (IV 2. d). Darüber hinaus sehen die Richtlinien für besondere Ausnahmefälle, in denen außergewöhnliche Umstände die Gewährung einer weitergehenden Hilfe erforderlich machen, laufende Leistungen vor.
Die AKG-Härterichtlinien bezwecken keinen finanziellen Ausgleich für Kriegsschäden, reine Vermögensschäden sowie für Vorkriegs- oder kriegsbedingte Lebensbeeinträchtigungen aller Art.
b) Antragsberechtigte
Antragsberechtigt nach diesen Richtlinien sind alle durch NS-Unrecht geschädigten Personen, die nicht Verfolgte im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes sind.
Zu den Antragsberechtigten gehören verschiedene Gruppen von Personen, die durch rechtsstaatswidrige Handlungen von Rechtsträgern des Deutschen Reichs geschädigt wurden. Hier sind zunächst die Opfer von Sterilisation und Euthanasie zu nennen.
Ferner kann es sich um Personen handeln, die von NS-Staats- oder Parteiorganen als "Arbeitsscheue", "Arbeitsverweigerer", "Asoziale", "Homosexuelle", "Wehrkraftzersetzer", "Wehrdienstverweigerer", "Kriminelle", "Landstreicher" angesehen und deshalb NS-Unrechtsmaßnahmen ausgesetzt waren, z. B. in Konzentrationslagern oder ähnlichen Einrichtungen gefangen gehalten wurden. Fälle psychiatrischer Verfolgung kommen ebenfalls in Betracht. Auch der so genannte Jugendwiderstand kann je nach Einzelfall zu Leistungen nach den Richtlinien führen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist zu einzelnen dieser Personengruppen und Schadenssachverhalte Folgendes zu bemerken:
Zwangssterilisierte
Zwangssterilisierte, die die Voraussetzungen für Entschädigungsleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz nicht erfüllen, erhalten aufgrund der AKG-Härterichtlinien auf Antrag eine einmalige Beihilfe von 2.556,46 € sowie laufende monatliche Zahlungen in Höhe von 120 €.
(…)
Euthanasie Opfer
Die so genannten Euthanasie-Anstalten werden als Haftstätten im Sinne der Richtlinien angesehen, weil in ihnen die Menschenwürde regelmäßig missachtet wurde und die Insassen in ständiger physischer und psychischer Bedrohung leben mussten. Hierzu rechnen die Anstalten Grafeneck/Württ., Hartheim bei Linz, Sonnenschein bei Pirna, Bernburg/Saale, Hadamar bei Limburg und Brandenburg/Havel.
Auch hinterbliebene Ehegatten und Kinder von NS-Opfern, die in so genannten Euthanasie-Anstalten umgekommen sind, können unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere wenn ihnen Unterhaltsleistungen entgangen sind, Leistungen erhalten. (30)
Fragen zur Entschädigung (2):
Erst 2007 wurden die Opfer von Zwangssterilisation und NS-"Euthanasie"-Morden als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde, nachdem es bisher in der Bundesrepublik lediglich außer Kraft gesetzt worden war, abgeschafft. Eine gesetzliche Grundlage zur materiellen Entschädigung der Opfer gibt es allerdings auch heute nicht, sodass sie weiterhin nur einen kleinen Betrag nach den AKG-Härterichtlinien erhalten können.
- Lest in Gruppen die Entscheidung des Deutschen Bundestages zur Aufhebung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses im Jahre 2007.
- Überlegt, was es für die Angehörigen von „Euthanasie“-Opfern und für zwangssterilisierte Menschen bedeutet hat, dass sie lange Zeit nicht als NS-Verfolgte anerkannt wurden und dass sie auch nach der Anerkennung so gut wie keine materielle Entschädigung erhielten und nicht mit den anderen Verfolgtengruppen gleichgestellt wurden.
Text: Bundestags-Drucksache 16/3811
Berlin, den 13. Dezember 2006
Volker Kauder, Dr. Peter Ramsauer und Fraktion, Dr. Peter Struck und Fraktion
Drucksache 16/3811 – 4 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode:
Das "Erbgesundheitsgesetz", die hierzu ergangenen Ausführungsverordnungen, die Kommentare, die Rechtsprechung und die ausführenden Taten selbst müssen als Einheit betrachtet werden. Eine Unterscheidung zwischen Gesetz und Anwendung setzt eine funktionierende Gewaltenteilung voraus. Diese Voraussetzung war im totalitären nationalsozialistischen Staat nicht gegeben. (…) Das Gesetz selbst ist Ausdruck der nationalsozialistischen Ideologie, welche die unantastbare Würde jedes Menschen verneint, indem sie den Einzelnen der rassistischen Wahnidee der "Reinigung des Volkskörpers" unterordnet und als letzte Konsequenz "ausmerzt". Nicht nur die auf diesem Gesetz beruhenden Gewaltmaßnahmen, sondern das diese Gewaltmaßnahmen legalisierende „Erbgesundheitsgesetz“ selbst ist somit als Ausdruck der menschen- verachtenden nationalsozialistischen Auffassung vom "lebensunwerten Leben" anzusehen.
Die Gültigkeit des "Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 (RGBl. I S. 529; geändert durch die Gesetze vom 26. Juni 1935, RGBl. I S. 773, und 4. Februar 1936, RGBl. I S. 119) endete mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes, soweit es dem Grundgesetz widersprach (Artikel 123 Abs. 1 GG). Die wenigen danach noch gültigen Vorschriften über Maßnahmen mit Einwilligung des Betroffenen wurden durch Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes vom 18. Juni 1974 (BGBl. I S. 1297) aufgehoben. Das Gesetz ist damit definitiv in keiner Weise mehr existent. Die Besorgnis mancher Opferverbände, das Gesetz könne wieder in Kraft gesetzt werden, ist unbegründet.
Der Deutsche Bundestag hat in seinen Entschließungen vom 5. Mai 1988 (Bundestagsdrucksache 11/1714) und 29. Juni 1994 (Bundestagsdrucksache 12/7989) festgestellt, dass die auf der Grundlage des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ durchgeführten Zwangssterilisationen nationalsozialistisches Unrecht waren. Der Deutsche Bundestag ächtete in diesen Entschließungen diese Maßnahmen als Ausdruck der inhumanen nationalsozialistischen Auffassung vom „lebensunwerten Leben“. Der Rechtsausschuss stellte zuvor in der Begründung seiner Beschlussempfehlung vom 26. Januar 1988 (11/1714) fest, dass "das Gesetz in seiner Ausgestaltung und Anwendung nationalsozialistisches Unrecht ist". In der 13. Wahlperiode wurden mit dem Gesetz vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2501) sämtliche Beschlüsse der "Erbgesundheitsgerichte", welche eine Unfruchtbarmachung anordneten, aufgehoben.
(…)
II. Der Deutsche Bundestag bekräftigt erneut, dass die im "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 vorgesehenen und auf der Grundlage dieses Gesetzes durchgeführten Zwangssterilisierungen nationalsozialistisches Unrecht sind. Er bekräftigt erneut die Ächtung dieser Maßnahmen als Ausdruck der inhumanen nationalsozialistischen Auffassung vom „lebensunwertem Leben“.
III. Der Deutsche Bundestag erstreckt diese Feststellung und diese Ächtung ausdrücklich auf das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 selbst, soweit dieses Zwangssterilisierungen rechtlich absichern sollte. Die gesetzlich vorgegebene Handlungsanweisung und die aufgrund dieser Anweisung durchgeführten Zwangsterilisationen können vor dem Hintergrund einer totalitären Staatspraxis nicht voneinander getrennt werden. Beides ist Ausdruck der gleichen verbrecherischen national-sozialistischen "Weltanschauung". Beidem gebührt die gleiche Ächtung. (…)
IV. Der Deutsche Bundestag stellt fest, dass mit dem "Erbgesundheitsgesetz" ein Weg beschritten wurde, der mit grauenhafter Notwendigkeit zielgerichtet in das "Euthanasie"-Massenmordprogramm führte. Die hohe Todesrate bei den Zwangssterilisationen enthüllt überdeutlich den Charakter des "Erbgesundheitsgesetzes" als Vorstufe des "Euthanasie"-Massenmords.
V. Der Deutsche Bundestag bezeugt den Opfern der Zwangssterilisierung und ihren Angehörigen erneut seine Achtung und sein Mitgefühl. Er tut dies in der Annahme, durch die nun erfolgte Ächtung des "Erbgesundheitsgesetzes" selbst jegliche Zweifel an seinem Willen zu einer umfassenden Genugtuung und Rehabilitierung der Betroffenen beseitigt zu haben. (31)
Fragen zum Menschenbild:
Die Gedanken, die hinter dem "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" standen, waren mit Kriegsende nicht vergessen. Vielmehr gab es einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich vorstellen konnten, auch in den 1950er Jahren bestimmte Personengruppen sterilisieren zu lassen.
- Lest den folgenden Text und besprecht unklare Stellen.
- Arbeitet in Vierergruppen und schreibt eure Ergebnisse jeweils auf eine Wandzeitung: Warum wollten Ärzte und Ärztinnen auch nach 1945 so genannte "verwahrloste Jugendliche" sterilisieren? Schreibt auf, welches Bild von Menschen sich dahinter verbirgt. Wie verträgt sich dies mit dem Grundgesetz, das seit 1949 in Kraft ist? Glaubt ihr, dieses Gedankengut findet man heute noch? Wie soll in einer Demokratie damit umgegangen werden?
Text über das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses"
Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde nach dem 8. Mai 1945 durch die Kontrollratsgesetze nicht aufgehoben. (…) Eine Aufhebung erfolgte nicht. Ein Großteil der NS-Gesetzgebung, dazu gehörte auch dieses Gesetz, rettete sich so in die neue Bundesrepublik hinüber und bestand lange Zeit fort. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, mit dessen Hilfe rund 350.000 Personen sterilisiert worden waren, hatten die Besatzungsmächte somit nicht explizit außer Kraft gesetzt oder aufgehoben, und im Nürnberger Juristenprozess war es – zugunsten der Angeklagten – sogar als "vernünftigerweise diskutierbar" bezeichnet worden. Weil man aber die Erbgesundheitsgerichte aufgelöst hatte, gab es keine Institutionen mehr, die das nach wie vor als gültig (da "nicht-nationalsozialistisch") angesehene Gesetz anwenden konnten. Wenn es auch in erster Linie die Ärzteschaft war, die darauf drängte, angesichts der vielen "verwahrlosten Jugendlichen" endlich wieder Zwangssterilisationen durchzuführen, trieb die Sorge um die Erbgesundheit des deutschen Volkes auch Juristen um. 1951 forderte die Hamburger Justizbehörde, dass "die Frage ob und wann Unfruchtbarmachung zulässig sei, von den gesetzgeberischen Organen des Bundes neu entschieden werden müsse, unter gebührender Beachtung der bereits vor 1933 von der Wissenschaft festgelegten Grundsätze und Erfahrungen der Eugenik". (32)
Quellen:
29: euthanasiegeschaedigte-zwangssterilisierte.de/bez_wir-ueber-uns.html (17.09.2010).
30: www.bundesfinanzministerium.de/nn_4394/DE/BMF__Startseite/Service/Broschueren__Bestellservice/Das__Ministerium/40144,templateId=raw,property=publicationFile.pdf (17.09.2010).
31: dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/038/1603811.pdf (17.09.2010).
32: Scheulen, Andreas: Zur Rechtslage und Rechts-Entwicklung des Erbgesundheitsgesetzes 1934, in: Hamm, Margret (Hg.): Lebensunwert – zerstörte Leben. Zwangssterilisation und "Euthanasie" (= Eine Publikation des Bundes der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten e. V. Detmold), S. 212-219, hier S.212 f.
Euthanasie: Nachrufe 2010
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Nachrufe 2010
Die Verbrechen an Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen wurden in der Regel von Ärzten und Ärztinnen sowie Schwestern, Pflegern und Verwaltungsangestellten begangen. Ihr Mitwirken war zumeist freiwillig. Auch nach Ende des Nationalsozialismus, sowohl direkt in den Nachkriegsprozessen als auch viele Jahrzehnte später, äußerten sie zumeist keine Reue. Im Folgenden findet ihr drei Texte, die im Deutschen Ärzteblatt abgedruckt waren und sich aufeinander beziehen: einen Nachruf, eine Gegendarstellung zum Nachruf und eine Reaktion auf die Gegendarstellung. Sie sind Teil einer Auseinandersetzung im Jahr 2010 über die Rolle eines Arztes während des Nationalsozialismus.
Fragen zu den Nachrufen:
- Bildet drei Gruppen und lest jeweils einen der drei Texte. Sprecht in der Kleingruppe über euren Text. Erzählt anschließend den anderen beiden Gruppen, was in dem Text besonders hervorgehoben und was nicht erwähnt wurde, euch aber interessiert hätte. Welche Tätigkeiten werden in dem Nachruf, in der Gegendarstellung und in der Reaktion auf die Gegendarstellung betont, zu welchen Tätigkeiten oder Jahren wird wenig gesagt?
- Überlegt gemeinsam, warum Prof. Dr. Sewering und auch andere Tatbeteiligte keine Reue zeigten. Schreibt die Überlegungen stichwortartig auf Kärtchen und heftet sie an eine Pinnwand.
- Was für einen Nachruf hätten Angehörige von Opfern für Prof. Dr. Sewering geschrieben? Schreibt, jede und jeder für sich, einen kurzen Entwurf. Wer möchte, kann ihn vorlesen.
Text: 1. Ärzteschaft trauert : Nachruf
Die Ärzteschaft trauert um Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Joachim Sewering, der am 18. Juni im Alter von 94 Jahren verstorben ist. Der Internist für Lungen- und Bronchialheilkunde war Arzt aus Berufung, mit menschlichem Verständnis und nicht bloß "Mediziner". Mehr als fünf Jahrzehnte lang hat er sich über seine ärztliche Tätigkeit hinaus für die Belange der Ärzteschaft und für eine gute Versorgung der Patienten eingesetzt.
Nach der Schulausbildung studierte Hans Joachim Sewering in München und Wien Medizin und ließ sich nach Staatsexamen, Promotion und anschließender Tätigkeit als Arzt im Krankenhaus 1947 in Dachau in eigener Praxis nieder. Er wurde bereits 1951 in den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns gewählt, deren Vorstandsvorsitzender er von 1972 bis 1992 war. (…)
Von 1955 bis 1991 war Sewering Präsident der Bayerischen Landesärztekammer und Mitglied des Vorstands der Bundesärztekammer, von 1959 bis 1973 deren Vizepräsident, von 1973 bis 1978 Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages. 1991 wurde er nach 36-jähriger Mitwirkung im Vorstand der Bundesärztekammer zu dessen Ehrenmitglied gewählt.
Bereits in den 50er Jahren hat Sewering maßgebliche Reformvorstellungen in die Approbationsordnung für Ärzte eingebracht, wie die Ausbildung in kleinen Gruppen am Krankenbett und das ständige Gespräch zwischen Lehrenden und Lernenden zur Überprüfung des Wissenstandes. (…) Die ärztliche Tätigkeit sah er stets eingebettet in das soziale Sicherungssystem und den freiheitlich demokratischen Rechtsstaat. Hervorzuheben sind seine Initiativen zum Ausbau der Vorsorgemedizin als auch der programmierten Nachsorge sowie zur Qualitätssicherung. Auf seine Anregung wurden in allen Landesärztekammern Gutachterkommissionen oder Schlichtungsstellen gebildet, die bei Verdacht auf ärztliche Behandlungsfehler angerufen werden können. In der Bundesärztekammer richtete er die Abteilung Fortbildung und Wissenschaft ein.
(…) In zahlreichen Veröffentlichungen hat Sewering, Honorarprofessor für Sozialmedizin und ärztliche Rechts- und Berufskunde, zu medizinisch-wissenschaftlichen, gesundheits- und sozialpolitischen Themen Stellung genommen. Die Technische Universität München verlieh ihm die Ehrendoktorwürde. Neben zahlreichen weiteren Ehrungen erhielt er 1992 die Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft.
Hans Joachim Sewering vereinte politisches Gespür mit Intelligenz, Fantasie und Realitätssinn. Mit Überzeugungskraft, genauem Aktenstudium und immensem Fleiß, Beständigkeit und Verlässlichkeit hat er das Vertrauen bei Partnern und sogar Kontrahenten erworben. Stets an der Sache orientiert, hat er sich um den Erhalt eines freiheitlichen Gesundheitswesens und um die Wahrung ethischer Normen ärztlichen Handelns verdient gemacht.
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe, Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Karsten Vilmar
Text: 2. Gegendarstellung zum Nachruf von Prof. Dr. Hoppe und Prof. Dr. Vilmar
Sehr geehrter Herr Prof. Hoppe, sehr geehrter Herr Prof. Vilmar,
der Nachruf auf Hans Joachim Sewering im Deutschen Ärzteblatt enthält keinen Hinweis auf die Rolle, die er als Arzt in der Zeit des Nationalsozialismus gespielt hat. Angesichts der Bemühungen der Bundesärztekammer, zu einer Aufarbeitung der Medizin im Nationalsozialismus beizutragen und den Opfern der nationalsozialistischen Medizinverbrechen gegenüber historische Verantwortung zu übernehmen, ist das Verschweigen der NS-Vergangenheit Sewerings schwer nachvollziehbar. Den Unterzeichnenden ist daher die folgende Ergänzung historischer Fakten wichtig.
Hans Joachim Sewering war, wie durch medizinhistorische Arbeiten seit langem belegt ist, Mitglied der SS seit 1933 und der NSDAP seit 1934. 1942 wurde er Assistenzarzt des Tuberkulosekrankenhauses in Schönbrunn bei Dachau und betreute zugleich die verbliebenen Pfleglinge der Associationsanstalt der Franziskanerinnen, in deren Gebäuden das Tuberkulosekrankenhaus eingerichtet worden war. Zwischen Juni 1943 und Februar 1945 tragen mindestens neun Einweisungen in die Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar, deren zentrale Rolle für die „Euthanasie“-Morde in Oberbayern damals in weiten Kreisen bekannt war, seine Unterschrift. Fünf der verlegten Patienten und Patientinnen starben in Eglfing-Haar entweder in der Kinderfachabteilung oder aber im Rahmen der Hungereuthanasie, unter ihnen die 14-jährige Babette Fröwis, die nach Sewerings ärztlichem Zeugnis aufgrund ihrer Unruhe nicht mehr für Schönbrunn geeignet erschien. Anfang der 1990er Jahre versuchte Professor Sewering, die Verantwortung für diese Verlegung den Nonnen von Schönbrunn aufzubürden.
Unabhängig davon, wie man Sewerings Handlungsweise in Schönbrunn rechtlich oder moralisch bewertet, so ist es der Umgang mit den Opfern und ihren Angehörigen, der zu Beginn der 1990er Jahre, als Sewerings Verwicklung in die NS-„Euthanasie“ einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, unangemessen erscheinen musste. Für Sewering stand damals viel auf dem Spiel, nämlich seine Position als designierter Präsident des Weltärztebundes, auf die er aufgrund internationaler Proteste dann doch verzichten musste. Ein Wort des Bedauerns über das Geschehene wäre zu diesem Zeitpunkt nicht zuviel gewesen.
Aus diesem Grunde können die abschließenden Worte des Nachrufs, nämlich dass Hans Joachim Sewering sich um die Wahrung ethischer Normen ärztlichen Handelns verdient gemacht habe, doch nur eine beschränkte Geltung beanspruchen. Hierzu gehört unserer Auffassung nach auch die Übernahme historischer Verantwortung gegenüber den Opfern der nationalsozialistischen "Euthanasie"-Verbrechen und ihren Angehörigen durch die deutsche Ärzteschaft. In diesem Sinne kann die Unvollständigkeit des Nachrufs auf Professor Sewering als Rückschritt angesehen werden.
Die unterzeichnenden Ärztinnen und Ärzte, Medizinhistoriker/innen, Wissenschaftshistoriker/innen und Psychotherapeut/innen möchten Sie, sehr geehrter Herr Prof. Hoppe und sehr geehrter Herr Prof. Vilmar, bestärken, die historische Aufarbeitung der Medizinverbrechen und der Rolle der Medizin im Nationalsozialismus und ihrer Nachwirkungen nach 1945 weiter zu fördern und voranzubringen. In diesem Sinne stehen wir Ihnen, ohne persönlich anklagen oder verurteilen zu wollen, aber doch um Offenlegung der historischen Fakten bemüht, vonseiten der professionellen Medizingeschichte gerne zur Verfügung.
PD Dr. med. Gerrit Hohendorf, sowie viele weitere Unterzeichner/innen
Text: 3. Reaktion auf die Gegendarstellung
Die Kritik, die der Nachruf auf Prof. Dr. med. Hans-Joachim Sewering bei Medizinhistorikern, Lesern und in den Medien gefunden hat, macht einige Anmerkungen erforderlich: Das Deutsche Ärzteblatt hat über den Tod Sewerings in Heft 26/2010 am 2. Juli 2010 berichtet. In dieser Nachricht wurden, zwei Wochen vor Erscheinen des Nachrufs, auch die Vorwürfe erwähnt, Sewering sei durch Einweisungen in die Heilanstalt Eglfing-Haar in "Euthanasie"-Morde in der Zeit des Nationalsozialismus verstrickt. Über die Recherchen von Historikern und Journalisten zu dem Thema hat das D(eutsche) Ä(rzteblatt) in den vergangenen Jahren mehrfach berichtet.
Als Ergänzung dieser Meldung habe ich Herrn Prof. Dr. med. Karsten Vilmar und Herrn Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, die Nachfolger Sewerings im Amt des Präsidenten der Bundesärztekammer, um eine Würdigung der Verdienste Sewerings in der ärztlichen Berufs- und Standespolitik gebeten. Beide Autoren stehen außerhalb jeglichen Verdachts, die Aufarbeitung der Verbrechen von Ärzten in der NS-Zeit blockieren zu wollen. In Vilmars Amtszeit begann die lange überfällige aktive Beschäftigung mit der Rolle der ärztlichen Körperschaften in der NS-Diktatur. Hoppe hat 2008 bei einer Tagung des Instituts für Geschichte der Medizin der Universität Gießen gesagt, die Erkenntnis „dass Ärztinnen und Ärzte nicht nur weggesehen und geschwiegen haben, sondern aktiv an der systematischen Ermordung von Kranken und sogenannten gesellschaftlichen Randgruppen mitgewirkt haben, ist nicht erträglich“. Eine vollständige Aufarbeitung der Gräuel stehe noch aus. Die Bundesärztekammer (BÄK) hat gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium in diesem Jahr zum dritten Mal einen Forschungspreis für Arbeiten zur Geschichte der Ärzte während der NS-Diktatur ausgeschrieben. Im Auftrag der BÄK arbeitet zudem eine Expertenkommission unter Leitung von Prof. Dr. Robert Jütte, Institut für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart, an einem Forschungsbericht "Medizin und Nationalsozialismus". Zu den Themenfeldern gehören "Euthanasie und Krankenmord", "Menschenversuche" und "Zwangssterilisation". Diese und andere Forschungsarbeiten werden auch ihren Niederschlag im Deutschen Ärzteblatt finden.
Heinz Stüwe, Chefredakteur Deutsches Ärzteblatt
Quellen:
Alle Texte: Deutsches Ärzteblatt 2010, www.aerzteblatt.de (14.09.2010).
Euthanasie: Gedenkstätten und Menschen mit Lernschwierigkeiten
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Gedenkstätten und Menschen mit Lernschwierigkeiten
Bei der Einrichtung der NS-"Euthanasie"-Gedenkstätten wurden die Opfergruppen kaum mit einbezogen. Seit 2003 hat sich die Gedenkstätte Hadamar auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die häufig als Menschen mit geistigen Behinderungen bezeichnet werden, geöffnet. Sie selbst möchten lieber Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt werden, weil das ihre Schwierigkeiten gut beschreibt.
Seitdem gibt es Ausstellungstexte in Leichter Sprache, eine bessere Ausschilderung und einen Aufzug für Menschen mit einer Gehbehinderung. Seit 2003 haben mehr als 2.000 Menschen mit Lernschwierigkeiten die Gedenkstätte besucht und sich über die NS-"Euthanasie"-Verbrechen informiert.
Fragen zu Bildungsangeboten für Menschen mit Lernschwierigkeiten:
- Recherchiert im Internet zu dem Begriff "Menschen mit Lernschwierigkeiten".
- Als in der Gedenkstätte ein Konzept für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt wurde, haben viele Leute gefragt: Muss man denen das zeigen? Diskutiert mit eurer Nachbarin oder eurem Nachbarn, was sie damit gemeint haben könnten. Notiert eure Vermutungen auf Kärtchen und hängt sie im Plenum an eine Pinnwand.
- Lest die Aussagen der Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Bildungsangebot in der Gedenkstätte und notiert auf Karten, wie es für sie war, die Gedenkstätte Hadamar zu besuchen.
Text: Aussagen von Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Bildungsangebot in der Gedenkstätte Hadamar
"Lernen ist für alle Menschen wichtig. Sich mit der Geschichte zu befassen, ist auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten interessant. (…) Uns ist dadurch klar geworden, dass viele von uns damals den Krieg nicht überlebt hätten."
"Für mich war's halt eben sehr, wie gesagt, erschütternd auf der einen Seite, aber auch sehr interessant, zu erleben (...) Man hört zwar so viel, über Bücher, oder aber auch über Filme, wie 'Mein Kampf', zum Beispiel. Wo dann eben diese Nazizeit geschildert, aber man kennt sich trotzdem nicht aus und ich find das sehr gut, dass diese Möglichkeit in Hadamar möglich ist, dass man da hin gehen kann und sich mal genau informieren lässt und zeigen lässt, ja."
"Aber wir müssen uns nicht gerade ausruhen und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man, den solche Gedenkstätten haben. Also praktisch sozusagen, ne Mahnung bleiben." (34)
Fragen zu Inklusion und Menschen mit Lernschwierigkeiten:
- Überlegt, ob in eurer Schule auch Menschen mit Lernschwierigkeiten Schüler und Schülerinnen sind oder, wenn ihr nicht mehr in die Schule geht, ob an eurer Schule Menschen mit Lernschwierigkeiten waren. Wenn nicht, wo gehen sie in die Schule?
- Erarbeitet in Kleingruppen einen Vorschlag, was sich verändern müsste, damit auch Menschen mit Lernschwierigkeiten eure Schule besuchen können.
- Sucht im Internet nach dem Begriff "Inklusion". Stellt eure vorherigen Ergebnisse damit in einen Zusammenhang.
Quelle:
34: Aussagen aus Interviews, geführt von Uta George im Jahr 2005.
Euthanasie: Fragen zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Fragen zum Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses:
- Welche Menschen waren von dem Gesetz betroffen? Sucht die euch unbekannten Krankheiten und Behinderungen, die in Paragraf 2 (2) genannt werden, im Internet.
- Schreibt den Titel des Gesetzes auf eine Wandzeitung. Sammelt Assoziationen zu jedem einzelnen Wort des Titels. Warum wohl wählten die Gesetzgeber diesen Namen? Was wollten sie damit deutlich machen?
- Bei dem "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" handelte es sich um ein Gesetz, dass wir heute als Unrecht bezeichnen, da es nicht vereinbar ist mit den Menschenrechten; in diesem Gesetz wurden bestimmte Personengruppen zu Menschen mit weniger Rechten erklärt. - Welche Voraussetzungen waren notwendig, um ein solches Unrechtsgesetz überhaupt erlassen zu können? Tauscht euch mit eurer Nachbarin, eurem Nachbarn aus.
- Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Massenmorde wurde 1948 von den Vereinten Nationen die "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" verkündet. - Schaut in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nach: Wo und wie versuchen die Verfasserinnen und Verfasser, durch die internationale Einigung auf allgemein gültige Menschenrechte in Zukunft solches Unrecht zu verhindern?
Euthanasie: Aufnahmebogen
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aufnahmebogen
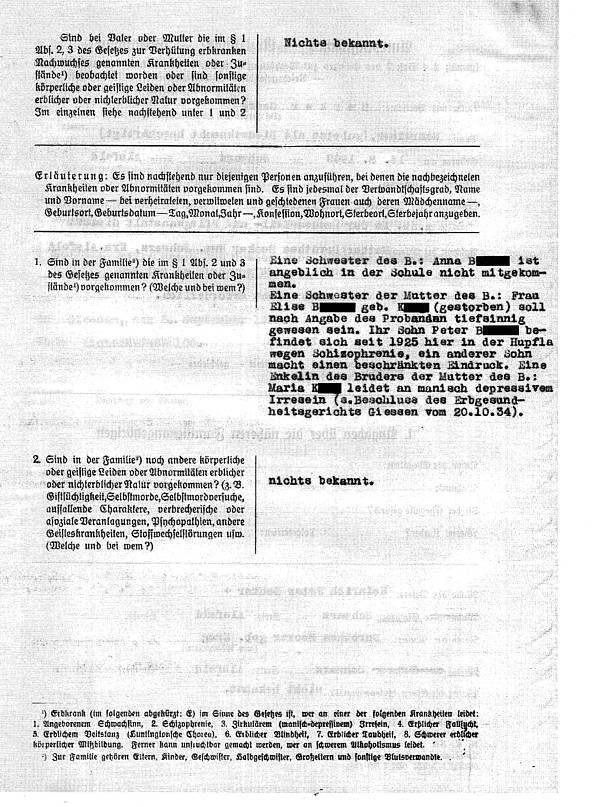
Euthanasie: Fragen zum Aufnahmebogen
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Fragen zum Aufnahmebogen
Überlegt zu zweit:
Wie wird die Familie von Georg B. beschrieben? Sucht die Ausdrücke heraus, die euch auffallen. Welchen Eindruck hinterlassen sie bei euch?
Euthanasie: Beschluss Erbgesundheitsgericht Gießen
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Beschluss Erbgesundheitsgericht Gießen
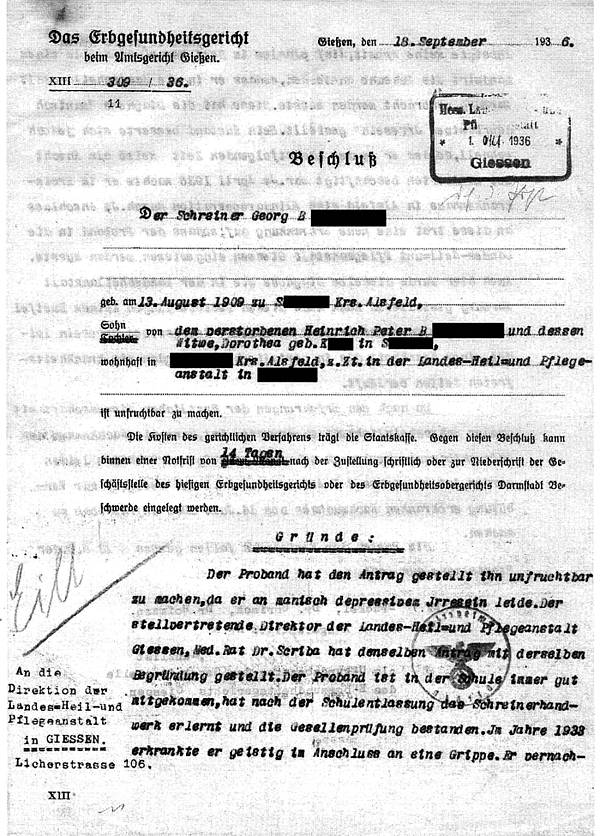
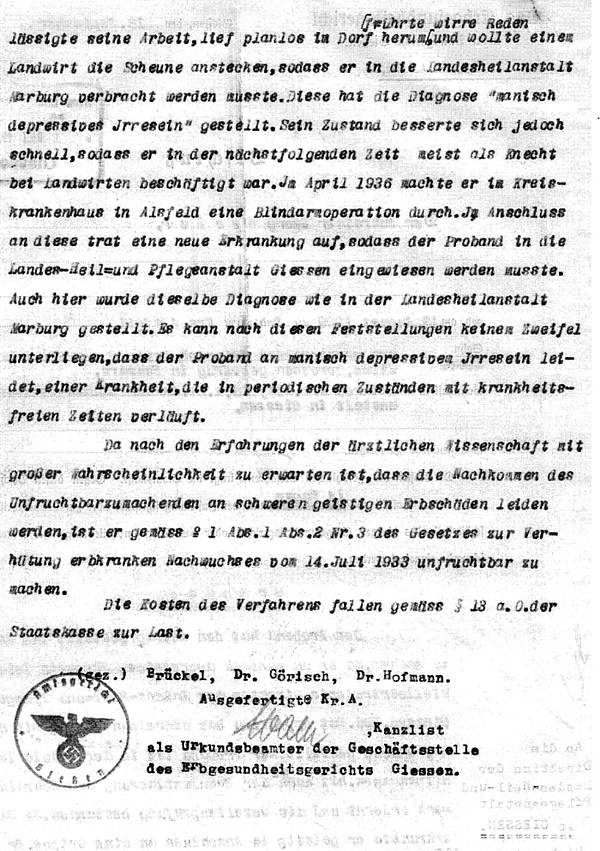
Euthanasie: Fragen zum Beschluss
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Fragen zum Beschluss:
- Lest die Begründung für die Entscheidung des Erbgesundheitsgerichtes Gießen. Welche Gründe nennt es für die Sterilisation von Georg B.? Haben diese etwas mit der Beschreibung seiner Familie (siehe Dokument "Aufnahmebogen") zu tun?
- Stellt euch vor, Georg B. und seine Geschwister hätten diese Begründung gelesen. Wie hätten sie ihre Gefühle wohl beschrieben?
- Wie schon der Titel verrät, gingen die Verfasser des Gesetzes davon aus, dass alle im "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" erwähnten Krankheiten und Behinderungen erblich seien. Welche Ängste und Überlegungen könnte das bei der Familie von Georg B. ausgelöst haben?
- Denkt noch einmal an den Beginn der Verfolgung von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen: Was hätten Angehörige an bedrohlichen oder problematischen Einstellungen oder politischen Veränderungen für ihre Angehörigen bemerken können? Schreibt eure Überlegungen auf Kärtchen und hängt sie an eine Pinnwand.
Euthanasie: Brief von Adolf Hitler
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Brief von Adolf Hitler
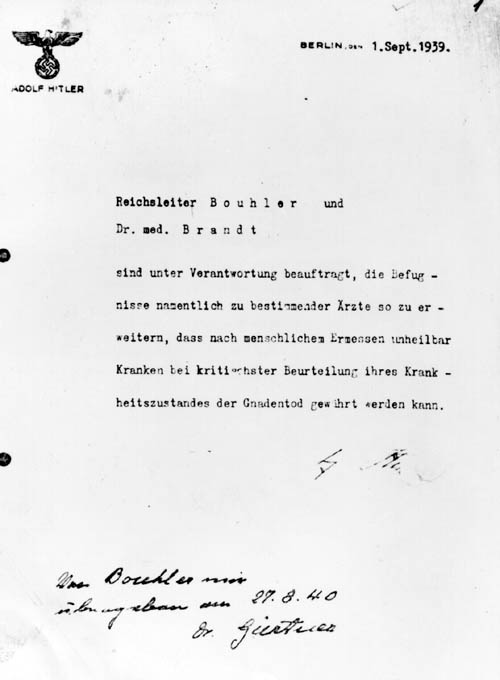
Euthanasie: Fragen zum Brief von Adolf Hitler
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Fragen zum Brief von Adolf Hitler
- Lest den Brief von Adolf Hitler und versucht mit zwei anderen, den Text wörtlich in heutige Sprache zu übersetzen. Überlegt gemeinsam, warum Hitler diesen Brief verfasste und was er mit ihm deutlich machen wollte. Tauscht euch zunächst mit den zwei anderen und danach alle gemeinsam darüber aus, wozu Hitler die Ärzte und Ärztinnen mit diesem Brief bewegen wollte.
- Wenn ihr bereits Definitionen von "Gnadentod" oder "Lebensrecht" verfasst habt, könnt ihr nun überlegen, ob sich etwas an eurer Definition geändert hat, und die Texte umschreiben.
Euthanasie: 1. Angeklagter
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der ersten Mordphase (Gasmorde) im zweiten Hadamar-Prozess 1947
1. Angeklagter Gorgaß (Arzt):
"2-3 Autobusse mit verhängten Fenstern, die fuhren an der Seitentür vor. Wenn die Kranken zur Aufnahme kamen, dann setzte ich mich in den Untersuchungsraum; (…) Dann kamen sie in den sogenannten Warte- und Auskleideraum, da wurden sie entkleidet. Die Omnibusse waren meist mit Gleichgeschlechtlichen geladen, die kamen rein und wurden ausgezogen und weitergeführt zum Photographieren, dann dem Bürobeamten vorgeführt, der die Identifizierung vornahm. Das Photographieren geschah aus dokumentarischen Gründen, natürlich auch aus wissenschaftlichen Gründen. (…) Die Krankengeschichte und Photokopie des Meldebogens lagen dabei. An Hand dieses Bogens wurde der Kranke noch einmal exploriert. Bei schizophrenen Endzuständen, bei Schwachsinn bedarf es in den meisten Fällen keiner langen weiteren Untersuchung, um die Schwere der Erkrankung festzustellen. (…) Sie wurden unten in den Vergasungsraum geführt, der wie ein Duschraum aussah. Der Raum war als Duschraum eingerichtet, gekachelt. (…) Die Kranken nahmen dort Platz und glaubten, die würden gebadet, jawohl. (…)
Wenige Minuten dauerte der Vorgang. (…) Der Tod ist ein friedlicher. Es ist ein einfaches Schlafen. (…) Die Leute ermüden und verlieren alle Verbindungen mit der Außenwelt und schlafen dann ein. (…) Nach 5-10 Minuten waren sie tot, jawohl. Nach etwa 1-2 Stunden wurde frische Luft zugeführt und dann später konnte erst die Zelle geöffnet werden. Die Leichen wurden dann herausgebracht und in das Krematorium gebracht und eingeäschert.
Das Krematorium war ebenfalls im Keller. (…) Mehrere Leichen lagen da zusammen zur Verbrennung, so daß die Asche festzustellen da nicht möglich war, nein. (…) Jawohl, es stimmt, daß die Leute da gar nicht die Asche ihres Verstorbenen bekamen (…)." (15)
Quelle:
15: 2. Hadamarprozess beim Landgericht Frankfurt am Main, 26.2.1947; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 12-14 und 17-19
Euthanasie: 2. Angeklagter
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der ersten Mordphase (Gasmorde) im zweiten Hadamar-Prozess 1947
2. Angeklagter R. (Krankenpfleger):
"Ich habe die Kranken auskleiden helfen und brachte die bis zum Flur. Von dort aus kamen sie zum Arzt durch andere Pfleger. Vom Arzt wurden sie gewogen, gemessen, photographiert, und dann kamen sie in den Keller. Wir gingen mit ihnen nur bis zur Kellertreppe (…). Die Vergasung? Da waren ungefähr nach meiner Schätzung 30 oder 40, oder 50-60 drin, jedenfalls keine hundert und auch keine 90. Herr Gorgaß erklärte mir dann den Vorgang an der Gasvorrichtung, und ich schaute auch durch das Fenster zum Gasraum hinein. Es dauerte auch nicht lange, nachdem Gorgaß die Leitung aufgedreht hatte, dann fielen die Leute, die gestanden haben, die fielen um, und die anderen, die gesessen haben. Und dann war bald kein Leben mehr zu sehen." (16)
Quelle:
2. Hadamarprozess beim Landgericht Frankfurt am Main, 26.2.1947; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 19
Euthanasie: 3. Angeklagte
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der ersten Mordphase (Gasmorde) im zweiten Hadamar-Prozess 1947
3. Angeklagte S. (Verwaltungsangestellte):
"Ungefähr 4-6 Wochen habe ich Trostbriefe geschrieben. Darüber hinaus hatte ich dann Urkunden, Trostbriefe und die Karteikarten zu machen, da standen die Todesursache und alles drin. Ich hatte also Karteikarten anzulegen, Sterbeurkunden zu schreiben und Trostbriefe. Die Trostbriefe wurden nach einem bestimmten Schema geschrieben; die Arbeit war ziemlich stur. (…) Die Ärzte haben manchmal Decknamen geführt. (…) Dr. Gorgaß den Namen Kramer (?) und Direktor Berner, glaube ich, Barth. Die Namen wurden lediglich bei den Unterschriften der Trostbriefe geführt." (17)
Quelle:
17: 2. Hadamarprozess beim Landgericht Frankfurt am Main, 3.3.1947; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 17.
Euthanasie: 4. Angeklagte
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der ersten Mordphase (Gasmorde) im zweiten Hadamar-Prozess 1947
4. Angeklagte Sch. (Verwaltungsangestellte):
"In den Trostbriefen wurde noch angegeben, daß die Angehörigen eine Bescheinigung der Friedhofsverwaltung mitschicken sollten, und diese Bescheinigung bekam ich dann. Die eingehende Post habe ich darauf durchgesehen, wenn etwas von Urnen drin stand und die Bescheinigung der Friedhofsverwaltung da war, da habe ich das Nötigste dazu geschrieben. (…) Dann war noch eine Gruppe da, schrieben die Angehörigen da, daß sie damit einverstanden wären, wenn die Urne auf irgendeinem Friedhof beigesetzt wurde, da habe ich anhand eines Atlasses und einer Liste die größere Stadt herausgesucht, auf deren Friedhof Urnen beigesetzt wurden. (…) Da, wo die Angehörigen nichts bestimmten, das wurde auf dem Anstaltsfriedhof bestattet." (18)
Quellen:
18: 2. Hadamarprozess beim Landgericht Frankfurt am Main, 3.3.1947; Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 21 f.
Euthanasie: Angeklagter Wahlmann
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der Jahre 1942-1945 im zweiten Hadamar-Prozess 1947
Angeklagter Wahlmann (Arzt):
"Ich bin 1876 geboren, bin 70 Jahre alt. Seit 1903 bin ich Arzt. (…) Im Jahre 1933 trat ich zur Partei über. (…) Alles trat über und da habe ich mich auch entschlossen. Ich hatte keine innere Bindung und Ideen dafür und habe das auch zu meinem großen Nachteil bewiesen. (…) Nun kam ich nach Hadamar und blieb dort bis 1936. Und zwar mußte ich 1936 mit 60 Jahren in Pension gehen, weil ich schwere Herzmuskelentartung hatte, furchtbares Herzklopfen und Schwächezustände. (…) Meine Zeit der Pensionierung dauerte bis zum Jahre 1940. (…) Eines Tages (1942, die Verf.) erschien B. (…) und sagte mir, Hadamar ist wieder neu eingerichtet als Anstalt. (…) Ich ernenne Sie in Hadamar zum Chefarzt. Ich sagte zunächst: Herr Landesrat, das ist ja sehr ehrend für mich, aber warum werde ich nicht zum Direktor ernannt? (…) Ich habe im Einzelfall der Oberpflegerin oder dem Oberpfleger erklärt, daß der und der hin ist und der und der nicht. (…) Die Konferenz war vor der Visite. Es kann sein, daß ich dann gesagt habe, der und der kommt morgen dran, und daß diese Fälle dann am anderen Morgen bei der Konferenz durchgesprochen wurden. Ich glaube, die Oberpflegerin oder der Oberpfleger gaben mir einen Zettel für die, die heute gemacht werden sollten, im Anschluß an die gestrige Besprechung." (19)
Quelle:
19: 2. Hadamarprozess vor dem Landgericht Frankfurt am Main, 24.2.1947, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 2,3,22,25,26
Euthanasie: Angeklagte S.
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der Jahre 1942-1945 im zweiten Hadamar-Prozess 1947
Angeklagte S. (Verwaltungsangestellte):
"Ich heiße Paula S. und bin 35 Jahre alt. (…) Ich war lediglich auf die Partei gestoßen, weil ich Angestellte der Gauleitung Frankfurt a. M. wurde. (…) Ich war seinerzeit in Urlaub und brachte meine jüngste Schwester zum Landjahr weg. Ich wurde aus dem Urlaub zurückgerufen, da ich den Auftrag erhielt, nach Berlin zu fahren. (…) (S. arbeitete drei Jahre in Mordanstalten, die Verf.) Darauf gab ich meine Kündigung. Landesrat Bernotat kam dann eines Tages und Bernotat meinte, ich solle nicht gleich so heftig sein, und außerdem sei Personalmangel überall und ich sollte in der Anstalt verbleiben. Da sagte ich Bernotat, ich hätte wiederholt versucht, herauszukommen, er möchte mich gehen lassen. Daraufhin wurde mir meine Kündigung genehmigt zum September 1943. (…)
Ich habe es nachher auch nicht gewagt, einfach dem Dienst fernzubleiben, wie ich da eingesperrt worden wäre, also eine Möglichkeit auf diese Weise wegzukommen, wäre mir nicht gegeben gewesen. Ich habe immer wieder gekündigt, aber ohne Erfolg. Daß man mich in ein Konzentrationslager sperrt, das war mir auch gesagt worden. (…)" (20)
Quelle:
20: 2. Hadamarprozess vor dem Landgericht Frankfurt a. M., 3.3.1947, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 17,19
Euthanasie: Angeklagter R.
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der Jahre 1942-1945 im zweiten Hadamar-Prozess 1947
Angeklagter R. (Krankenpfleger):
"Es mag auch sein, daß ich in die Partei ging, daß ich vielleicht Arbeit bekäme. (…) Es hat aber lange gedauert, bis 1936, bis ich Arbeit in der Landesheilanstalt Weilmünster bekam. (…) Als Lernpfleger kam ich nach Weilmünster. Das Examen haben wir einheitlich mit „ausreichend“ bestanden. (…) Eingesetzt wurde ich in Herborn als Pfleger. (…) Am 28. Juli 1941 wurde ich versetzt nach Hadamar. (…) Das Gewissen geschlagen? Das schon. Aber es hatte doch alles gar keinen Zweck, sich darüber zu äußern, denn wo gab es für einen Pfleger eine Stelle, wo er sich beschweren konnte?! (…)
Dann habe ich mir wieder gesagt: der Arzt, der die Anordnungen gibt als Vorgesetzter, der trägt die Verantwortung. Denn es wird wohl jedem von den Pflegern und Pflegerinnen bekannt sein, daß es bei den Schulungen immer geheißen hat: den Anordnungen des Arztes ist unbedingt Folge zu leisten als Vorgesetzter. Weigert sich ein Pfleger oder führt er irrtümlicherweise etwas Falsches aus, so wird der betreffende Pfleger als unbrauchbar bezeichnet. (…) Für richtig gehalten, daß man Geisteskranke in dem Zustand nicht mehr weiter ernährt? Ja, Gedanken habe ich mir schon gemacht. Aber die Patienten, die man hatte, die waren körperlich so schlecht, daß sie manchmal überhaupt nicht mehr stehen konnten, daß sie zum großen Teil verhungert sind. Und da war es doch eine Wohltat von meiner Auffassung aus, daß solche Leute möglichst schnell starben.
Daß sie verhungert waren? Diese schlechte Ernährung. Die Leute bekamen weiter nichts wie Wassersuppe, (…) Brennnesselsuppe und dergleichen." (21)
Quelle:
21: 2. Hadamarprozess vor dem Landgericht Frankfurt am Main, 26.2.1947, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Abteilung 461, Nr. 32061, Bd. 7, S. 17,18,22,23
Euthanasie: Angeklagte K.
Behinderung, Krankheit und Euthanasie im Nationalsozialismus
Aussagen der Tatbeteiligten der Jahre 1942-1945 im zweiten Hadamar-Prozess 1947
Angeklagte K. (Krankenschwester):
"Nach Kriegausbruch erhielt ich durch den Polizeipräsidenten in Berlin einen Bereitstellungsschein, ich sollte mich für einen Einsatz, der u. U. einige Wochen dauern könne, bereithalten. Im Dezember 1939 folgte dann die Aufforderung, mich am 04. Januar 1940 im Columbushaus zu melden. (…) Wir wurden von einer Frau A. und Herrn H. empfangen, dann eröffnete uns Herr Blankenburg (…), welche Aufgabe uns erwartete. Er stellte uns vor die Tatsache, daß wir zur Durchführung einer Euthanasieaktion einberufen seien. Es wurde dabei vorgestellt, daß wir als erfahrene Pfleger aus den Heil- und Pflegeanstalten die Krankheitsbilder ja genau kennten und beurteilen könnten, daß es für die Schwerstkranken eine Erlösung sei, wenn man ihr Leben vorzeitig beende. Wir wurden dann gefragt, ob wir mitarbeiten wollten und nach einer Viertelstunde Bedenkzeit vereidigt, und unter Androhung schwerster Strafen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Herr Blankenburg hatte uns vorher gesagt, Hitler habe ein Gesetz ausgearbeitet, das bereits fertig vorliegt, es werde allerdings mit Rücksicht auf den Krieg zunächst nicht veröffentlicht werden; deshalb sei die Geheimhaltung notwendig.
(…) daß ich des Mordes angeklagt werde, bitte ich das Gericht um Gerechtigkeit! Man kann mich unmöglich verantwortlich machen, für diese Gesetze des Dritten Reiches, daß dessen Bestimmungen nicht vollkommen waren, ist schließlich nicht Sache einer Schwester. Vor der Schwester am Krankenbett steht der Arzt. Ob er ein Brustwickel, Einlauf, Herztropfen oder Schlafmittel verordnet. In diesem Falle den Gnadentod. Ich habe den Gnadentod nicht als Mord betrachtet. Und bilde mir ein, daß wirklich nur der, wer Mitleid hat und mitleiden kann dieses versteht. (…) Ich möchte hiermit darauf hinweisen auf die schwere Verantwortung. Infektion und schwer Geisteskranke zu pflegen (sic!). Dazu kommt, daß auf meine Station nur hoffnungslose Fälle kamen. Ich bitte, dieses alles zu berücksichtigen." (22)
Quelle:
22: Steppe, Hilfe: „Mit Tränen in den Augen zogen wir dann die Spritzen auf …“, in: Steppe, Hilde (Hg.): Krankenpflege im Nationalsozialismus, 6. Aufl., Frankfurt am Main 1991, S. 135 f.
Biografien
Otto Perl
Otto Perl (1882-1951)
Otto Perl wurde am 19.10.1882 in dem kleinen Dorf Wildenhain im Kreis Torgau in Sachsen geboren. Als Otto Perl im Alter von 13 Jahren an einer Gelenkentzündung erkrankte, die zur vollständigen Versteifung seiner Gelenke führte, übernahm seine Mutter seine Betreuung. Nach ihrem Tod verkaufte Otto Perls Vater seine Landwirtschaft um die Zuschüsse für die Heimunterbringung seines Sohnes finanzieren zu können.
Otto Perl verbrachte den Großteil seines Lebens in verschiedenen Einrichtungen der Armenfürsorge. Er nahm seine Erfahrungen zum Anlass, die Verhältnisse in den Anstalten zu beschreiben und der Kritik zu unterziehen. Er prangerte das Prinzip der Heimfürsorge an, dass die bloße Verwahrung von Menschen mit Körperbehinderungen nach den gesetzlichen Regelungen der sogenannten „Krüppelfürsorge“ vorsah, ohne ihnen Möglichkeiten der Schul- und Berufsausbildung bereitzustellen. Neben weiteren Aufsätzen legte Otto Perl die erste zusammenhängende historische Theorie über die Stellung der Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft seiner Zeit aus der Sicht eines Menschen mit Körperbehinderung vor. Es gelang ihm, "sich immer wieder aus unzumutbarer und erniedrigender Umgebung zu befreien und sich Lebensumstände zu schaffen, die ihm ein seinem Zustand angemessenes menschenwürdiges Leben ermöglichen." Trotz seiner schweren körperlichen Behinderung bildete sich Otto Perl selbst weiter und gab sein Wissen an Kinder und Jugendliche innerhalb der Anstalten weiter. Besonders engagierte sich Otto für das Aufwachsen körperbehinderter Kinder außerhalb von Anstalten, für die gemeinsame Erziehung und Beschulung behinderter und nichtbehinderter Kinder und für das Konzept der Selbsthilfe.
Mit Hilfe des Gymnasialdirektors Dr. Hermann Rassow legte der 37-jährige Otto Perl 1918 als Externer sein Examen zur Erlangung des Abiturs ab. Mit der finanziellen Unterstützung von Rassow und mit einem Helfer, der ihn begleitete, war es Otto Perl möglich, 1922 ein Studium an der philosophischen Fakultät der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität zu beginnen. Da er aufgrund seiner Behinderung nicht sitzen konnte folgte er stehend, an einen Pfeiler gelehnt, Vorlesungen über Philosophie und Volkswirtschaft.
Später widmete er sich neben der Arbeit an seiner Publikation dem Aufbau des bayrischen Landesverbandes des Selbsthilfebundes der Körperbehinderten und hielt Vorträge über fürsorgerische Probleme. Bereits aus dieser Zeit berichtete Otto Perl von Bespitzelungen und Übergriffen von Anhängern und Anhängerinnen der nationalsozialistischen Partei, die sich auch unter den Leitern und dem Pflegepersonal der Anstalt befanden.
Otto Perl zählte zum engen Kreis der Mitbegründer und Mitbegründerinnen des 1919 in Berlin initiierten "Selbsthilfebundes der Körperbehinderten", des historisch ersten Zusammenschlusses körperbehinderter Menschen, der deren Gleichstellung innerhalb der Gesellschaft anstrebte. In der erklärten Absicht, "keine Mauer um die Krüppel [zu] bauen, sondern eine lebendige Wechselbeziehung zwischen Gesunden und Leidenden zu schaffen", war der Bund von Anfang an auch für nichtbehinderte Mitglieder offen. Doch nicht nur das Personal der Anstalten, auch Menschen im Fürsorgesystem versuchten die Entwicklung und Arbeit des "Selbsthilfebundes" zu untergraben. Otto Perl schreibt dazu: „In der Nazifürsorge war es geradezu lebensgefährlich für den Schwerbehinderten, sich auf den Rechtsstandpunkt in fürsorgerischen Dingen zu stellen. Denn die Henker Hitlers waren mit ihren 'Todeslisten' sehr eifrig am Werke. Mancher aus meiner Umgebung musste den Weg zur Giftspritze gehen." Es handelt sich um einen von sehr wenigen vorliegenden Hinweise eines körperbehinderten Menschen, der von der Teilhabe der Fürsorgeanstalten am nationalsozialistischen Regime spricht, der unter den Körperbehinderten auch Anhänger des Nationalsozialismus ausmacht und die Euthanasie in den Anstalten direkt erwähnt.
Otto Perl wurde im Jahr 1934 gegen seinen Willen in das Pflegeheim der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau verlegt. Über sein Leben dort bis hin zur Zerstörung der Anstalt durch Luftangriffe Ende 1943 ist nichts bekannt.
Otto Perl forderte vehement das Recht körperbehinderter Menschen auf Selbstbestimmung und auf Möglichkeiten der schulischen und beruflichen Bildung, er grenzte jedoch dieses Recht auf den "geistig normalen Gehbehinderten" im Gegensatz zum "geistig anormalen" ein und begrüßte die erbbiologischen Maßnahmen des nationalsozialistischen Regimes. Auch er beteiligte sich damit an der Hierarchisierung behinderter Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, bzw. zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen.
Otto Perl lebte nach der Zerstörung des Pflegeheims in Magdeburg, bevor er in das Kaiser-Friedrich-Siechenhaus in Wittenberg aufgenommen wurde, wo er am 17. Oktober 1951 starb.
Quellen:
Petra Fuchs: Otto Perl (1882-1951). Das Recht auf Selbstbestimmung für "den geistig normalen Krüppel". Abrufbar auf der Website "bidok"
Krüppeltum und Gesellschaft im Wandel der Zeit. Mit e. Vorwort v. Dr. Hermann Rassow, Gotha 1926 (Nachdruck in: Heiden, H.-G. - Simon, G. - Wilken, U.: Otto Perl und die Entwicklung von Selbstbestimmung und Selbstkontrolle in der Körperbehinderten-Selbsthilfe-Bewegung. Eigenverlag des Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e. V. 74238 Krautheim/Jagst 1993)
Anna Eleanor Roosevelt
Anna Eleanor Roosevelt (1884 – 1962)
Anna Eleanor Roosevelt ist eine der wenigen Frauen, die an der Entwicklung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen mitarbeitete. Sie war US-amerikanische Journalistin, Autorin, Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin. Als Ehefrau des damaligen Präsidenten der USA, Franklin D. Roosevelt, war sie von 1933-45 die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie setzte sich für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung ein und war in der Öffentlichkeit und in der Politik sehr angesehen. Gemeinsam mit ihrem Mann Franklin D. Roosevelt kämpfte sie dafür, dass sich alle Staaten auf Menschenrechte einigen, die unter keinen Umständen verletzt werden dürfen. Die Rechte von Menschen mit Behinderungen fanden dabei allerdings keine besondere Erwähnung, obwohl sie ihr nicht gänzlich fremd gewesen sein dürften: Ihr Mann war als Erwachsener an Kinderlähmung erkrankt. Er hatte es aber stets vermieden, sich in der Öffentlichkeit im Rollstuhl zu zeigen (siehe hierzu auch die Übung zum Thema Denkmalstreit).
Das oben abgebildete Foto zeigt Eleanor Roosevelt mit einem Plakat der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, das damals in Englisch, Französisch und Spanisch gedruckt worden war. Das Foto wurde 1949 aufgenommen, ein Jahr nach der Verabschiedung der Erklärung durch die Vereinten Nationen. Welche Rolle hatte Eleanor Roosevelt bei der Entstehung dieser Erklärung gespielt? Hierzu schreibt Rainer Huhle, der für das Nürnberger Menschenrechtszentrum Personen porträtiert hat, die am Entstehungsprozess der Erklärung beteiligt waren:
„Anfang 1947 war Eleanor Roosevelt einstimmig auf der ersten Sitzung der UN-Menschenrechtskommission zu deren Vorsitzender gewählt worden. Diese Wahl schien fast selbstverständlich. Eleanor Roosevelt genoss als Witwe des 1945 verstorbenen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, aber auch als bekannte Journalistin großes Ansehen in aller Welt. Die USA, vor allem aber Präsident Roosevelt selbst waren es gewesen, die die Idee der Menschenrechte seit 1941 nachdrücklich in die Debatten um die Gestaltung einer neuen Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg hineingetragen hatten. Zwar hatte Eleanor nie irgendeine diplomatische Funktion in der Regierung ihres Mannes innegehabt. Aber ihre Rolle als publizistische Vorreiterin der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, gelegentlich auch gegen den Willen ihres Präsidentengatten, hatten ihr eine große Glaubwürdigkeit als Vertreterin des progressiven Amerika eingebracht.“ (1) (siehe dazu auch die Website Nürnberger Menschenrechtszentrum, Rubrik Menschenrechte verstehen/Menschenrechte haben Geschichte)
Im Jahr 1942, noch während des Zweiten Weltkrieges, unterzeichneten 26 Staaten der sogenannten „Anti-Hitler-Koalition“ ein Dokument, das als "Deklaration der Vereinten Nationen" in die Geschichte einging. Diese Deklaration bildete die Grundlage für die Gründung der Vereinten Nationen (VN) von 1945. Heute sind 192 Staaten Mitglied der Vereinten Nationen. Ihr Ziel ist die Sicherung von Frieden und Menschenrechten in der Welt. In der Präambel des VN-Gründungsdokuments, der Charta der Vereinten Nationen, wird deutlich, dass sie unter dem direkten Eindruck des Krieges entstand.
PRÄAMBEL
"WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN - FEST ENTSCHLOSSEN,
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat,
unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen,
Bedingungen zu schaffen, unter denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Verträgen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden können,
den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern (…)." (2)
Als Vorsitzende der Menschenrechtskommission setzte sich Eleanor Roosevelt für die Erarbeitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein – auch wenn sie nicht direkt an der Formulierung beteiligt war. Rainer Huhle attestiert ihr in seiner Kurzbiografie großes Verhandlungsgeschick:
"Als Präsidentin der neuen Menschenrechtskommission, deren Aufgaben noch keineswegs klar definiert waren, musste sie eine höchst heterogene Gruppe von Persönlichkeiten aus allen Kontinenten zu gemeinsamer Arbeit zusammenführen. Wie zahlreiche Kommissionsmitglieder bezeugten, tat sie dies mit großem persönlichen Einsatz und Geschick. Immer wieder gelang es ihr, gegensätzliche Positionen in persönlichen Gesprächen zu einem Ausgleich zu bringen. Zu Recht sehen viele zeitgenössische Beobachter darin ihre große Leistung. Wesentliche inhaltliche Impulse für die Formulierung der Menschenrechte kamen von ihr dagegen nicht." (3)
Bis an ihr Lebensende setzte sich Eleanor Roosevelt für die Menschen- und Bürgerrechte ein. Noch als über 70-Jährige widmete sie sich mit aller Kraft dem Kampf der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA für Freiheit und gleiche Rechte. 1968, also nach ihrem Tod, wurde Eleanor Roosevelt der Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen verliehen und damit ihr Engagement für die Menschenrechte gewürdigt.
Zur Weiterarbeit:
Ihr könnt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Charta der Vereinten Nationen daraufhin durchlesen, welche Personengruppen besonders erwähnt werden. Erarbeitet in der Gruppe, wie diese Personen geschützt werden sollten. Überlegt gemeinsam, warum Menschen mit Behinderungen nicht erwähnt sind. Hierbei können die Hintergrundtexte und die anderen Aktivitäten dieser Website hilfreich sein.
Quellen:
1, 3: Rainer Huhle, Website des Nürnberger Menschenrechtszentrums: Menschenrechte haben Geschichte. 21.07.2009, abgerufen am 20.09.2010
2: United Nations Regional Information Centre for Western Europe: Charta der Vereinten Nationen und Statut des Internationalen Gerichtshofs, abgerufen am 21.09.2010
Rainer Huhle, Website der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): Dossier: Menschenrechte: Kurze Geschichte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 12.10.2008, abgerufen am 20.09.2010
United Nations Regional Information Centre for Western Europe. www.unric.org/html/german/pdf/charta.pdf, abgerufen am 21.09.2010
Franklin Delano Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt (1882 – 1945)
Franklin D. Roosevelt war von 1933 bis zu seinem Tod im Jahr 1945 der 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Er wurde drei Mal als Präsident wiedergewählt. Er ist der einzige Präsident der USA, der länger als zwei Wahlperioden im Amt war.
Roosevelt wuchs in New York auf, in einer der damals wohlhabendsten und angesehensten Familien Amerikas. Er studierte Jura, brach das Studium aber ab und begann, für politische Ämter zu kandidieren.
Unter dem Schlagwort "New Deal" (Neuverteilung der Chancen) leitete Roosevelt Reformmaßnahmen in der Wirtschaft und in der Sozialgesetzgebung ein. In einer Rede am 6. Januar 1941 stellte er, in Reaktion auf den Nationalsozialismus, die "Vier Freiheiten" vor. Wenn diese Freiheiten für alle Staaten gelten würden, so Roosevelts Hoffnung, wäre die Welt in Zukunft sicherer und friedlicher:
"Von der Zukunft, die wir zu einer Zukunft der Sicherheit machen wollen, erhoffen wir eine Welt, die sich auf vier entscheidende Freiheiten der Menschheit gründet.
Die erste Freiheit ist Freiheit der Rede und der Meinungsäußerung – überall in der Welt.
Die zweite Freiheit ist Freiheit eines jeden, Gott auf seine Weise zu dienen – überall in der Welt.
Die dritte Freiheit ist Freiheit von Not. Das bedeutet, gesehen vom Gesichtspunkt der Welt, wirtschaftliche Verständigung, die für jede Nation ein gesundes, friedliches Leben gewährleistet überall in der Welt.
Die vierte Freiheit ist Freiheit von Furcht. Das bedeutet, gesehen vom Gesichtspunkt der Welt, weltweite Abrüstung, so gründlich und so weitgehend, dass kein Volk mehr in der Lage sein wird, irgendeinen Nachbarn mit Waffengewalt anzugreifen – überall in der Welt."
Diese "Vier Freiheiten" sollten weltweite Gültigkeit erlangen. Sie wurde später Inhalt der Atlantik-Charta und Grundlage für die Gründungsdokumente der Vereinten Nationen. (1)
Mit 39 Jahren erkrankte Roosevelt an Kinderlähmung. Seine Beine, seine Arme und der Rücken waren gelähmt. Er konnte nicht mehr laufen und benutzte einen Rollstuhl. Er trainierte aber täglich und aktivierte damit seine Muskulatur. So ging die Lähmung in Armen und Rücken nach und nach zurück. Er konnte mit Krücken und Stahlschienen stehen, aber nur mühsam gehen.
Sieben Jahre lang kämpfte er für seine Heilung. Er weigerte sich anzuerkennen, dass er nie wieder würde gehen können. Franklin D. Roosevelt zeigte sich in der Öffentlichkeit nie im Rollstuhl.
Roosevelt musste sich gegen versteckte, aber auch offene Angriffe wehren. Diese kamen oft von seinen politischen Gegnern und bezogen sich auf seine Behinderung. Er entgegnete, "dass ein Gouverneur nicht wegen seiner Fähigkeit gewählt werde, einen doppelten Salto rückwärts oder einen Handstandüberschlag vorzuführen, sondern wegen seiner 'Geistesarbeit'." (2)
1945 starb er. Kurz vor seinem Tod bereitete er die Gründungsversammlung der Vereinten Nationen vor. Roosevelt forderte als Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus eine Einigung aller Staaten auf die universelle Geltung der Menschenrechte.
Zur Weiterarbeit:
Debatte über das Denkmal für Präsident Franklin D. Roosvelt ("Denkmalstreit")
Quellen:
1: Christian Mürner (2000): Verborgene Behinderungen. Der behinderte Präsident. Luchterhand: Neuwied; Berlin, S. 102-107.
2: Detlef Junker (1979): Franklin D. Roosevelt. Macht und Vision: Präsident in Krisenzeiten. Muster-Schmidt: Zürich, S. 131-134.
Berliner Behindertenverband e. V. "Für Selbstbestimmung und Würde" (PDF, 5,87 MB, nicht barrierefrei) (2009): Franklin D. Roosevelt zu Lebzeiten öffentlich nie im Rollstuhl zu sehen. Ausgabe Dezember 2009/Januar 2010, 20. Jahrgang 2009, 24
Alan Posener (1999): Franklin Delano Roosevelt, Rowohlt: Reinbek, S. 57-58.
Rainer Huhle: Website des Nürnberger Menschenrechtszentrums: Menschenrechte haben Geschichte 21.07.2009 (abgerufen am 20.09.2010) ()
Deutsches Hygiene Museum, Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V. (Hrsg.) (2001): Der imperfekte Mensch. Vom Recht auf Unvollkommenheit. Hatje Cantz: Ostfildern-Ruit, S. 183
Hilde Wulff
Hilde Wulff (1898-1972)
Hildegard Wulff wurde am 7. Januar 1898 als zweite von drei Töchtern einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie im Ruhrgebiet geboren. Im Alter von zwei Jahren erkrankte sie an Kinderlähmung. Der Wohlstand ihrer fürsorglichen Eltern ermöglichte es, verschiedene medizinische Behandlungsmethoden zur Besserung ihres Gesundheitszustandes auszuprobieren. Das hatte jedoch zur Folge, dass Hilde weder in die Schule ging noch am alltäglichen familiären Leben teilnahm. Erst ab dem Alter von 15 Jahren erhielt die Jugendliche auf Anweisung eines Arztes regelmäßigen Schulunterricht durch einen Privatlehrer. Die mit ihrer Behinderung verbundenen Kindheitserfahrungen wurden zum Antrieb ihrer Berufsfindung.
Mit dem festen Ziel, eine Reihe sogenannter "Krüppelkinderheime" zu gründen und zu leiten, in denen medizinisch-orthopädische Behandlung und Schulunterricht möglich sein sollten, absolvierte Hilde Wulff trotz erheblicher Einschränkungen in ihrer Beweglichkeit und zunächst gegen den Widerstand ihres Vaters eine Ausbildung zur Wohlfahrtspflegerin und Jugendfürsorgerin. Zu Beginn ihrer Ausbildung durfte sie aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht gehen und musste den Großteil des Tages liegen. „Ich nahm an den Vorlesungen liegend teil - dies aber gab mir keine Außenstellung, ja ich wurde, obwohl ich die Jüngste in dem Lehrgang war, zum Sprecher der Klasse."(1)
Von 1923 bis 1933 engagierte sich Hilde Wulff im "Selbsthilfebund der Körperbehinderten (Otto Perl-Bund)" und führte unentgeltlich Beratungen durch. Der Selbsthilfebund war 1919 in Berlin von Otto Perl, Marie Gruhl und anderen gegründet worden. Zu den Erfolgen des Bundes gehörte die Errichtung eigener Wirtschaftsbetriebe und damit die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Menschen mit Behinderungen. In der Auseinandersetzung mit den Trägern der sogenannten "Krüppelfürsorge", die die Leistungen für Menschen mit Körperbehinderungen verteilten, setzte sich der Selbsthilfebund engagiert für die gemeinsame Erziehung behinderter und - so der in dieser Zeit übliche Sprachgebrauch - "gesunder" Kinder ein. Die Sondererziehung körperbehinderter Kinder und Jugendlicher in "Krüppelanstalten" und den Anstalten angeschlossenen ambulanten "Krüppelschulen" und Berufsausbildungsstätten lehnte er ab. 1928, ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters, mit dem sie sich auch gemeinsam engagiert hatte, gründete Hilde Wulff mit ihrem ererbten Vermögen die "Krüppelhilfe und Wohlfahrt GmbH". Das war eine gemeinnützige Gesellschaft mit dem Ziel, "Krüppelheime, Tagesheime, Beschäftigungs- und Unterrichtsräume usw." zu errichten, die der kostenlosen Hilfe für Menschen mit körperlichen Behinderungen dienen sollten.
Sehr früh erkannte Hilde Wulff die Gefahren des Nationalsozialismus, besonders für Menschen mit Behinderungen. Nach 1933 wurde die 1921 von ihr mitgegründete "Kinderheil- und Heimstätte Urdenbach" von den Nationalsozialisten enteignet, der Verein aufgelöst. Mehrere Angestellte des Vereins mussten aus politischen Gründen oder weil sie Jüdinnen waren, aus Deutschland fliehen. Trotz dieser Ereignisse gründete Hilde Wulff weitere Kinderheime, die sie oft selbst leitete, und versuchte dabei "frei von allen nationalsozialistischen Einflüssen" zu bleiben. Hilde Wulffs Strategie war es, sich der öffentlichen Aufmerksamkeit durch die Nationalsozialisten so gut wie möglich zu entziehen. So verlegte sie zum Beispiel ein in Berlin gegründetes Heim in ein Dorf in die Nähe von Hamburg und finanzierte es fortan weitgehend aus ihrem Privatvermögen. Der Versuch, möglichst unauffällig zu agieren, hielt Hilde Wulff jedoch nicht davon ab, Verfolgte des Nazi-Regimes zu unterstützen. Der Musiker und Musikpädagoge Heinrich Jacoby, der als Jude in die Schweiz emigrieren musste, schrieb über sie: „Es ist mir noch recht viel von früher gegenwärtig - und nicht zuletzt ihre stille Courage in jenen Tagen, da die meisten bloß Angst hatten, jemandem zu helfen." Mit ihrem Leben, ihrer pädagogischen Arbeit und ihrem persönlichen Einsatz leistete Hilde Wulff einen stillen, aber mutigen und wirksamen Widerstand, der bis heute nicht gewürdigt wird. Sie und alle ihr anvertrauten Kinder überlebten die Zeit des Nationalsozialismus.
Nach 1945 waren Hilde Wulffs Kräfte fast erschöpft. Dennoch führte sie das Kinderheim "Im Erlenbusch" weiter, in den 60er-Jahren sogar noch vom Bett aus. Hilde Wulff starb 1972 in diesem Heim in Hamburg.
Quelle:
(1) Petra Fuchs: Hilde Wulff (1898-1972). Leben und Wirken für die Emanzipation körperbehinderter Menschen in der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus. Abrufbar auf der Website "bidok"
(2) Jacoby 10.06.1953 auf der Website bidok: Petra Fuchs, siehe (1)
Gesetze
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses
vom 14. Juli 1933
geändert durch
Gesetz vom 26. Juni 1935 (RGBl. I. S. 773),
Gesetz vom 4. Februar 1936 (RGBl. I. S. 119).
aufgehoben kraft des entgegenstehenden Rechts in den einzelnen Besatzungszonen Deutschlands (vom Kontrollrat nicht einheitlich aufgehoben); nach deutschen Recht gemäß Artikel 123 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1).
Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:
§ 1. (1) Wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar (sterilisiert) werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden.
(2) Erbkrank im sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet:
- angeborenem Schwachsinn,
- Schizophrenie,
- zirkulärem (manisch-depressivem) Irresein,
- erblicher Fallsucht,
- erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea),
- erblicher Blindheit,
- erblicher Taubheit,
- schwerer erblicher körperlicher Mißbildung.
(3) Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet.
Durch Gesetz vom 4. Februar 1936 wurden im § 1 Abs. 1 die Worte "durch einen chirurgischen Eingriff" gestrichen.
§ 2. (1) Antragsberechtigt ist derjenige, der unfruchtbar gemacht werden soll. Ist dieser geschäftsunfähig oder wegen Geistesschwäche entmündigt oder hat er das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist der gesetzliche Vertreter antragsberechtigt; er bedarf dazu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. In den übrigen Fällen beschränkter Geschäftsfähigkeit bedarf der Antrag der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Hat ein Volljähriger einen Pfleger für seine Person erhalten, so ist dessen Zustimmung erforderlich.
(2) Dem Antrag ist eine Bescheinigung eines für das Deutsche Reich approbierten Arztes beizufügen, daß der Unfruchtbarzumachende über das Wesen und die Folgen der Unfruchtbarmachung aufgeklärt worden ist.
(3) Der Antrag kann zurückgenommen werden.
§ 3. Die Unfruchtbarmachung können auch beantragen
1. der beamtete Arzt,
2. für die Insassen einer Kranken-, Heil- oder Pflegeanstalt oder einer Strafanstalt der Anstaltsleiter.
§ 4. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des Erbgesundheitsgerichts zu stellen. Die dem Antrag zu Grunde liegenden Tatsachen sind durch ein ärztliches Gutachten oder auf andere Weise glaubhaft zu machen. Die Geschäftsstelle hat dem beamteten Arzt von dem Antrag Kenntnis zu geben.
§ 5. Zuständig für die Entscheidung ist das Erbgesundheitsgericht, in dessen Bezirk der Unfruchtbarmachende seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.
§ 6. (1) Das Erbgesundheitsgericht ist einem Amtsgericht anzugliedern. Es besteht aus einem Amtsrichter als Vorsitzenden, einem beamteten Arzt und einem weiteren für das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut ist. Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bestellen.
(2) Als Vorsitzender ist ausgeschlossen, wer über einen Antrag auf vormundschaftliche Genehmigung nach § 2 Abs. 1 entschieden hat. Hat ein beamteter Arzt den Antrag gestellt, so kann er bei der Entscheidung nicht mitwirken.
§ 7. (1) Das Verfahren vor dem Erbgesundheitsgericht ist nicht öffentlich.
(2) Das Erbgesundheitsgericht hat die notwendigen Ermittlungen anzustellen; es kann Zeugen und Sachverständige vernehmen sowie das persönliche Erscheinen und die ärztliche Untersuchung des Unfruchtbarzumachenden anordnen und ihn bei unentschuldigtem Ausbleiben vorführen lassen. Auf die Vernehmung und Beeidigung der Zeugen und Sachverständigen sowie auf die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung sinngemäße Anwendung. Ärzte, die als Zeugen oder Sachverständige vernommen werden, sind ohne Rücksicht auf das Berufsgeheimnis zur Aussage verpflichtet. Gerichts- und Verwaltungsbehörden sowie Krankenanstalten haben dem Erbgesundheitsgericht auf Ersuchen Auskunft zu erteilen.
§ 8. Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Ergebnisses der Verhandlung und Beweisaufnahme nach freier Überzeugung zu entscheiden. Die Beschlußfassung erfolgt auf Grund mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Der Beschluß ist schriftlich abzufassen und von den an der Beschlußfassung beteiligten Mitgliedern zu unterschreiben. Er muß die Gründe angeben, aus denen die Unfruchtbarmachung beschlossen oder abgelehnt worden ist. Der Beschluß ist dem Antragsteller, dem beamteten Arzt sowie demjenigen zuzustellen, dessen Unfruchtbarmachung beantragt worden ist, oder, falls dieser nicht antragsberechtigt ist, seinem gesetzlichen Vertreter.
§ 9. Gegen den Beschluß können die im § 8 Satz 5 bezeichneten Personen binnen einer Notfrist von einem Monat nach der Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des Erbgesundheitsgerichts Beschwerde einlegen. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Über die Beschwerde entscheidet das Erbgesundheitsobergericht. Gegen die Versäumung der Beschwerdefrist ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in entsprechender Anwendung der Vorschriften der Zivilprozeßordnung zulässig.
Durch Gesetz vom 26. Juni 1935 wurden im § 9 Satz 1 die Worte "Notfrist von einem Monat" ersetzt durch: "Notfrist von 14 Tagen".
§ 10. (1) Das Erbgesundheitsobergericht wird einem Oberlandesgericht angegliedert und umfaßt dessen Bezirk. Es besteht aus einem Mitglied des Oberlandesgerichts, einem beamteten Arzt und einem weiteren für das Deutsche Reich approbierten Arzt, der mit der Erbgesundheitslehre besonders vertraut ist. Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bestellen. § 6 Abs. 2 gilt entsprechend.
(2) Auf das Verfahren vor dem Erbgesundheitsobergericht finden §§ 7, 8 entsprechende Anwendung.
(3) Das Erbgesundheitsobergericht entscheidet endgültig.
Durch Gesetz vom 26. Juni 1935 wurde an dieser Stelle folgender Artikel eingefügt:
"§ 10a. (1) Hat ein Erbgesundheitsgericht rechtskräftig auf Unfruchtbarmachung einer Frau erkannt, die zur Zeit der Durchführung der Unfruchtbarmachung schwanger ist, so kann die Schwangerschaft mit Einwilligung der Schwangeren unterbrochen werden, es sei denn, daß die Frucht schon lebensfähig ist oder die Unterbrechung der Schwangerschaft eine ernste Gefahr für das Leben oder die Gesundheit der Frau mit sich bringen würde.
(2) Als nicht lebensfähig ist die Frucht dann anzusehen, wenn die Unterbrechung vor Ablauf des sechsten Schwangerschaftsmonats erfolgt."
§ 11. (1) Der zur Unfruchtbarmachung notwendige chirurgische Eingriff darf nur in einer Krankenanstalt von einem für das Deutsche Reich approbierten Arzt ausgeführt werden. Dieser darf den Eingriff erst vornehmen, wenn der die Unfruchtbarmachung anordnende Beschluß endgültig geworden ist. Die oberste Landesbehörde bestimmt die Krankenanstalten und Ärzte, denen die Ausführung der Unfruchtbarmachung überlassen werden darf. Der Eingriff darf nicht durch einen Arzt vorgenommen werden, der den Antrag gestellt oder in dem Verfahren als Beisitzer mitgewirkt hat.
(2) Der ausführende Arzt hat dem beamteten Arzt einen schriftlichen Bericht über die Ausführung der Unfruchtbarmachung unter Angabe des angewendeten Verfahrens einzureichen.
Durch Gesetz vom 26. Juni 1935 wurden im § 11 Abs. 1 Satz 1 und 3 und in Abs. 2 jeweils nach dem Wort "Unfruchtbarmachung" die Worte "und Schwangerschaftsunterbrechung" eingefügt.
Durch Gesetz vom 4. Februar 1936 wurde der § 11 wie folgt geändert:
- folgender neuer Absatz 1 wurde eingefügt:
"(1) Die Unfruchtbarmachung hat im Wege des chirurgischen Eingriffs zu erfolgen. Die Reichsminister des Innern und der Justiz bestimmen, unter welchen Voraussetzungen auch andere Verfahren zur Unfruchtbarmachung angewandt werden können."
- der bisherige Abs. 1 wurde Abs. 2 und in diesem wurde das Wort "chirurgische" ersetzt durch: "ärztliche".
- der bisherige Abs. 2 wurde Abs. 3.
§ 12. (1) Hat das Gericht die Unfruchtbarmachung endgültig beschlossen, so ist sie auch gegen den Willen des Unfruchtbarmachenden auszuführen, sofern nicht dieser allein den Antrag gestellt hat. Der beamtete Arzt hat bei der Polizeibehörde die erforderlichen Maßnahmen zu beantragen. Soweit andere Maßnahmen nicht ausreichen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges zulässig.
(2) Ergeben sich Umstände, die eine nochmalige Prüfung des Sachverhalts erfordern, so hat das Erbgesundheitsgerichts das Verfahren wieder aufzunehmen und die Ausführung der Unfruchtbarmachung vorläufig zu untersagen. War der Antrag abgelehnt worden, so ist die Wiederaufnahme nur zulässig, wenn neue Tatsachen eingetreten sind, welche die Unfruchtbarmachung rechtfertigen.
§ 13. (1) Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens trägt die Staatskasse.
(2) Die Kosten des ärztlichen Eingriffs trägt bei den der Krankenversicherung angehörenden Personen die Krankenkasse, bei anderen Personen im Falle der Hilfsbedürftigkeit der Fürsorgeverband. In allen anderen Fällen trägt die Kosten bis zur Höhe der Mindestsätze der ärztlichen Gebührenordnung und der durchschnittlichen Pflegesätze in den öffentlichen Krankenanstalten die Staatskasse, darüber hinaus der Unfruchtbargemachte.
§ 14. Eine Unfruchtbarmachung, die nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes erfolgt, sowie eine Entfernung der Keimdrüsen sind nur dann zulässig, wenn ein Arzt sie nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Abwendung einer ernsten Gefahr für das Leben oder die Gesundheit desjenigen, an dem er sie vornimmt, und mit dessen Einwilligung vollzieht.
Durch Gesetz vom 26. Juni 1935 erhielt der § 14 folgende Fassung:
"§ 14. (1) Eine Unfruchtbarmachung oder Schwangerschaftsunterbrechung, die nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes erfolgte, sowie eine Entfernung der Keimdrüsen sind nur dann zulässig, wenn ein Arzt sie nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur Abwendung einer ersten Gefahr für das Leben oder die Gesundheit desjenigen, an dem er sie vornimmt, und mit dessen Einwilligung vollzieht.
(2) Eine Entfernung der Keimdrüsen darf beim Manne mit seiner Einwilligung auch dann vorgenommen werden, wenn sie nach amts- oder gerichtsärztlichem Gutachten erforderlich ist, um ihn von einem entarteten Geschlechtstrieb zu befreien, der die Begehung weiterer Verfehlungen im sinne der §§ 175 bis 178, 183, 223 bis 226 des Strafgesetzbuchs befürchten läßt. Die Anordnung der Entmannung im Strafverfahren oder im Sicherungsverfahren bleibt unberührt."
§ 15. (1) Die an dem Verfahren oder an der Ausführung des chirurgischen Eingriffs beteiligten Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
(2) Wer der Schweigepflicht unbefugt zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Den Antrag kann auch der Vorsitzende stellen.
Durch Gesetz vom 4. Februar 1936 wurde im § 15 Abs. 1 das Wort "chirurgischen" ersetzt durch: "ärztlichen".
§ 16. (1) Der Vollzug dieses Gesetzes liegt den Landesregierungen ob.
(2) Die obersten Landesbehörden bestimmen, vorbehaltlich der Vorschriften des § 6 Abs. 1 Satz 1 und des § 10 Abs. 1 Satz 1, Sitz und Bezirk der entscheidenden Gerichte. Sie ernennen die Mitglieder und deren Vertreter.
§ 17. Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Justiz die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
§ 18. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1934 in Kraft.
siehe hierzu die Ausführungsverordnungen vom 5. Dezember 1933 (RGBl. I. S. 1021, ber. 1934 S. 20), vom 29. Mai 1934 (RGBl. I. S. 475), vom 25. Februar 1935 (RGBl. I. S. 289), vom 18. Juli 1935 (RGBl. I. S. 1035), vom 25. Februar 1936 (RGBl. I. S. 122, betr. Strahlenbehandlung) und vom 23. Dezember 1936 (RGBl. I. S. 1149) sowie die Durchführungsverordnung vom 31. August 1939 (RGBl. I. S. 1560).
in Österreich eingeführt durch Erlaß vom 14. November 1939 (RGBl. I. S. 2230) und in den Ostgebieten mit Erlaß vom 24. Dezember 1941 (RGBl. I. 1942 S. 15).
Berlin, den 14. Juli 1933
Der Reichskanzler
Adolf Hitler
Der Reichsminister des Innern
Frick
Der Reichsminister der Justiz
Dr. Gürtner
Quelle:
Reichsgesetzblatt 1933 I S. 529, 1935 S. 773, 1936 S. 119
Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR
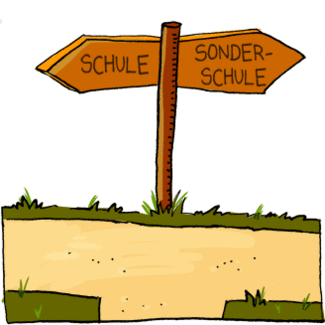
Nachkriegsdeutschland
Nachkriegsdeutschland, BRD und DDR zwischen 1945 bis 1994
Umgang mit nationalsozialistischen Gesetzen und Urteilen nach dem Ende des Nationalsozialismus (ab 1945)
Die Zeit des Nationalsozialismus endete mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945. Nun stellte sich in Deutschland die Frage, ob die 1933 erlassenen "Gesetze zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" weiterhin gelten sollten. Dazu gehörte auch das Zwangssterilisationsgesetz. In der amerikanischen, der britischen und der französischen Besatzungszone blieben die Gesetze im Wesentlichen unangetastet. Zwangssterilisationen fanden jedoch nicht mehr statt. Erst am 24. Mai 2007 konnte der Bund der "Euthanasie"-Geschädigten und Zwangssterilisierten erreichen, dass der Bundestag die nationalsozialistischen "Gesetze zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" als von Anfang an nicht mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vereinbar und deshalb ungültig erklärte. In der sowjetischen Besatzungszone hob die Militärverwaltung die Regelung zur Zwangssterilisation als "nazistisches" Gesetz bereits im Januar 1946 auf. Die Urteile der nationalsozialistischen "Erbgesundheitsgerichte" hingegen wurden in beiden Teilen Deutschlands übernommen. Auch die Sozialämter in der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland übernahmen die bereits vor 1945 angelegten Akten über die Menschen, die als sozial auffällig, verarmt, krank oder behindert galten. Die dort festgehaltenen menschenverachtenden Beurteilungen und rassistischen Entscheidungen bildeten häufig die Grundlage für weitere Entscheidungen und Beurteilungen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den zuständigen Ämtern. Auf solchen und vielen anderen Wegen konnte sich Unrecht auch nach dem Nationalsozialismus fortsetzten.
Der Nürnberger Ärzteprozess und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Von 1946 bis 1947 fand in Nürnberg ein Prozess gegen einige ausgewählte Ärzte statt, die in der Zeit des Nationalsozialismus tätig gewesen waren, der sogenannte "Nürnberger Ärzteprozess". Angeklagt waren hauptsächlich ehemalige KZ-Ärzte. Die Angeklagten hatten unter anderem an den Tötungen im Rahmen des "Euthanasieprogramms" oder an Menschenversuchen mitgewirkt. Zahlreiche weitere Verantwortliche aus der Verwaltung und der Pflege sowie weitere Ärzte und Ärztinnen wurden hingegen nicht angeklagt. Der Nürnberger Ärzteprozess löste weltweit großes Entsetzen aus. Durch ihn kamen viele Details der nationalsozialistischen Verbrechen an die Öffentlichkeit. Dadurch hatte die ganze Welt das unglaubliche Ausmaß des im Nationalsozialismus begangenen Unrechts deutlich vor Augen.
Zeitgleich fanden die Verhandlungen der 1945 gegründeten Vereinten Nationen über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte statt. 1948 einigten sich 48 Staaten auf den Text der Erklärung. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist eine Reaktion auf "die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte, die zu Akten der Barbarei geführt haben" (Präambel). In ihr ist festgehalten, dass alle Menschen angeborene Würde sowie gleiche und unveräußerliche Rechte haben, die geschützt werden müssen. Menschen mit Behinderungen wurden allerdings in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht erwähnt. In der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die 1990 in Kraft trat, wurden zum ersten Mal ausdrücklich Kinder mit Behinderungen berücksichtigt.
Der "Wiedergutmachungsausschuss"
Die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen blieb in den Nachkriegsjahren weiterhin zwiespältig. Im Mittelpunkt standen Fürsorge, medizinische Maßnahmen und die Sortierung nach dem Kriterium der Arbeitsfähigkeit. Auch haben viele der Menschen, die aufgrund von Behinderungen oder Krankheiten während des Nationalsozialismus verfolgt und verletzt wurden, bis heute keine staatliche Entschädigung bekommen. In der Bundesrepublik Deutschland lehnten Gutachter und Gutachterinnen in den 60er-Jahren solche Zahlungen im sogenannten "Wiedergutmachungsausschuss" des Bundestages ab. Als Begründung gaben sie an, dass ein neues Sterilisationsgesetz in den kommenden Jahren wahrscheinlich und sinnvoll sei und auch in der Bevölkerung breite Zustimmung finden werde. Aus diesem Grund sei es widersinnig, bereits durchgeführte Zwangssterilisationen als Unrecht anzuerkennen und die Betroffenen zu entschädigen.
In der DDR und der Bundesrepublik entwickelten sich in den folgenden Jahren die Gesetze und Haltungen gegenüber Menschen mit Behinderungen unterschiedlich:
Deutsche Demokratische Republik (DDR)
In der DDR stand die Teilhabe am Arbeitsmarkt im Vordergrund und wurde gefördert. So viele Menschen mit Behinderungen wie möglich sollten in staatlichen Betrieben arbeiten. Die Menschen, die nicht dort arbeiten konnten, waren auf Pflegeheime angewiesen. Kinder mit Behinderungen wurden in Sonderschulen unterrichtet. Kinder, die aufgrund einer Körperbehinderung dort unterrichtet wurden, konnten mit guten schulischen Leistungen jedoch den auch Zugang zur Hochschule erreichen. War dies nicht möglich, wurden sie in schlecht ausgestatteten Pflegeheimen untergebracht. Ihre Eltern sollten arbeiten gehen können. Menschen mit Behinderungen und Eltern von Kindern mit Behinderungen hatten wenige Möglichkeiten, auf sich und ihre Situation aufmerksam zu machen. Sie hatten in der DDR allerdings weit weniger mit finanziellen Sorgen zu kämpfen als in der Bundesrepublik. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurden deutlich mehr Gesetze, die sich auf Menschen mit Behinderungen bezogen, aus der Bundesrepublik übernommen als aus der DDR. Gleiches gilt für Schulsysteme und Ansätze der Behindertenrechtsbewegung.
Bundesrepublik Deutschland
In der Bundesrepublik konzentrierte sich die Behindertenpolitik zunächst auf die Versorgung der kriegs- und arbeitsverletzten Menschen. Die Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit stand im Zentrum der Fördermaßnahmen (Gesetz über die Beschäftigung Schwerbehinderter, 1953). In den 60er-Jahren änderte sich allmählich die Gesetzgebung. Hilfe für Menschen mit Behinderungen war nicht mehr eine reine Armenhilfe, sondern wurde ein Rechtsanspruch. Dennoch wurde erst 1974 das Schwerbehindertengesetz so geändert, dass zum ersten Mal staatliche Unterstützungsleistungen nicht mehr von der Ursache, der Art und dem Umfang der Behinderung abhingen. 1986 wurde in einem zweiten Schritt die Beurteilung der Behinderung verändert: Statt nach dem "Grad der Erwerbsminderung" wurde nun nach dem "Grad der Behinderung" eingestuft. Dies bedeutete, dass nicht mehr alleine die Frage nach der Leistungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt im Zentrum der Beurteilung stand, sondern auch individuelle und soziale Aspekte einbezogen wurden.
Von Beginn an wurde in der Bundesrepublik an die bereits vor dem Krieg bestehenden Strukturen der Werkstätten, Sonderschulen und Berufsförderwerke angeknüpft und diese wurden ausgebaut. Durch dieses besondere Bildungs- und Arbeitssystem gab es nur wenig Kontakt zwischen Menschen mit und Menschen ohne Behinderungen. Für Menschen mit Behinderungen war es sehr schwierig, aus diesen Spezialstrukturen in eine Ausbildung oder an eine Hochschule zu wechseln. Daher hatten sie weniger Bildungsmöglichkeiten und erhielten anschließend weniger Geld für ihre Arbeit.
In den 60er-Jahren gründeten Eltern von Kindern mit Behinderungen erste Selbsthilfeorganisationen, beispielsweise "Aktion Sorgenkind" (heute "Aktion Mensch"). Durch Spendenkampagnen konnte Kindern, die bis dahin als "nicht bildungsfähig" galten, eine bessere Bildung ermöglicht werden. Einige Behinderteneinrichtungen konnten durch Spendengelder besser ausgestattet werden. Gleichzeitig verfestigte sich jedoch auch durch solche Kampagnen die Ansicht vieler Leute, Menschen mit Behinderungen seien krank, zu bemitleiden und vorwiegend medizinisch zu behandeln.
Die Behindertenrechtsbewegung erkämpft Veränderungen
Die wichtigsten Veränderungen erkämpften in der Bundesrepublik vor allem Menschen mit Behinderungen selbst. Bereits in den 70er-Jahren begannen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, sich aktiv gegen ihre ständige Ausgrenzung und Bevormundung zu wehren. In Bremen traten Menschen in einen Hungerstreik. Sie forderten: auch Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, müssen Zugang zu Bus und Bahn haben. In Dortmund fand 1981 ein großes Treffen von Menschen mit Behinderungen statt. Frauen und Männer aus verschiedenen Behindertenselbsthilfe-Vereinigungen thematisierten ihre Aussonderung und Diskriminierung als Menschrechtsverletzung. Sie nannten die Veranstaltung "Krüppeltribunal". Damit wollten sie deutlich machen, dass zwar der Begriff "Krüppel" offiziell nicht mehr verwendet wurde, Menschen mit Behinderungen aber nach wie vor entmündigt, ausgegrenzt, mit Mitleid und Abscheu betrachtet wurden.
Sie setzen ihre Aktionen in den folgenden Jahren fort. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung konnten sie 1994 durch ihr Engagement eine Grundgesetzänderung erreichen. Das Verbot der Benachteiligung aufgrund von Behinderung wurde in Artikel 3, Absatz 3, in das Grundgesetz aufgenommen.
Materialien
Zur Weiterarbeit: Stephen Hawking
Zur Weiterarbeit: Stephen Hawking - Geist und Körper, schön und doof, klug und hässlich?
Hier findet ihr Anregungen, um intensiver über Bewertungen, die über die Körperform oder die geistige Verfasstheit von Menschen abgegeben werden, nachzudenken und diese zu hinterfragen.
Sammelphase
- Geist und Körper von Stephen Hawking wurden in der Zeitung bewertet. - Überlegt in kleinen Gruppen, welche weiteren Beispiele euch einfallen für Bewertungen und Vorstellungen über Geist und Körper.
- Diskutiere mit der Person neben dir zwei verschiedene Situationen, die du aus deinem Alltag kennst. Situation 1: In dieser Situation sind Körper und Geist eine Einheit. Situation 2: Körper und Geist sind getrennt, unterschiedliche Teile. Denkt beispielsweise an Situationen wie frühes Aufstehen, Prüfungen, Sport.
- Überlegt, welche Eigenschaften ihr bei eurer besten Freundin oder eurem besten Freund wichtig findet. Sucht Wörter und Bilder aus Zeitungen oder Zeitschriften aus, die sie oder ihn gut beschreiben. Macht daraus eine Collage. (Variante: Jede und jeder fertigt eine solche Collage für sich selbst an).
- Schreibt auf ein leeres Blatt verschiedene Wörter, die Menschen, ihren Geist und ihren Körper positiv bewerten (gesund, schön, intelligent,…). Schreibt auf ein anderes Blatt gegenteilige Bewertungen (hässlich, behindert, krank,…). Diskutiert anschließend in der Gruppe darüber.
- Sucht in Jugendzeitschriften und Tageszeitungen nach Beispielen für gute und schlechte Bewertungen und entsprechende Beschreibungen. Erstellt daraus eine Collage. Übertreibt in dieser Collage möglichst stark. Klebt neben ein Bild eine Reihe extrem positiver Begriffe und neben ein anderes eine Reihe extrem negativer Begriffe.
Reflexionsphase
Diskutiert anschließend in Gruppen oder alle gemeinsam,
- was auffällig ist an den Collagen und Wortreihen,
- welche Menschen aufgrund welcher Merkmale besonders häufig Vorurteilen und schlechten Bewertungen ausgesetzt sind,
- ob diese extremen Beschreibungen in der Realität tatsächlich auf Menschen zutreffen,
- wie sich diese Beschreibungen und Bewertungen verändern könnten. Könnte man diese Veränderung auch künstlerisch ausdrücken?
Veränderungsphase
Zum Abschluss könnt ihr in den Collagen die negativen Bewertungen mit den positiven Bewertungen tauschen, indem ihr die beiden Fotos vertauscht. Dies könnt ihr dann den anderen Gruppen präsentieren. Überlegt im Anschluss, welche Bewertungen besonders schlecht zu tauschen sind und woran das liegen kann.
Quellen:
"If you have a slurred voice, people are likely to treat you as mentally deficient (…)." Website Professor Stephen Hawking, abgerufen am 22.09.2010.
Bernard, Andreas (2005): Das Prinzip. In: Süddeutsche Zeitung Magazin, Heft 45/2005, abgerufen am 22.09.2010
Biografien
Stephen William Hawking
Stephen William Hawking (geb. 1942)
Stephen William Hawking, geboren 1942, ist ein weltbekannter englischer Professor für Astrophysik. Er wurde vor allem durch sein Buch "Eine kurze Geschichte der Zeit" bekannt. Das Buch verkaufte sich millionenfach und wurde zum Bestseller.
Mit 21 Jahren wurde bei Stephen Hawking eine Erkrankung des motorischen Nervensystems festgestellt. Diese Erkrankung heißt Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Sie ist nicht heilbar und führt zum Tod. Stephen Hawking wird oft auf seine Behinderung angesprochen und gefragt, wie er sich damit fühlt. Er antwortet häufig, er fühle gar nicht viel. Er versuche, sein Leben so normal wie möglich zu führen und möglichst wenig über seine Behinderung nachzudenken. Er trauere den Aktivitäten, die er heute aufgrund seiner Behinderung nicht mehr tun könne, nicht nach. Wenn er genau darüber nachdenke, betreffe dies ohnehin nicht sehr viele Dinge.
Bis 1974 war Stephen Hawking in der Lage, sich mit Unterstützung seiner Frau selbst zu versorgen. Eine Lungenentzündung verschlechterte jedoch seinen Gesundheitszustand, sodass er heute auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen ist. Stephen Hawking kommuniziert mithilfe eines Sprachcomputers. Diesen steuert er mit seinen Gesichtsmuskeln. Sich verständlich machen zu können, ist ihm sehr wichtig. Für seine Lebensqualität ist es entscheidend, eine eigene, klar verständliche Stimme zu haben: "Wenn jemand nur undeutlich sprechen kann, wird er schnell als geistig behindert behandelt (…)." (1)
Stephen Hawking ist oft in den Medien und wird häufig in Zeitungen und Artikeln erwähnt. In diesen Texten wird häufig seine Behinderung in den Mittelpunkt gestellt, obwohl diese für ihn selbst nicht das Wichtigste in seinem Leben ist, wie er sagt. Auch werden in solchen Berichten häufig sein Körper und sein Geist als getrennt voneinander beschrieben und bewertet. Hierfür typisch ist das folgende Zitat:
"In der ausdruckslosen, zusammengekrümmten Gestalt offenbart sich die klare Essenz des Denkens, ohne Trübung durch einen wendigen Körper, durch wortreiche Kommunikation. Dieses Bündel Mensch ist nichts als Intelligenz; von ihm geht eine unendliche Verdichtung der geistigen Tätigkeit aus, die sich alles Entbehrlichen entledigen musste: von der Funktionstüchtigkeit der Gliedmaßen bis zu den grundlegendsten Arbeitsmitteln wie Stift und Papier." (2)
Während in diesem Zitat Stephan Hawkings Geist als "gesund" und sein Körper als "krank" dargestellt werden, gibt es andererseits auch eine alte Tradition, Körper und Geist als zwei Teile des Menschen zu betrachten, die entweder nur beide "gesund" oder beide "krank" sein können. Diese Vorstellung findet sich noch heute in vielen Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen.
Zur Weiterarbeit:
Stephen Hawking - Geist und Körper, schön und doof, klug und hässlich?
Quellen:
1: "If you have a slurred voice, people are likely to treat you as mentally deficient (…)." Website Professor Stephen Hawking (abgerufen am 22.09.2010)
2: Bernard, Andreas (2005): Stephen Hawking. Website sz-magazin.sueddeutsche.de: Stephen Hawking (abgerufen am 22.09.2010)
Petra Stephan
Petra Stephan (geb. 1953 in Medingen bei Dresden)
Petra Stephan wurde 1953 in Medingen, einem Ortsteil der Gemeinde Ottendorf-Okrilla in Sachsen, geboren. Sie kam mit einer Muskelerkrankung namens Myotonia congenita ("Oppenheim-Krankheit") zur Welt und nutzt einen Rollstuhl, weil sie durch die Erkrankung nicht laufen kann. Ihre Familie hatte eine Bäckerei. Petra Stephan wuchs mit ihren Eltern, Großeltern, drei jüngeren Geschwistern und den Angestellten des Familienbetriebes auf. Das Mädchen besuchte keinen Kindergarten, aber der Hof der Familie war immer voller Kinder, mit denen sie Kontakt hatte und spielen konnte.
Schwieriger wurde die Frage, wo sie zur Schule gehen konnte. In der DDR galt die Schulpflicht auch für Kinder mit körperlichen Behinderungen. Wie die meisten anderen Schulen war auch die Dorfschule in Petra Stephans Heimatort nicht rollstuhlgerecht gebaut. Auch waren die Rollstühle sehr unpraktisch, weil sie seit fast 50 Jahren nicht verändert worden waren. Ihr Rahmen bestand aus billigem Stahl und war deshalb sehr schwer.
Die Kinder und Jugendlichen wurden in Krankenhausschulen unterrichtet, die jeweils auf unterschiedliche Behinderungen spezialisiert waren. Diese Schulen waren alle weit von Petra Stephans Heimatort entfernt. Sie hätte für den Schulbesuch ihre Familie und Freundinnen verlassen müssen. Da weder Petra noch ihre Familie dies wollten und sie in ihrem Ort nicht zuletzt durch die Bäckerei viele Kontakte hatte, bemühten sich die Lehrerinnen und Lehrer und die Familie gemeinsam um eine Lösung. Letzlich konnte die Familie erreichen, dass Petra Stephan zunächst zwei Schuljahre zuhause bleiben durfte und Hausunterricht bekam. Bis zur 3. Klasse kam jeden Morgen noch vor Beginn des Unterrichts an der Dorfschule oder in der Mittagspause eine Lehrerin oder ein Lehrer vorbei, um das Kind zu unterrichten. Ab der 3. Klasse ließ sich der Besuch der Sonderschule in Gotha und ab der 7. Klasse der Besuch einer Schule in Birkenwerder bei Berlin nicht mehr verhindern. Die Eltern besuchten ihre Tochter dort einmal im Monat. Die Schulen waren "orthopädische Kliniken" und nahmen Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen auf. Petra Stephan hatte dort zunächst großes Heimweh, wie die meisten Schülerinnen und Schüler, die alle von ihren Familien getrennt waren. Die Kinder lebten außerhalb des Unterrichtes in großen Krankenzimmern zusammen und wurden vom medizinischem Personal als Patienten und Patientinnen betrachtet und behandelt. Tagsüber wurden sie von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet und konnten sich in Jugendorganisationen der DDR engagieren. In diesem Rahmen war es ihnen auch möglich, Verbesserungen und Veränderungen für sich zu erreichen, wie Klavierunterricht, Kinobesuche oder Ausflüge. So gelang es Petra Stephan durch die Förderung der Lehrer und Lehrerinnen, die Erweiterte Oberschule zu absolvieren. Als eine von nur 13 Prozent der Schüler und Schülerinnen in der DDR konnte sie das Abitur machen und wurde zum Studium zugelassen.
Petra Stephan studierte Klinische Psychologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Auch die Universität war nicht barrierefrei. Da sie die einzige Studentin war, die einen Rollstuhl nutzte, wurde alles, was sie tat oder sagte, von den Lehrenden und ihren Mitstudierenden mit besonderem Interesse verfolgt. Von ihr wurde erwartet, mindestens genauso gute Leistungen zu erbringen wie alle anderen, obwohl sie unter denkbar schwierigeren Bedingungen studieren musste.
Petra Stephan hatte intensiven Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderungen, mit denen sie sich gemeinsam bemühte auf ihre Situation aufmerksam zu machen und diese zu verbessern. Die offizielle Gründung einer (Selbsthilfe-)Gruppe oder eines Vereins war in der DDR allerdings nicht erlaubt, wodurch die Bemühungen von Petra Stephan und ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern erschwert wurden.
Nach der deutschen Wiedervereinigung gründete sie mit Freunden und Freundinnen das "Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen e. V.". "Uns selbst zu helfen war der erste Schritt, anderen zu helfen", sagt sie heute. Nach dem Motto "Nichts über uns - ohne uns!" arbeiten solche Zentren seit vielen Jahren bundesweit daran, das Recht auf Selbstbestimmung für alle Menschen mit Behinderungen durchzusetzen.
Zurzeit arbeitet und unterrichtet die Diplom-Psychologin am Institut für Medizinische Psychologie der Charité in Berlin. Die Behinderung, sagt sie, sei Teil ihrer Identität. Neben ihrer Arbeit interessiert sie sich für Konzerte, Kino, Theater und vieles mehr. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V. – ISL
Quellen:
Website BZSL
Website Der Tagesspiegel: "Eine starke Gemeinschaft"
Website BZSL: "15 Jahre BZSL - und weiter 'auf zack'!" (PDF, 50 KB, nicht barrierefrei)
Gesetze
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf der Website des Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 26
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 26
Artikel 26: Recht auf Bildung
Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.
Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft (…) beitragen (…). Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt)
(Inoffizielle Kurzfassung) (1976)
Artikel 13
Jeder hat ein Recht auf Bildung. Dies muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewußtseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken.
Der Grundschulunterricht muß verpflichtend für alle gelten und kostenlos zugänglich sein.
Jeder Vertragsstaat, in dem es keine Grundschulpflicht und keinen unentgeltlichen Zugang zur Grundschule gibt, ist verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren einen ausführlichen Aktionsplan auszuarbeiten und anzunehmen, der die schrittweise Verwirklichung dieses Grundsatzes vorsieht.
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK)
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) (1990)
(Inoffizielle Kurzfassung)
Artikel 28: Erziehung und Bildung
Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, und es ist dabei die Aufgabe des Staates, den kostenlosen Besuch einer Schule zur Pflicht zu machen, verschiedene Formen der weiterbildenden Schulen zu entwickeln und Kindern entsprechend ihren Fähigkeiten den Besuch von Hochschulen zu ermöglichen. Die dabei nötige Disziplin in Schulen darf keine Rechte und vor allem nicht die Würde des Kindes verletzen.
Du hast ein Recht auf Bildung. Die Disziplin in der Schule darf nicht gegen deine Menschenwürde verstoßen. Der Besuch der Grundschule muss verpflichtend und kostenlos sein. Reiche Länder sollen ärmeren Ländern helfen, dies zu erreichen.
Artikel 29: Ziele der Bildung
Deine Bildung soll darauf ausgerichtet sein, deine Persönlichkeit, deine Begabungen und deine geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu bringen. Sie soll dich aufs Leben vorbereiten und dir Achtung vor deinen Eltern, deiner Gesellschaft und anderen Kulturen gegenüber vermitteln. Du hast das Recht, deine Rechte kennenzulernen.
Quelle:
"Kompass"
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem
vom 25. Februar 1965
faktisch geändert durch
Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der DDR (Verfassungsgrundsätze) vom 17. Juni 1990 (GBl. I S. 299), Art. 1 Abs. 2.
aufgehoben durch die Schulgesetze der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen von 1991/1992.
(…)
Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik beschließt:
Erster Teil
Grundsätze und Ziele des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems und gesellschaftliche Erziehungsfaktoren
§ 1. (1) Das Ziel des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems ist eine hohe Bildung des ganzen Volkes, die Bildung und Erziehung allseitig und harmonisch entwickelter sozialistischer Persönlichkeiten, die bewußt das gesellschaftliche Leben gestalten, die Natur verändern und ein erfülltes, glückliches, menschenwürdiges Leben führen.
(2) Das sozialistische Bildungssystem trägt wesentlich dazu bei, die Bürger zu befähigen, die sozialistische Gesellschaft zu gestalten, die technische Revolution zu meistern und an der Entwicklung der sozialistischen Demokratie mitzuwirken. Es vermittelt den Menschen eine moderne Allgemeinbildung und eine hohe Spezialbildung und bildet in ihnen zugleich Charakterzüge im Sinne der Grundsätze der sozialistischen Moral heraus. Das sozialistische Bildungssystem befähigt sie; als gute Staatsbürger wertvolle Arbeit zu leisten, ständig weiter zu lernen, sich gesellschaftlich zu betätigen, mitzuplanen und Verantwortung zu übernehmen, gesund zu leben, die Freizeit sinnvoll zu nutzen, Sport zu treiben und die Künste zu pflegen.
(3) Dieses Ziel eint den sozialistischen Staat und alle gesellschaftlichen Kräfte in gemeinsamer Bildungs- und Erziehungsarbeit.
§ 2. (1) Der sozialistische Staat sichert mit dem einheitlichen sozialistischen Bildungssystem allen Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik das gleiche Recht auf Bildung.
(2) Die grundlegenden Bestandteile des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems sind:
- die Einrichtungen der Vorschulerziehung,
- die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule,
- die Einrichtungen der Berufsausbildung,
- die zur Hochschulreife führenden Bildungseinrichtungen,
- die Ingenieur- und Fachschulen,
- die Universitäten und Hochschulen,
- die Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung der Werktätigen.
Die Sonderschuleinrichtungen nehmen Kinder mit physischen oder psychischen Schädigungen auf.
(3) Die Einheitlichkeit in der Zielsetzung und im Aufbau des sozialistischen Bildungssystems schließt, entsprechend den gesellschaftlichen Erfordernissen und den individuellen Begabungen, Differenzierungen in den Bildungswegen auf den oberen Stufen ein.
(4) Das sozialistische Bildungssystem ist so aufgebaut, daß jedem Bürger der Übergang zur jeweils nächsthöheren Stufe bis zu den höchsten Bildungsstätten, den Universitäten und Hochschulen, möglich ist. Für die höheren Bildungseinrichtungen werden die Besten und Befähigtsten ausgewählt. Dabei ist die soziale Struktur der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik zu berücksichtigen.
(…)
Zweiter Teil
Schulpflicht - Schulgeldfreiheit
§ 8. (1) In der Deutschen Demokratischen Republik besteht allgemeine zehnjährige Oberschulpflicht. Sie entspricht dem Recht aller Kinder und Jugendlichen auf Oberschulbildung.
(2) Die allgemeine Oberschulpflicht besteht vom beginnenden 7. Lebensjahr für alle Kinder, deren Erziehungspflichtige ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik haben.
(3) Die allgemeine Oberschulpflicht ist durch den Besuch der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule zu erfüllen. In bestimmten Fällen kann die Oberschulbildung in den Einrichtungen der Berufsausbildung oder der Aus- und Weiterbildung der Werktätigen beendet werden.
(4) Berufsschulpflichtig sind Jugendliche, die in einem Lehrverhältnis stehen oder die gemäß Abs. 3 die Oberschulbildung in den Einrichtungen der Berufsausbildung bzw. der Aus- und Weiterbildung der Werktätigen zu beenden haben. Für Jugendliche im Lehrverhältnis dauert die Berufsschulpflicht bis zur Beendigung der Lehrzeit. Mit Absolventen der Ober-. schulen, die in keinem Lehrverhältnis stehen, haben die Betriebe Qualifizierungsverträge abzuschließen.
(5) Schulpflichtige mit physischen oder psychischen Schädigungen erfüllen ihre Schulpflicht in den für sie vorgesehenen staatlichen Sonderschuleinrichtungen.
(6) Einzelheiten gemäß Absätzen 2, 3 und 5 regeln der Minister für Volksbildung, gemäß Abs. 4 der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission.
§ 9. (1) In der Deutschen Demokratischen Republik besteht Schulgeldfreiheit.
(2) Das Direktstudium an den Universitäten, Hoch= und Fachschulen ist für alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik gebührenfrei.
(3) Für die- Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung der Werktätigen erlassen die Leiter der zuständigen Organe des Ministerrates besondere Regelungen.
(4) Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen können gewährt werden.
(5) An Studenten im Direktstudium an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen können entsprechend dem Leistungsprinzip und der sozialen Lage Stipendien gewährt werden.
2. Abschnitt
Spezialschulen und Spezialklassen
§ 18. (1) Spezialschulen sind allgemeinbildende Schulen. Sie dienen besonderen Erfordernissen der Nachwuchsentwicklung für die Wirtschaft die Wissenschaft, den Sport und die Kultur. Die Spezialschulen nehmen Schüler mit hohen Leistungen und besonderen Begabungen auf.
(2) Es sind Spezialschulen und Spezialklassen technischer, mathematischer, naturwissenschaftlicher, sprachlicher, künstlerischer und sportlicher Richtungen einzurichten.
(3) Spezialschulen und Spezialklassen führen in der Regel zur Hochschulreife. Spezialschulen und Spezialklassen, die nicht zur Hochschulreife führen; bereiten auf besondere künstlerische oder sportliche Leistungen vor.
(4) Spezialschulen und Spezialklassen sind nur in begrenztem Umfang zu errichten. Anzahl und Standort legt das Ministerium für Volksbildung fest,
(5) Die wichtigsten Einrichtungen für die außerunterrichtliche instrumentale Musikerziehung sind die Musikschulen.
(6) Die Betriebe, die wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen sichern gemeinsam mit den Organen für Volksbildung die personellen und materiellen Voraussetzungen.
3. Abschnitt.
Sonderschulen
§ 19. (1) Die Sonderschulen und andere sonderpädagogischen Einrichtungen - nachstehend Sonderschulen genannt - haben die Bildung und Erziehung aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit wesentlichen physischen oder psychischen Schädigungen zu gewährleisten. Die Sonderschulen erfassen in entsprechenden Einrichtungen Schwerhörige und Gehörlose, Sehschwache und Blinde, Sprach- und Stimmgestörte, schulbildungsfähige Schwachsinnige, dauernd Körperbehinderte, wesentlich Verhaltensgestörte und für längere Zeit erkrankte bzw. in Einrichtungen des Gesundheitswesens stationär behandlungsbedürftige Kinder und Jugendliche.
(2) Die Sonderschulen haben den Bildungs- und Erziehungsprozeß inhaltlich, organisatorisch und methodisch so zu gestalten, daß auch die geschädigten Kinder und Jugendlichen das sozialistische Bildungs- und Erziehungsziel vollständig öder nach den durch die physischen und psychischen Schädigungen verbliebenen Möglichkeiten erreichen. Die Schüler sollen befähigt werden, entsprechend der erreichten Qualifikation nach Maßgabe ihrer Kräfte in der sozialistischen Gesellschaft zu wirken und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Für die berufliche Aus- und Weiterbildung geschädigter Erwachsener sind erforderlichenfalls sonderpädagogische Maßnahmen zu sichern.
(3) In den einzelnen Sonderschulen sind die Bildungsstufen so aufeinander abzustimmen, daß unter Umständen ein Übergang aus sonderpädagogischen in allgemeine Bildungseinrichtungen erfolgen kann. Die Sonderschulen sind nach pädagogischen und medizinischen Grundsätzen zu differenzieren.
(4) Für verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche, die nach Entscheidung der örtlichen Organe des Gesundheitswesens und für Volksbildung keine örtliche Schule besuchen können, sind sonderpädagogische Maßnahmen einzuleiten.
(5) Das Ministerium für Volksbildung gewährleistet in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesundheitswesen die Bildung und Erziehung der physisch bzw. psychisch Geschädigten. Dazu gehört eine systematische Früherfassung der Geschädigten.
(6) Schüler und Absolventen aus Sonderschulen können eine Berufsausbildung oder eine Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Berufes erhalten.
(..)
Neunter Teil
Verantwortung der sozialistischen Gesellschaft für das einheitliche sozialistische Bildungssystem
§ 78. (1) Die allseitige und umfassende Verwirklichung des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems ist Angelegenheit der gesamten sozialistischen Gesellschaft. Die gesellschaftlichen Organisationen und alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sind aufgerufen, die Tätigkeit der Staats- und Wirtschaftsorgane und der Einrichtungen des sozialistischen Bildungssystems zur Durchführung dieses Gesetzes zu fördern, tatkräftig zu unterstützen und in den demokratischen Formen bei der Leitung des sozialistischen Bildungssystems mitzuwirken.
(2) Die demokratischen Parteien und Massenorganisationen, die gesellschaftlichen Einrichtungen und wissenschaftlichen Gesellschaften sind aufgerufen, zur allseitigen Bildung und Erziehung der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik im Sinne dieses Gesetzes beizutragen.
Das vorstehende, von, der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am fünfundzwanzigsten Februar neunzehnhundertfünfundsechzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.
Berlin, den fünfundzwanzigsten Februar neunzehnhundertfünfundsechzig
Der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik
W. Ulbricht
Quellen:
Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 1965 Teil I. S. 83
© 9. Dezember 2004
Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter
Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter
Haltung und Lebenssituation behinderter Menschen
Gegenwart

1994 bis 2011
Veränderungen und Stillstand
Seit der Änderung des Grundgesetzes 1994 (Artikel 3) wurden unzählige kleinere Gesetzesänderungen beschlossen, beispielsweise im Baurecht, in den Landesverfassungen, im Schwerbehindertengesetz und bezüglich der Rente. Bis zur Jahrtausendwende änderten sich die Ansichten vieler nicht behinderter Menschen über Menschen mit Behinderungen jedoch nur wenig. Menschen mit und Menschen ohne Behinderung begegneten sich nach wie vor selten. Um staatliche Leistungen zu bekommen, mussten Menschen nach wie vor ihre Hilfsbedürftigkeit und ihre Einschränkungen nachweisen, statt auf ihre Fähigkeiten, Bedürfnisse und Möglichkeiten hinweisen zu können. Das Sonderschulsystem wurde etwas modernisiert und in ein Schulsystem mit Förderzentren umstrukturiert. Wechsel zwischen Regelschulen und Förderzentren waren nun leichter möglich. Teilweise wurden Kinder mit und Kinder ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet oder konnten gemeinsam den Kindergarten besuchen. Die Möglichkeiten der Kinder mit Behinderungen hingen aber noch immer stark vom Engagement und den finanziellen Mitteln ihrer Eltern ab.
Selbstbestimmt leben ist möglich
Die politischen und sozialen Zusammenschlüsse und Aktionen von Menschen mit Behinderungen wurden zunehmend professioneller und weiteten sich aus. Unter dem Motto "Ich weiß doch selbst, was ich will" begannen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten zu organisieren und als Netzwerk "Mensch zuerst" für ein selbstbestimmtes Leben einzutreten. In den 90er-Jahren gründeten sich "Bifos, das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter", die "Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V. - ISL" und viele andere Vereine, die es heute noch gibt. Viele dieser Initiativen waren durch US-amerikanische Behindertenrechtler und –rechtlerinnen, die sich dort als Teil der Bürgerrechtsbewegung verstanden, motiviert und wurden von ihnen unterstützt. In den USA zeigten Behindertenrechtler und -rechtlerinnen beispielsweise, dass ein unabhängiges Leben möglich ist. Ihr Vorbild machte deutlich: Viele Schwierigkeiten, mit denen sich behinderte Menschen konfrontiert sahen, waren weniger auf ihre individuellen Einschränkungen zurückzuführen, sondern vor allem das Resultat gesellschaftlicher Barrieren und Ausgrenzungen. Diese wollten sie nicht länger akzeptieren und hinnehmen. Immer mehr Menschen bezeichneten diese Einschränkungen und Ausgrenzungen als Verletzung ihrer Menschenrechte.
Auch das Recht ändert sich
Um die Jahrtausendwende begannen sich allmählich weltweit gesellschaftliche Veränderungen für Menschen mit Behinderungen bemerkbar zu machen. Diese Veränderungen in der Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen und in der Rechtswirklichkeit sind ohne die Behindertenrechtsbewegung und andere soziale Bewegungen undenkbar. 2002 trat in Deutschland auf Bundesebene das Bundesgleichstellungsgesetz in Kraft. Waren über viele Jahrhunderte hinweg behinderte Menschen – auch in Gesetzestexten – eher als "soziale Probleme" statt als gleichberechtigte Bürger und Bürgerinnen behandelt worden, so schlug dieses Gesetz eine neue Richtung ein: "Ziel dieses Gesetzes ist es, die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen" (BGG, Abschnitt 1, Allgemeine Bestimmungen).
Diese Entwicklung findet sich auch in einer Neugestaltung des Rehabilitationsrechts wieder. Bisher war das Rehabilitationsrecht dafür da gewesen, Menschen bei der Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit zu unterstützen. Hierfür müssen sie bis heute sehr detailliert und bei verschiedenen Stellen nachweisen, wofür und warum sie welche Leistungen brauchen. Dies ist sehr aufwändig, manchmal demütigend und häufig unüberschaubar, was dazu führt, dass nicht immer alle Menschen die Leistungen bekommen, die ihnen zustehen. Seit 2008 gibt es deshalb auch die Möglichkeit, ein sogenanntes "Persönliches Budget" zu bekommen. Der Gang zu mehreren Ämtern entfällt dadurch. Über die Verwendung des Budgets kann jeder und jede selbst bestimmen und die Unterstützung davon bezahlen, die tatsächlich aus seiner oder ihrer Sicht benötigt wird. Allerdings ist es an vielen Orten in Deutschland bisher noch schwierig, das "Persönliche Budget" tatsächlich zu bekommen. Vielen Menschen – auch in Politik und Verwaltung - fällt es bisher noch schwer, umzudenken.
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
In Deutschland trat 2009 das "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen" (UN-Behindertenrechtskonvention) in Kraft. Das Übereinkommen ist ein internationaler Menschenrechtsvertrag, der auch "Konvention" genannt wird. In diesem Vertrag werden bereits bestehende Menschenrechte für die Lebenssituation behinderter Menschen konkretisiert. Die Konvention verpflichtet die Staaten, in denen sie in Kraft getreten ist, alles ihnen Mögliche zu tun, damit Menschen mit Behinderungen im selben Umfang wie alle anderen an der Gemeinschaft teilhaben können. In der Konvention finden sich viele Aspekte wieder, auf die die Behindertenrechtsbewegung in den Jahren zuvor aufmerksam gemacht hatte: Teilhabe, Selbstbestimmung, Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit, Barrierefreiheit und die Anerkennung von Behinderung als Teil menschlicher Vielfalt sind zentrale Grundsätze des Vertrages.
Behinderungen entstehen erst im Zusammenspiel mit Hindernissen
Keine Form körperlicher, seelischer oder geistiger Besonderheit wird in diesem Vertragstext als Problem oder von vorneherein als Behinderung betrachtet. Behinderungen treten demzufolge erst dann auf, wenn zu individuellen Einschränkungen Hindernisse hinzukommen, die von anderen Menschen gemacht oder nicht abgebaut wurden und Zugänge versperren ("man-made-barrieres"). Behinderung wird als selbstverständlicher Bestandteil menschlichen Lebens und menschlicher Gesellschaft ausdrücklich als eine Besonderheit unter vielen erachtet und darüber hinaus als Quelle möglicher kultureller Bereicherung wertgeschätzt.
Der Begriff der "Inklusion" in der Behindertenrechtskonvention beschreibt, dass alle Menschen verschieden sind und in dieser Unterschiedlichkeit überall dabei sein sollen, wenn sie das wollen. Um dies zu verwirklichen, müssen alle Menschen nicht nur Zugang zu allen Angeboten haben, sondern auch willkommen geheißen werden. Behinderung wird damit nicht mehr als rein individuelles Problem behandelt, um dessen Behebung sich jede und jeder Einzelne selbst kümmern muss.
Die von Menschen gemachten Barrieren können sehr unterschiedlich sein, und nicht alle Menschen empfinden Barrieren gleich. So werden in der Behindertenrechtskonvention zum Beispiel Mädchen und Frauen mit Behinderung als besonders häufig von Gewalt, Ausgrenzung und Armut betroffen genannt. Die Staaten haben sich verpflichtet, für solche Gruppen, aber auch für einzelne Menschen speziell bestehende Barrieren und Gefahren zu reduzieren. Dazu müssen Schulen, Arztpraxen, Busse, Kinos und alle anderen öffentlichen Einrichtungen so umgestaltet werden, dass alle Menschen hereinkommen können und willkommen geheißen werden.
Um zu überwachen, ob die Verpflichtungen aus der Konvention auch tatsächlich umgesetzt werden, soll es in allen Staaten eine Stelle geben, die diesen Prozess überwacht. In Deutschland ist dafür die Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte zuständig.
Damit sich alle Menschen tatsächlich willkommen fühlen können, reicht es jedoch nicht aus, Treppen durch Aufzüge zu ersetzen. Nicht nur die Staaten, sondern auch alle Menschen sind aufgefordert, auf mögliche Barrieren zu achten, die anderen Menschen Zugänge erschweren. Hierfür ist es wichtig, auch die Barrieren im eigenen Kopf beiseite zu räumen.
Materialien
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache
Was ist "Leichte Sprache"?
Lesen und Schreiben sind sehr wichtig, um sich zu informieren und sich mitzuteilen. Viele Texte sind aber zu kompliziert geschrieben. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten, und auch für viele andere Menschen. Auch viele Vorträge sind schwer zu verstehen. Deswegen setzt sich der Verein "Mensch zuerst" in Kassel seit über zehn Jahren für mehr Texte in Leichter Sprache ein. Die Idee kam aus den USA, dort engagieren sich Gruppen von Menschen mit Lernschwierigkeiten schon seit den 70er-Jahren für Leichte Sprache. Außer "Mensch zuerst" setzen sich in Deutschland noch andere Personen und Gruppen für diese Sprache ein. Denn alle Menschen sollen sich verständigen können und verstehen können, was um sie herum passiert. Das ist ihr Recht. Es ist auch ein Menschenrecht.
Ziel der Leichten Sprache ist es, alles ganz leicht verständlich zu schreiben oder zu sagen. Das erleichtert nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten das Leben, sondern allen anderen Menschen auch. So können alle alles besser verstehen. Das "Netzwerk Leichte Sprache" hat Regeln für die Leichte Sprache aufgeschrieben. Einige der Regeln lauten zum Beispiel: kurze Wörter benutzen, keine Fremdwörter benutzen, Verben verwenden, Aktiv statt Passiv verwenden, in jedem Satz nur eine Aussage machen. Die Texte werden durch viele Bilder erläutert.
Texte in Leichter Sprache erkennt man oft an einem roten Stoppschild mit der Aufschrift: "Halt! Leichte Sprache." Manchmal halten Menschen mit Lernschwierigkeiten bei schwierigen Vorträgen ein rotes Stoppschild hoch um zu fordern, dass in Leichter Sprache vorgetragen wird.
Das Übersetzungsspiel "Schwere Sprache - Leichte Sprache"
Ziel dieser Übung ist es, dass ihr die Leichte Sprache kennenlernt und ausprobiert, wie es ist, Dinge in Leichter Sprache zu schreiben oder zu sagen.
Du findest hier zwei Leitfäden für Leichte Sprache, einen vom Netzwerk Leichte Sprache und einen von der Lebenshilfe Bremen. Du kannst auch im Internet nach weiteren Leitfäden suchen. In ihnen stehen die Regeln für Leichte Sprache.
Lies dir einen Leitfaden deiner Wahl in Ruhe durch. Du kannst das natürlich auch gemeinsam mit jemandem machen oder in einer Gruppe.
Hier findest du ein Beispiel dafür, wie man mit Leichter Sprache und Bildern Dinge einfacher sagen kann. Der "Vertrag über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" wurde in Leichte Sprache übersetzt. In diesem Ausschnitt geht es um das Recht auf Gesundheit:
Das Recht auf Gesundheit in Leichte Sprache übersetzt:
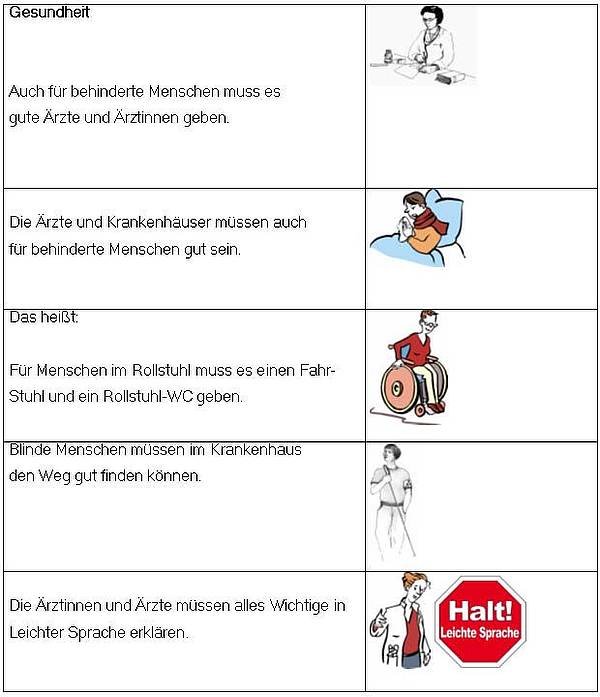
Übersetzungsspiel Schwere Sprache - Leichte Sprache: Deine Aufgabe
Recht auf Bildung
Wenn du dir das Beispiel angeschaut hast, dann lies dir den Text "Recht auf Bildung" durch und überleg dir, wie man das Recht auf Bildung auch einfacher ausdrücken kann. Du findest in der Factbox eine leere Tabelle zum Ausdrucken. Dort kannst du auf der linken Seite deinen einfacher geschriebenen Text eintragen und auf der rechten Seite die passenden Bilder dazu kleben (diese findest du auch in der Factbox).
Wenn euch die Bilder nicht ausreichen, sucht aus dem Internet oder aus Zeitungen weitere Bilder heraus, die das Recht auf Bildung erklären. Wenn ihr fertig seid, tauscht eure Texte aus und lasst eine andere Gruppe erklären, was sie versteht.
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache (komplett)
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache (komplett)
Was ist "Leichte Sprache"?
Lesen und Schreiben sind sehr wichtig, um sich zu informieren und sich mitzuteilen. Viele Texte sind aber zu kompliziert geschrieben. Für Menschen mit Lernschwierigkeiten, und auch für viele andere Menschen. Auch viele Vorträge sind schwer zu verstehen. Deswegen setzt sich der Verein "Mensch zuerst" in Kassel seit über zehn Jahren für mehr Texte in Leichter Sprache ein. Die Idee kam aus den USA, dort engagieren sich Gruppen von Menschen mit Lernschwierigkeiten schon seit den 70er-Jahren für Leichte Sprache. Außer "Mensch zuerst" setzen sich in Deutschland noch andere Personen und Gruppen für diese Sprache ein. Denn alle Menschen sollen sich verständigen können und verstehen können, was um sie herum passiert. Das ist ihr Recht. Es ist auch ein Menschenrecht.
Ziel der Leichten Sprache ist es, alles ganz leicht verständlich zu schreiben oder zu sagen. Das erleichtert nicht nur Menschen mit Lernschwierigkeiten das Leben, sondern allen anderen Menschen auch. So können alle alles besser verstehen. Das "Netzwerk Leichte Sprache" hat Regeln für die Leichte Sprache aufgeschrieben. Einige der Regeln lauten zum Beispiel: kurze Wörter benutzen, keine Fremdwörter benutzen, Verben verwenden, Aktiv statt Passiv verwenden, in jedem Satz nur eine Aussage machen. Die Texte werden durch viele Bilder erläutert.
Texte in Leichter Sprache erkennt man oft an einem roten Stoppschild mit der Aufschrift: "Halt! Leichte Sprache." Manchmal halten Menschen mit Lernschwierigkeiten bei schwierigen Vorträgen ein rotes Stoppschild hoch um zu fordern, dass in Leichter Sprache vorgetragen wird.
Das Übersetzungsspiel "Schwere Sprache - Leichte Sprache"
Ziel dieser Übung ist es, dass ihr die Leichte Sprache kennenlernt und ausprobiert, wie es ist, Dinge in Leichter Sprache zu schreiben oder zu sagen.
Du findest hier zwei Leitfäden für Leichte Sprache, einen vom Netzwerk Leichte Sprache und einen von der Lebenshilfe Bremen. Du kannst auch im Internet nach weiteren Leitfäden suchen. In ihnen stehen die Regeln für Leichte Sprache.
Lies dir einen Leitfaden deiner Wahl in Ruhe durch. Du kannst das natürlich auch gemeinsam mit jemandem machen oder in einer Gruppe.
Netzwerk Leichte Sprache:
Die Regeln für Leichte Sprache (PDF, 1,1 MB, nicht barrierefrei)
Büro für Leichte Sprache, Lebenshilfe Bremen:
Kriterien der Leichten Sprache (PDF, 51 KB, nicht barrierefrei)
Hier findest du ein Beispiel dafür, wie man mit Leichter Sprache und Bildern Dinge einfacher sagen kann. Der "Vertrag über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" wurde in Leichte Sprache übersetzt. In diesem Ausschnitt geht es um das Recht auf Gesundheit:
Das Recht auf Gesundheit in Leichte Sprache übersetzt:
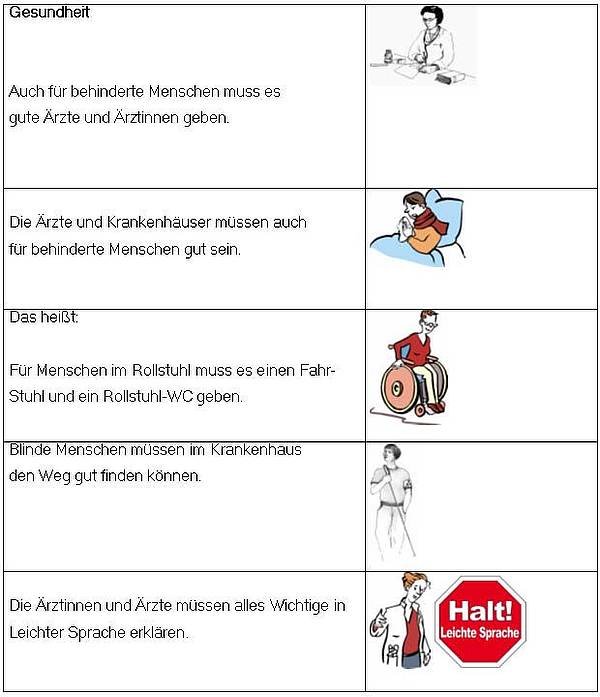
Übersetzungsspiel Schwere Sprache - Leichte Sprache: Deine Aufgabe
Wenn du dir das Beispiel angeschaut hast, dann lies dir den Text der Artikel durch und überleg dir, wie man das Recht auf Bildung auch einfacher ausdrücken kann. Du findest im Anhang eine leere Tabelle zum Ausdrucken. Dort kannst du auf der linken Seite deinen einfacher geschriebenen Text eintragen und auf der rechten Seite die passenden Bilder aus dem Anhang dazu kleben. Wenn euch die Bilder nicht ausreichen, sucht aus dem Internet oder aus Zeitungen weitere Bilder heraus, die das Recht auf Bildung erklären. Wenn ihr fertig seid, tauscht eure Texte aus und lasst eine andere Gruppe erklären, was sie versteht.
Leere Tabelle:

Text: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Recht auf Gesundheit
Artikel 25
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu genießen. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen gender-sensiblen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere
a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des öffentlichen Gesundheitswesens;
b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollen;
c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich an, auch in ländlichen Gebieten;
d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche öffentliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen;
e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen Bedingungen anzubieten;
f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung.
Erklärung zum Text:
Der Text ist eine sogenannte "Schattenübersetzung" vom NETZWERK ARTIKEL 3. Die offizielle Übersetzung war abgestimmt worden, ohne behinderte Menschen zu beteiligen. Ihrer Ansicht nach sind viele wichtige Begriffe falsch übersetzt worden. Die Leute von NETZWERK ARTIKEL 3 korrigierten deshalb diese fehlerhafte Übersetzung. Die falsch übersetzten Begriffe haben sie in der Schattenübersetzung durchgestrichen und die korrekten Wörter hervorgehoben.
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Recht auf Bildung
Artikel 24
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen wirksamen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre erfolgreiche wirksame Bildung zu erleichtern ermöglichen;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration Inklusion wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern fördern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
a) erleichtern fördern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen den peer support und das Mentoring;
b) erleichtern ermöglichen sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen gehörlosen Menschen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner tertiärer Bildung Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.
Erklärung zum Text:
Der Text ist eine sogenannte "Schattenübersetzung" vom NETZWERK ARTIKEL 3. Die offizielle Übersetzung war abgestimmt worden, ohne behinderte Menschen zu beteiligen. Ihrer Ansicht nach sind viele wichtige Begriffe falsch übersetzt worden. Die Leute von NETZWERK ARTIKEL 3 korrigierten deshalb diese fehlerhafte Übersetzung. Die falsch übersetzten Begriffe haben sie in der Schattenübersetzung durchgestrichen und die korrekten Wörter hervorgehoben.
Bilder zur Illustration deiner Übersetzung:

© Netzwerk Leichte Sprache
Weitere Texte in Leichter Sprache
Website "Ich kenne meine Rechte"
Internet-Seite vom Deutschen Institut für Menschen-Rechte in Leichter Sprache
Übersetzungsspiel: Leere Tabelle
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache
Leere Tabelle:

Übersetzungsspiel: Recht auf Gesundheit
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache
Text: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Recht auf Gesundheit
Artikel 25
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu genießen. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen gender-sensiblen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere
a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer Gesundheitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des öffentlichen Gesundheitswesens;
b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollen;
c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich an, auch in ländlichen Gebieten;
d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Menschen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen zu lassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche öffentliche und private Gesundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen;
e) verbieten die Vertragsstaaten die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung, soweit eine solche Versicherung nach innerstaatlichem Recht zulässig ist; solche Versicherungen sind zu fairen und angemessenen Bedingungen anzubieten;
f) verhindern die Vertragsstaaten die diskriminierende Vorenthaltung von Gesundheitsversorgung oder -leistungen oder von Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten aufgrund von Behinderung.
Erklärung zum Text:
Der Text ist eine sogenannte "Schattenübersetzung" vom NETZWERK ARTIKEL 3. Die offizielle Übersetzung war abgestimmt worden, ohne behinderte Menschen zu beteiligen. Ihrer Ansicht nach sind viele wichtige Begriffe falsch übersetzt worden. Die Leute von NETZWERK ARTIKEL 3 korrigierten deshalb diese fehlerhafte Übersetzung. Die falsch übersetzten Begriffe haben sie in der Schattenübersetzung durchgestrichen und die korrekten Wörter hervorgehoben.
Übersetzungsspiel: Recht auf Bildung
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: Recht auf Bildung
Artikel 24
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen wirksamen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen inklusiven, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung erhalten, um ihre erfolgreiche wirksame Bildung zu erleichtern ermöglichen;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration Inklusion wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern fördern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
a) erleichtern fördern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen den peer support und das Mentoring;
b) erleichtern ermöglichen sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen gehörlosen Menschen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner tertiärer Bildung Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.
Erklärung zum Text:
Der Text ist eine sogenannte "Schattenübersetzung" vom NETZWERK ARTIKEL 3. Die offizielle Übersetzung war abgestimmt worden, ohne behinderte Menschen zu beteiligen. Ihrer Ansicht nach sind viele wichtige Begriffe falsch übersetzt worden. Die Leute von NETZWERK ARTIKEL 3 korrigierten deshalb diese fehlerhafte Übersetzung. Die falsch übersetzten Begriffe haben sie in der Schattenübersetzung durchgestrichen und die korrekten Wörter hervorgehoben.
Übersetzungsspiel: Bilder zur Illustration
Übersetzungsspiel: Schwere Sprache – Leichte Sprache
Bilder zur Illustration deiner Übersetzung:

Planspiel: Die Verhandlungen über die Behindertenrechtskonvention bei den Vereinten Nationen
Planspiel: Die Verhandlungen über die Behindertenrechtskonvention bei den Vereinten Nationen in New York
Zum Hintergrund dieses Planspieles
Mit einem Planspiel kannst du gemeinsam mit anderen komplexe Situationen nachspielen und so besser verstehen. Planspiele brauchen Vorbereitungszeit und sollen allen Beteiligten nicht nur neue Einsichten, sondern auch Spaß bringen.
Internationale Menschenrechtsabkommen gelten seit 1969. Staaten, die sich an diese binden, müssen die Verträge einhalten. Die vorhandenen Menschenrechtsdokumente haben sich als lückenhaft herausgestellt. Sie reichten nicht aus, um Menschen mit Behinderungen zur gleichberechtigten Teilnahme in der Gesellschaft und zur Verwirklichung ihrer Rechte zu verhelfen. Menschen mit Behinderungen haben dieselben Rechte wie allen anderen Menschen, können sie jedoch bis heute oft nicht durchsetzen.
Vor allem Behindertenselbsthilfe-Organisationen stritten deshalb seit Jahren für einen neuen Vertrag. Dieser sollte den Bedürfnissen und Erfordernissen von Menschen mit Behinderungen angemessen sein. Um einen solchen Vertragstext zu verfassen, trafen sich seit 2002 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Selbsthilfeorganisationen sowie Vertreterinnen und Vertreter von Staaten im Haus der Vereinten Nationen in New York. Bis 2006 verhandelten sie über den Inhalt des neuen Dokuments, eines Vertrages, der auch "Konvention" genannt wird. Da es so viele Beiträge und Entwürfe gab, wurden viele Arbeitsgruppen gebildet. Es gab bisher bereits acht solcher Verträge, die alle für besondere Anlässe oder Gruppen verfasst wurden. Ihr verhandelt die neunte Menschenrechtskonvention.
Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich speziell mit dem Recht auf Bildung. Die dort geführten Debatten könnt ihr in diesem Planspiel nachvollziehen. Die Arbeitsgruppe stellte ihren Text-Entwurf in der dritten Sitzung im Januar 2004 dem Ausschuss vor. Im Fall dieser Konvention benötigte der Ausschuss acht Sitzungen, die sich über vier Jahre verteilten. An der ersten Sitzung nahmen 80 Mitgliedsstaaten teil und an der letzten 120 Mitgliedsstaaten. Auch viele Nichtregierungsorganisationen und Nationale Menschenrechtsinstitutionen beteiligten sich an den Debatten. Sonderbeauftragte für Behinderungen, die Europäische Kommission und der Europarat waren vertreten. Bei der ersten Sitzung waren es etwa 30 Nichtregierungsorganisationen und bei der letzten 469.
Ziel aller Verhandlungen war es, auf der Grundlage bereits bestehender Menschenrechte einen Katalog von verbindlichen Maßnahmen zu entwerfen, der sich speziell auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen bezieht. Das Ergebnis war das "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen", auch Behindertenrechtskonvention (BRK) genannt. Mit diesem Übereinkommen wird kein neues Recht oder Sonderrecht geschaffen, sondern die Rechte von Menschen mit Behinderungen sollen besser geschützt und dadurch Menschenrechtsverletzungen in Zukunft verhindert werden. Grundlage der Konvention war die Frage, wo und wodurch Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen verletzt werden und welche spezifischen Regelungen benötigt werden, um die Menschenrechte auch von Menschen mit Behinderungen in vollem Umfang zu schützen und zu verwirklichen. Bis zum Jahr 2012 haben 153 Staaten dieses Übereinkommen unterzeichnet. Es enthält 50 Artikel und eine so genannte Präambel. In der Präambel steht, was die Menschen, die die Konvention geschrieben haben, für wichtig hielten, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu verwirklichen. Die BRK ist ein sehr zukunftsweisender Menschenrechtsvertrag. Sie rückt die Rechte von Menschen mit Behinderungen in ein ganz neues Licht. Im Vordergrund steht nicht mehr der Fürsorgegedanke - dass man sich um Menschen mit Behinderungen sorgen muss -, sondern dass sie auch selbst für sich sorgen und selbst entscheiden können. Die BRK spricht dabei von Inklusion. Inklusion bedeutet: die volle Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in das tägliche Leben. Inklusion bedeutet zum Beispiel auf Wohnen bezogen, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Heimen leben müssen. Inklusion in der Schule heißt, dass alle zusammen in eine gemeinsame Schule gehen. Im Arbeitsleben bedeutet Inklusion, dass Menschen mit Behinderungen nicht in speziellen Werkstätten arbeiten müssen, sondern auch überall anders arbeiten können, wenn sie wollen.
Was passiert in diesem Planspiel?
Ihr bildet Arbeitsgruppen, in denen ihr dann gemeinsam all die Rechte und Inhalte diskutiert, die ihr wichtig findet für diesen neuen Menschenrechtsvertrag. Euer Vertrag soll in Zukunft dabei helfen, die Rechte von Menschen mit Behinderungen weltweit zu verwirklichen.
In diesem Planspiel geht es vor allem um den Artikel 24 der neuen Konvention. In ihm soll das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderungen geregelt werden. Dazu ist es zunächst wichtig, euch in die Situation von Menschen mit verschiedenen Behinderungen hineinzudenken, um deren Bedürfnisse und Erfordernisse anschließend gut vertreten zu können. Ebenso wie im echten Verhandlungsprozess gibt es deshalb Stellungnahmen von Menschen mit Behinderungen, diese stehen auf euren Rollenkarten. Die Rollenkarten helfen euch, euch in eure Position im Planspiel hineinzuversetzen. Es ist wichtig, dass ihr euch die Karten aufmerksam durchlest und in eurer Gruppe mögliche Fragen diskutiert. Dabei sollt ihr eure Position auch selbst ausschmücken und euch eigene Standpunkte überlegen. Es ist allerdings auch wichtig, dass ihr nicht allzu sehr von den Vorgaben auf der Rollenkarte abweicht.
Jede Gruppe hat ein eigenes Symbol, so könnt ihr euch und die anderen besser erkennen. Denkt Euch ein Symbol aus, malt es auf Klebeband und klebt es Euch sichtbar für alle auf die Schulter.
Das Planspiel hat zwei Phasen, eine kürzere (Phase 1) und eine längere (Phase 2).
Eure Rolle in diesem Planspiel
Ihr seid Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen oder Nichtregierungsorganisationen, Angehörige von Menschen mit Behinderungen oder habt selbst eine Behinderung. Eure Aufgabe ist es, den Inhalt der Behindertenrechtskonvention, speziell des Artikels 24 zum Recht auf Bildung, zu diskutieren und so auszugestalten, wie ihr wollt. Ihr sollt keinen langen Text schreiben, sondern euch auf einen Katalog von Maßnahmen, Vorkehrungen und Prinzipien einigen, die das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderungen sicherstellen können. Dabei sind die Ergebnisse ganz offen und hängen von euren Diskussionen in den Gruppen, aber auch zwischen den Gruppen, ab.
Vorbereitung und Moderation
Die Organisationsgruppe arbeitet sich vorher in das Spiel ein und erklärt euch dann zu Beginn das Wichtigste und behält den Überblick. Ein Moderationsteam und mehrere Kleingruppen werden gebildet: durch Auslosen, Abzählen oder/und mit Hilfe der Landkarte.
Die Gruppen: Variante 1: 20 bis 100 Beteiligte
Das Moderationsteam verteilt jeweils eine Kurzanleitung und ein Rollenkärtchen und eine Kopie von Anhang II an die Gruppen. Diese machen sich mit ihren Rollen und den Materialen vertraut und bestimmen Vertreterinnen und Vertreter, die später die Position der Gruppe zusammenfassen und in der Großgruppe vertreten.
Das Ziel der Gruppen besteht zunächst darin, folgende Fragen zu beantworten:
- Wer sind wir? (unsere Rolle)
- Was wollen wir?
- Wie kriegen wir das, was wir wollen und wie gehen wir als Gruppe dabei vor?
Ihr dürft Euch in Euren Gruppen Identitäten und Hintergründe zurechtlegen und ausschmücken, um die Rolle mit Leben zu füllen und zu gestalten. Dabei dürfen zusätzliche Informationen erfunden werden, jedoch sollt ihr euch nicht zu weit von den Angaben auf eurer Karte entfernen.
Variante 2: 12 bis 20 Beteiligte
Das Moderationsteam verteilt jeweils eine Kurzanleitung und ein Rollenkärtchen an einzelne Personen oder Zweierpaare. Diese arbeiten sich ein. Gebt ihnen die Anweisung, dass sie die Rolle ausschmücken können mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten, eigenen Erfahrungen. Dabei darf erfunden und geschwindelt werden, jedoch sollen die Angaben auf der Rollenkarte dabei leitend und bindend sein für Alle.
Auch in dieser Variante sollen die Personen oder Kleingruppen folgende Fragen beantworten:
- Wer bin ich beziehungsweise wer sind wir? (meine bzw. unsere Rolle)
- Was will ich bzw. was wollen wir?
- Wie kriege ich das, was ich will, wie gehe ich dabei vor? Beziehungsweise wie kriegen wir das, was wir wollen, wie gehen wir als Gruppe dabei vor?
Die Moderation
Das Moderationsteam und ein Organisationsteam lesen vor Spielbeginn den Einleitungstext und die Übersicht der Rollenkarten. Die Teams tauschen sich aus und treffen Absprachen, bevor das Spiel beginnt.
Die Moderation stellt zu Beginn des Spiels die Kerninhalte der Diskussion und der einzelnen Spielphasen vor, erläutert kurz, wer alles am Spiel beteiligt ist und den Spielablauf. Die Moderation führt durch das gesamte Spiel, begrüßt, stellt die einzelnen Gruppen-Sprecherinnen und -Sprecher vor, legt die Reihenfolge der Wortmeldungen fest, moderiert die Diskussion. Die Moderation hat also viele wichtige Aufgaben. Am Ende des Spiels leitet sie gemeinsam mit der Organisation die Auswertung des Geschehenen.
So funktioniert dieses Planspiel
Dieses Material braucht ihr für das Planspiel:
Stühle, Papier, Klebestreifen, Stifte, Flipchart, Rollenkarten und Kopien des Anhangs.
Zeit insgesamt etwa 5-6 Stunden
Phase 1: Gruppenfindung
Die Moderationsgruppe begrüßt die Teilnehmenden und führt kurz ein, warum sich alle heute im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York versammelt haben.
Folgende Gruppen stehen neben der Moderationsgruppe und der Organisationsgruppe zur Auswahl, sucht Euch mit Hilfe der Landkarte (Anhang I) eine aus:
- Internationales Bündnis von Menschen mit Behinderungen/ International Disability Alliance
- Weltorganisation gehörloser Menschen, Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen, Weltorganisation für blinde Menschen
- Inklusion International
- Australische Regierungsdelegation
- Norwegische Regierungsdelegation
- Kanadische Regierungsdelegation
- Chinesische Regierungsdelegation
- Japanische Regierungsdelegation
- Afrikanische Union
- Brasilianische Regierungsdelegation
- Europäische Union
Wenn ihr euch in den Gruppen zusammengefunden habt, habt ihr insgesamt 45 Minuten Zeit.
- Macht euch noch mal gemeinsam mit dem Hintergrundtext vertraut. Lest ihn aufmerksam durch, damit euch noch einmal klarer wird, um was es in diesem Spiel geht.
- Danach macht ihr euch mit euren Rollenkarten und der darauf geschilderten Phase 1 vertraut. Zu Phase 1 findet ihr ganz zu Beginn eine Aussage von einem Menschen mit Behinderungen. Bittet jemand aus eurer Gruppe diese Aussage vorzulesen.
- Danach beschäftigt ihr euch mit eurer Rolle in Phase 1. Ihr könnt mit eurer Rolle und Meinung ganz offen umgehen. Diskutiert in der Gruppe, um was es auf eurer Karte geht. Schmückt eure Rolle aus, erfindet Sachen dazu. Ihr könnt improvisieren, aber entfernt euch nicht allzu weit von eurer Rolle.
- Wählt eine Farbe bzw. ein Emblem und eine Sprecherin oder einen Sprecher, die oder der euch bei den Verhandlungen in der großen Gruppe vertritt und malt sie danach auf eure Klebestreifen, die ihr danach sichtbar an der Schulter befestigt.
- Schreibt eure Forderungen und Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel.
Beachtet bitte: in dieser Phase steht das Recht auf Bildung noch nicht im Mittelpunkt!
Anschließend bittet die Moderation eure Sprecherin oder euren Sprecher, eure Ergebnisse in der Versammlung vorzustellen. Aufgrund des Zeitdrucks werdet ihr höflich gebeten, nur 2 Minuten zu sprechen. Stellt euch kurz vor, wie ihr heißt, wen ihr vertretet und was ihr fordert. Dabei könnt ihr das Flipchart präsentieren.
Anschließend findet eine Nachfragerunde statt. Diese sollte nicht länger als 10 Minuten dauern. Hier könnt ihr Fragen an die Versammlungsteilnehmenden richten und schon eine erste kleine Diskussion starten. Die Moderation ist also hier schon gefragt.
Verhandlungsunterbrechung
Identifikation mit der Rolle und Austausch (10 Minuten)
Wie bei den Vereinten Nationen findet auch in eurer Verhandlungsunterbrechung ein Austausch mit eurer Gruppe, aber auch mit anderen Gruppen statt. Das Ziel der Unterbrechung ist es, sich mehr mit der eigenen Rolle zu identifizieren und mit der eigenen Gruppe zu sprechen, um weitere Argumente zu finden. Ihr nutzt die Zeit aber auch, um mehr über die anderen Gruppen, ihre Rollen und Forderungen zu erfahren. Ihr könnt die Zeit auch für informelle Gespräche und den Austausch von Ideen verwenden. Ihr bleibt dabei die ganze Zeit in eurer Rolle!
Phase 2: Diskussion zum Recht auf Bildung
Die Moderation beendet die Verhandlungsunterbrechung und führt in die zweite Runde ein.
Sie weist darauf hin, dass nun vor allem das Recht auf Bildung näher beleuchtet und diskutiert werden soll.
Dabei helfen euch die Rollenkarten "Phase 2". Auch hier ist wieder eine Aussage von einem Menschen mit Behinderungen zu finden. Bittet wieder jemanden aus eurer Gruppe, die Aussage vorzulesen. Dann versetzt euch wieder in eure Rolle. Jetzt geht es speziell um das Recht auf Bildung. Diese Spielphase ist länger und intensiver als die erste, denn nun sollt ihr richtig diskutieren und euch einigen. Bereitet euch also gut vor und überlegt euch Argumente und Ideen, auch über den Text auf euren Karten hinaus.
Dabei können euch auch die Artikel zum Recht auf Bildung aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Sozialpakt und der Kinderrechtskonvention im Anhang II helfen. Sie liefern euch vielleicht neue Ideen und wichtige Argumente.
Erarbeitet gemeinsam als Gruppe Stichpunkte dazu, was eurer Meinung nach konkret zum Recht auf Bildung in dem neuen Vertrag stehen sollte. Einigt euch auf die aus eurer Sicht drei wichtigsten Punkte und schreibt diese auf ein Flipchart.
Bittet wieder eure Sprecherin oder euren Sprecher, der Gesamtgruppe eure Ergebnisse vorzustellen (2 Minuten Zeit). Es kann auch jemand anderes für eure Gruppe sprechen als in Phase 1. Die Moderation übernimmt wieder die Einleitung und legt auch die Gesprächsreihenfolge fest. Nachdem alle Gruppen ihre Ergebnisse im Plenum vorgestellt haben, fasst die Moderation diese noch mal zusammen.
Dann beginnt die gemeinsame Diskussion mit allen Beteiligten. Die Sprecher und Sprecherinnen der Gruppen vertreten ihre Gruppenmitglieder, die aber auch ergänzen dürfen, wenn es ihnen wichtig erscheint. Die Moderation ist nun sehr gefordert, denn alle Gruppen sollen zu Wort kommen, aber die Zeit (ca. 15 Minuten) muss eingehalten werden. Es geht darum, sich nun in der großen Gruppe auf die drei wichtigsten Punkte für den Artikel zum Recht auf Bildung zu einigen. Dabei gibt es Vertreterinnen und Vertreter, die sich von anderen Meinungen überzeugen lassen und solche, die sich nicht überzeugen lassen. Es gibt auch versteckte Angriffe. Und alle wollen zu Wort kommen. Wichtig: Das Diskussionsergebnis ist offen, es gibt keine Vorgaben. Auch in dieser Spiel-Phase gibt es eine 10-minütige Verhandlungsunterbrechung. Währenddessen bleibt ihr in euren Rollen und diskutiert in eurer Gruppe und mit anderen weiter.
Verhandlungsunterbrechung (10 Minuten)
Versucht, die Zeit für lockerere Gespräche mit anderen und Absprachen in eurer eigenen Gruppe zu nutzen. Versucht auch, euch gegenseitig zu überzeugen. Erklärt den anderen, warum ihr eure Position vertretet und warum sie sich euch anschließen sollten. Versucht zu verhandeln, denn die Zeit schreitet voran und ihr wollt euch in der nächsten Verhandlungsphase einigen.
Die Moderation bittet alle zurück in den Verhandlungsraum. Ihr diskutiert weiter (ca. 15 Minuten) und die Moderation strukturiert weiterhin die Debatte. Die Moderation lenkt schließlich die Diskussion auf ein Ende hin und versucht, die gesamte Gruppe zu einer Einigung zu bewegen. Hierbei ist viel Diplomatie gefragt! Denn jede und jeder soll sich ernst genommen fühlen und später auch mit dem Vertrag zufrieden sein. Dieser soll ja weltweit gelten und dafür ist es wichtig, dass niemand verärgert ist.
Phase 3: Rückblick und Auswertung
Diese Phase soll dem Feedback dienen und max. 45 Minuten dauern. Dazu dürft ihr eure Rolle verlassen; wer möchte, kann die Rolle im wörtlichen Sinne abstreifen oder abschütteln. Auch die Moderation gibt nun die Rolle der Verhandlungsführung auf.
Tauscht euch nun gemeinsam mithilfe der Organisation aus. Besprecht dabei, was ihr Neues gelernt habt, was euch außerdem noch interessieren würde und welche Fragen offen geblieben sind. Beantwortet auch folgende Fragen:
- Wer hat welche Position vertreten, wer hat seine Meinung geändert, wer ist sich seiner Meinung nicht ganz sicher?
- Wie hat euch das Spiel gefallen?
- Welche Informationen haben euch gefehlt und wollt ihr nun gerne recherchieren?
Zum Abschluss sollte die Organisation den Originalartikel zum Recht auf Bildung aus der Behindertenrechtskonvention vorlesen. Tauscht euch dann gemeinsam über den Inhalt, die Unterschiede zu und Gemeinsamkeiten mit euren Diskussionen und Ergebnissen aus.
Weiter zur Kurzanleitung, zu den Rollenkarten und weiteren Infos:
Planspiel: Kurzanleitung
Planspiel: Infos für Moderationsgruppe und Organisationsgruppe
Planspiel: Moderationsgruppe
Planspiel: Afrikanische Union
Planspiel: Australische Regierungsdelegation
Planspiel: Brasilianische Regierungsdelegation
Planspiel: Chinesische Regierungsdelegation
Planspiel: Europäische Union
Planspiel: Internationales Bündnis von Menschen mit Behinderungen
Planspiel: Inclusion International
Planspiel: Japanische Regierungsdelegation
Planspiel: Kanadische Regierungsdelegation
Planspiel: Norwegische Regierungsdelegation
Planspiel: Weltorganisation gehörloser Menschen, Weltorganisation für gehörlosblinde Menschen, Weltorganisation für blinde Menschen
Planspiel: Weltkarte
Planspiel: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Sozialpakt und Kinderrechtskonvention
Planspiel: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Art. 24 in Leichter Sprache
Planspiel: Kurzanleitung
Kurzanleitung des Planspiels
Die Verhandlungen über das "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" bei den Vereinten Nationen in New York
Phase 1: Gruppenfindung/Vorbereitung
- Eine Organisationsgruppe und eine Moderationsgruppe bereiten das Spiel vor.
- Einteilung der Teilnehmenden in Gruppen durch auslosen, abzählen, wählen. Hier hilft euch die Landkarte aus Anhang I.
- Die Moderationsgruppe macht sich mit dem Spielablauf vertraut und erklärt dann den Teilnehmenden das Ziel und den Verlauf des Planspiels.
- Die Rollenkarten und die Texte aus dem Anhang werden verteilt. Jede Gruppe hat 45 Minuten Zeit, um sich einzuarbeiten, wichtige Ziele der Gruppe zu besprechen und ein Gruppensymbol zu finden. In jeder Gruppe werden eine Sprecherin oder ein Sprecher bzw. zwei Sprecherinnen oder Sprecher gewählt, die später die Gruppenergebnisse in der Versammlung vorstellen.
- Das Planspiel beginnt mit der Begrüßung durch die Moderation.
- Die Gruppen stellen sich, ihre Positionen und ihre Forderungen an den Vertrag vor (maximal 2 Minuten pro Gruppe).
- Zeit für Nachfragen (maximal 10 Minuten insgesamt).
- Verhandlungsunterbrechung: weiterer Austausch in den Gruppen und mit anderen Gruppen, alle bleiben dabei in ihren Rollen (10 Minuten).
Phase 2: Diskussion zum Recht auf Bildung
- Einführung durch die Moderationsgruppe und kurzer Überblick über die zweite Phase.
- Arbeit in den Gruppen zum Thema Recht auf Bildung (30 Minuten).
- Hintergrund-Recherche anhand der Texte aus dem Anhang: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Sozialpakt und Kinderrechtskonvention.
- Die Sprecher und Sprecherinnen der Gruppen stellen ihre Ergebnisse zum Recht auf Bildung vor (maximal 2 Minuten pro Gruppe). Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch jemand anderen für die Gruppe sprechen lassen als in Phase 1.
- Die Moderation fasst die Ergebnisse kurz zusammen.
- Diskussion, die von der Moderation geführt wird (etwa 15 Minuten).
- Verhandlungsunterbrechung: Sprecht euch in der eigenen Gruppe noch mal ab oder versucht, die anderen Gruppen zu überzeugen. Alle bleiben dabei in ihren Rollen (maximal 10 Minuten).
- Ihr diskutiert weiter und einigt euch dabei auf die drei wichtigsten Punkte für den Artikel zum Recht auf Bildung. Hierbei ist die Diplomatie der Moderation gefragt!
Phase 3: Rückblick und Auswertung
- Verlasst eure Rollen, indem ihr sie abstreift oder abschüttelt (auch die Moderationsgruppe gibt ihre Rolle auf).
- Die Organisationsgruppe liest den Originaltext zum Recht auf Bildung aus der Behindertenrechtskonvention vor und berichtet von ihren Beobachtungen während der Verhandlung.
- Die Gesamtgruppe bespricht den Verlauf der Diskussion, den Inhalt des Artikels 24 und die Beobachtungen der Organisationsgruppe.
Dieses Material braucht ihr für das Planspiel:
Stühle, Papier, Stifte, Flipchart, Kleberolle, Rollenkarten und Kopien des Anhangs.
Zur Vorbereitung des Planspiels
Die Gruppe wird in maximal 13 Kleingruppen eingeteilt. Eine Gruppe ist für die Moderation verantwortlich, eine für die Organisation, die anderen elf Gruppen nehmen jeweils eine Rolle ein.
Jede Gruppe soll aus mindestens zwei, aber nicht mehr als acht Personen bestehen. In der Gruppe "Moderation" sollen möglichst mehr als zwei Personen mitarbeiten.
Sobald die Rollen verteilt sind, erhalten alle Gruppen ihre Rollenbeschreibung und Kopien des Anhangs. Jede Gruppe wählt ein Emblem bzw. eine Farbe, damit deutlich wird, wer zu welcher Gruppe gehört, malt sie auf klebendes Papier und klebt sie an die Schulter. Nun könnt ihr euch auf die Versammlung vorbereiten. Dazu habt ihr 45 Minuten Zeit.
Moderation und Organisation sollten sich vor dem Spiel mit allen Rollenkarten und Materialien vertraut machen, um auch das Spiel für die Mitspielenden möglicherweise noch ein wenig anzupassen und gut durch das Spiel führen zu können.
Planspiel: Variante 1
Planspiel, Variante 1: 20 bis 100 Beteiligte
Das Moderationsteam verteilt jeweils eine Kurzanleitung und ein Rollenkärtchen und eine Kopie von Anhang II an die Gruppen. Diese machen sich mit ihren Rollen und den Materialen vertraut und bestimmen Vertreterinnen und Vertreter, die später die Position der Gruppe zusammenfassen und in der Großgruppe vertreten.
Das Ziel der Gruppen besteht zunächst darin, folgende Fragen zu beantworten:
- Wer sind wir? (unsere Rolle)
- Was wollen wir?
- Wie kriegen wir das, was wir wollen und wie gehen wir als Gruppe dabei vor?
Ihr dürft euch in euren Gruppen Identitäten und Hintergründe zurechtlegen und ausschmücken, um die Rolle mit Leben zu füllen und zu gestalten. Dabei dürfen zusätzliche Informationen erfunden werden, jedoch sollt ihr euch nicht zu weit von den Angaben auf eurer Karte entfernen.
Planspiel: Variante 2
Planspiel, Variante 2: 12 bis 20 Beteiligte
Das Moderationsteam verteilt jeweils eine Kurzanleitung und ein Rollenkärtchen an einzelne Personen oder Zweierpaare. Diese arbeiten sich ein. Gebt ihnen die Anweisung, dass sie die Rolle ausschmücken können mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten, eigenen Erfahrungen. Dabei darf erfunden und geschwindelt werden, jedoch sollen die Angaben auf der Rollenkarte dabei leitend und bindend sein für Alle.
Auch in dieser Variante sollen die Personen oder Kleingruppen folgende Fragen beantworten:
- Wer bin ich beziehungsweise wer sind wir? (meine bzw. unsere Rolle)
- Was will ich bzw. was wollen wir?
- Wie kriege ich das, was ich will, wie gehe ich dabei vor? Beziehungsweise wie kriegen wir das, was wir wollen, wie gehen wir als Gruppe dabei vor?
Planspiel: Infos für Moderationsgruppe und Organisationsgruppe
Infos für Moderationsgruppe und Organisationsgruppe
Die Verhandlungen über das "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" bei den Vereinten Nationen in New York
Zum Vorlesen
Auf allen Rollenkarten stehen zur Einstimmung auf Phase 1 und 2 folgende Aussagen von Menschen mit Behinderungen. Jemand aus der Moderationsgruppe liest den Text zur Einstimmung auf die jeweilige Phase für alle vor.
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen."
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde."
Zusammenfassung der Rollenkarten
Weltorganisation gehörloser Menschen, Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen, Weltorganisation für blinde Menschen:
Phase 1:
- Die drei Weltorganisationen fordern: Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen muss umfassend verbessert werden. Vor allem in den Bereichen Sprache und Kommunikation. Menschen, die gehörlos, blind oder hörsehbehindert sind, fühlen sich aufgrund ihrer Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen, als die am stärksten ausgeschlossene Gruppe von Menschen mit Behinderungen.
- Die Organisationen fordern, dass auf die Bedürfnisse von Menschen mit Sinnesbehinderungen eingegangen werden muss und fordern die Umsetzung beispielsweise folgender Punkte:
Verkehrsampeln müssen eine Vibrations- und Sprachfunktion haben; Hörfilme und Übersetzungen in Gebärdensprache müssen ins Fernsehen; Persönliche Assistenzen müssen vorhanden sein, um sich orientieren zu können; Geldscheine und Münzen müssen blinden- und sehbehindertengerecht sein.
Phase 2:
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen, Weltorganisation für blinde Menschen fordern vor allem ein Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen. Sie sind der Meinung, dass die speziellen Bedürfnisse derer, die sie vertreten, nicht in einer Schule für Alle berücksichtigt werden können. Denn sie brauchen spezielle Hilfsmittel und vor allem spezielle Unterstützung, um Kontakte knüpfen zu können.
Norwegische Regierungsdelegation
Phase 1:
- Die norwegische Regierungsdelegation ist für die weltweite Einführung des Universellen Designs. Universelles Design bedeutet, dass zum Beispiel Haushaltsgeräte so entwickelt und gestaltet werden, dass jede und jeder sie bedienen kann. Egal, ob jemand eine Sehbehinderung hat oder zum Beispiel nicht stehen kann. Die Geräte sollen für Menschen mit und ohne Behinderungen gleich sein.
Phase 2:
Norwegen hat keine speziellen Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben soll. Für Norwegen ist vor allem wichtig, dass die Notwendigkeit des Lebenslangen Lernens anerkannt wird. Bildung soll nicht nur für Kinder gelten und wichtig sein, sondern auch ältere und alte Menschen berücksichtigen. Dabei ist auch wichtig, dass alle Bildungseinrichtungen das Universelle Design berücksichtigen.
Japanische Regierungsdelegation
Phase 1:
- Die japanische Regierungsdelegation ist der Meinung, dass die Sicherung der Freiheit und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen noch ausgebaut werden muss.
- Japan fordert, dass die Versammlungs- und Meinungsfreiheit von Menschen mit Behinderungen gefördert und unterstützt werden muss.
Phase 2:
Japan fordert, dass es weiterhin ein Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen geben muss. Die Vertreterinnen und Vertreter meinen, dass vielleicht nicht jedes Land genügend finanzielle Mittel hat, um eine Schule für Alle zu finanzieren. Ihnen ist nicht klar, wie so etwas umgesetzt werden soll. Sie setzen sich auch für die Einführung eines weltweiten kostenlosen Schulbesuchs ein.
International Disability Alliance/ Internationales Bündnis von Menschen mit Behinderungen
Phase 1:
- Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen ist der Meinung, dass die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen nicht neu erfunden werden müssen. Sie sollen sich vielmehr an den bereits bestehenden Menschenrechten orientieren. Ihnen ist sehr wichtig, diesen Vertrag zu verhandeln, da Menschen mit Behinderungen in den bestehenden Konventionen entweder ganz vergessen oder nur kurz erwähnt wurden. Das muss sich in der neuen Konvention ändern.
- Das Bündnis fordert eine umfassende Berücksichtigung der Rechte von Menschen mit Behinderungen, vor allem in den Bereichen Gleichheit und Nichtdiskriminierung.
Phase 2:
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle. Sie fordern, dass alle Schulen Brailleschrift, Leichte Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen anbieten müssen, genauso wie Englisch oder Türkisch. Die Schulen müssen zudem genügend Hilfsmittel, Lehrkräfte und Assistenzen haben, damit sich alle Schülerinnen und Schüler angenommen fühlen.
Chinesische Regierungsdelegation
Phase 1:
- Die chinesische Regierung wird häufig wegen Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land angegriffen. Die chinesische Regierungsdelegation setzt sich vor allem für die Bekämpfung der Armut von Menschen mit Behinderungen ein. Denn ihr ist klar, dass es zwischen Behinderung und Armut einen engen Zusammenhang gibt.
- China fordert die Förderung der Armutsbekämpfung von Menschen mit Behinderungen, beispielsweise durch Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche.
Phase 2:
China fordert, dass es Schulen für alle Kinder auf der Welt geben muss, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle. Denn alle Schulen verwirklichen das Recht auf Bildung, so die Delegation.
Australische Regierungsdelegation
Phase 1:
- Die australische Regierungsdelegation ist der Meinung, dass es im Leben von Menschen mit Behinderungen zu viele Hindernisse gibt.
- Australien fordert deswegen ein Recht auf Barrierefreiheit. Das bedeutet, dass es zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, auf Straßen, im Gesundheits- und Bildungswesen für Menschen mit Behinderungen keine Hindernisse mehr geben darf.
Phase 2:
Australien fordert eine Schule für Alle. Die Delegation ist der Meinung, dass in einer Schule keine Leistungen abgerufen werden sollten. Kinder sollten zudem durch Bildung auch ihre sozialen Fähigkeiten verbessern. Kinder mit Behinderungen sollten unbedingt in Schulen in ihren Gemeinden gehen, also dahin, wo auch die Kinder aus der Nachbarschaft hingehen. Dafür fordern sie regelmäßige Mobilitätstrainings.
Afrikanische Union
Phase 1:
- Die Vertreterinnen und Vertreter der Afrikanischen Union setzen sich vor allem für die Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen ein. Denn sie werden sehr stark vernachlässigt und haben oft keinen Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung.
- Die Afrikanische Union fordert, dass die Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen gestärkt werden müssen.
Phase 2:
Die Afrikanische Union fordert eine Schule für Alle. Dabei sollten Mädchen besonders berücksichtigt werden. Dazu müssten zum Beispiel die Lehrplänen verändert werden.
Inclusion International
Phase 1:
- Inclusion International setzt sich für Menschen mit geistiger Behinderung ein. Diese möchten lieber "Menschen mit Lernschwierigkeiten" genannt werden.
- Inclusion International fordert, dass der wertvolle Beitrag, den Menschen mit Behinderungen in jeder Gesellschaft leisten, anerkannt wird.
Phase 2:
Inclusion International fordert eine Schule für Alle. Denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabung von allen Kindern fördern. Hierfür müssen die Schulen sehr gut ausgestattet sein.
Europäische Union
Phase 1:
- Die Europäische Union setzt sich für die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen ein, damit sie gleichberechtigt mit allen anderen Menschen in der Gemeinschaft leben können.
- Die EU fordert, dass eine völlige Chancengleichheit umgesetzt wird, denn sonst würden die Rechte von Menschen mit Behinderungen weiterhin verletzt.
Phase 2:
Die Europäische Union fordert die Verwirklichung der Chancengleichheit. Auf ein Schulsystem legt sie sich nicht fest, findet aber eine Schule für Alle prinzipiell den richtigen Weg.
Brasilianische Regierungsdelegation
Phase 1:
- Die brasilianische Regierungsdelegation setzt sich für die Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen ein. Sie sollen frei von Diskriminierung in ihrer Gesellschaft leben können. Denn alle Menschen haben die gleichen Rechte.
- Brasilien fordert Nichtdiskriminierung, Gleichheit und volle Teilhabe aller Menschen.
Phase 2:
Brasilien fordert eine Schule für Alle. Denn Bildung soll die Einstellungen der Menschen verändern. Das negative Bild von Menschen mit Behinderungen, das viele Menschen haben, soll sich in ein positives Bild verändern. Dafür sei eine gemeinsame Bildung wichtig.
Kanadische Regierungsdelegation
Phase 1:
- Die kanadische Regierungsdelegation setzt sich besonders für den Schutz von Menschen mit Behinderungen ein. Denn wenn Menschen mit Behinderungen diskriminiert oder schlecht behandelt werden, verletzt dies ihre Würde. Alle Menschen haben die gleiche Würde und das gleiche Recht auf Schutz.
- Kanada fordert den Schutz der Würde aller Menschen.
Phase 2:
Kanada fordert eine Schule für Alle. Sie soll schrittweise umgesetzt werden. Denn auch die Bildung soll der Würde der Kinder gerecht werden und diese schützen.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Moderationsgruppe
Planspiel: Rollenkarte Moderationsgruppe
Vorbereitung
- Ihr lest den Einleitungstext, eure Rollenkarte und die Übersicht über die Rollen der anderen, damit ihr wisst: um welche Situation es geht, wer eure Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind und welche Standpunkte sie vertreten.
- Bestimmt zwei Sprecherinnen oder Sprecher für die Moderation. Alle anderen übernehmen folgende Aufgaben: Zeitwächter, Zeitwächterin: Eure Aufgabe ist es, auf die vereinbarten Zeiten zu achten. Beobachter, Beobachterin: Eure Aufgabe ist es, wichtige Argumente aufzuschreiben sowie zu beobachten, ob sich vielleicht jemand von den Argumenten einer anderen Person überzeugen lässt. Eure Aufzeichnungen sind sehr wichtig für alle, denn nur mit ihnen ist es nach dem Ende des Planspiels möglich, noch einmal in Ruhe über die Argumente nachzudenken oder sie weiter zu diskutieren und auch eine Einigung zu finden.
Gemeinsam erarbeitet ihr einen kurzen Text, mit dem ihr das Spiel einleiten könnt.
Hier ein Beispiel:
"Ich möchte alle Anwesenden herzlich zu dieser großen Stunde begrüßen. Nach mehr als 20 Jahren haben wir alle das Privileg, gemeinsam einen Menschenrechtsvertrag für die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu erarbeiten. Wir haben hierfür nur wenig Zeit und mir ist es ein besonderes Anliegen, alle am Prozess Beteiligten gleichermaßen zu hören und ihren Beitrag wertzuschätzen. Wir verhandeln in zwei Phasen. Zunächst soll geklärt werden, was Sie ganz allgemein von dem Vertrag erwarten und im nächsten Schritt, was Sie vom Artikel zum Recht auf Bildung erwarten..."
- Dann bestimmt ihr eine Sitzordnung für das Planspiel. Überlegt: Ist es gut ist, wenn gegensätzliche Positionen nebeneinander am Tisch sitzen?
- Ihr legt ebenfalls fest, in welcher Reihenfolge die Teilnehmenden sprechen sollen. Überlegt: Wann ist ein Planspiel spannender: Wenn die gegnerischen Positionen abwechselnd sprechen oder wenn erst einige Personen für eine Position und dann die anderen für die gegnerische Position sprechen?
- Nach 45 Minuten ist die Vorbereitungszeit der Gruppen beendet. Ihr ladet die Sprecherinnen und Sprecher der Kleingruppen – eure Verhandlungsgäste - ein, Platz zu nehmen. Dann stellt ihr die Teilnehmenden einander vor und erklärt, um was es heute gehen soll und wie der Ablauf sein wird. Danach folgt eure Einleitung. Fordert dann die Personen nacheinander auf, dazu kurz - in zwei Minuten - Stellung zu nehmen. Fasst anschließend das Gesagte zusammen.
Nach einer 10-minütigen Verhandlungsunterbrechung, in der auch ihr in eurer Rolle bleibt und Zeit habt euch auszutauschen, beginnt die zweite Spielphase. Darin seid ihr sehr gefordert, denn ihr leitet die Diskussion und sollt gemeinsam mit den anderen zu einem Ergebnis kommen. Die Verhandlungspartner werden vor allem bei der Frage, was für eine Schule es in Zukunft geben soll, ganz unterschiedlicher Meinung sein. Manche fordern eine Schule für Alle. Das bedeutet, dass Kinder mit und Kinder ohne Behinderungen gemeinsam in die Schule und in die selbe Klasse gehen. Dafür braucht es viel Unterstützung für alle Kinder und gut ausgestattete Schulen. Andere hingegen denken, es ist nicht gut, eine Schule für Alle zu fordern, denn manchen Kindern mit Behinderungen könnte es in einer solchen Schule vielleicht nicht so gut gehen oder es könnte alles zu teuer werden.
Bittet wieder alle zurück auf ihre Plätze und gebt einen kurzen Überblick darüber, was nun folgt. Überlegt euch auch diesmal im Team, wie ihr die zweite Runde einleiten könnt.
Hier ein Beispiel:
"Ich möchte nun alle Vertreterinnen und Vertreter ganz herzlich zu unserer zweiten Verhandlungsrunde willkommen heißen. Wir haben nun die große Aufgabe, das Recht auf Bildung zu verhandeln. Es geht zunächst darum, die wichtigsten Stichpunkt zu finden für die Diskussion um den Artikel. Zunächst können die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher ganz kurz ihre oder seine Vorstellungen vortragen, und danach möchten wir gemeinsam diskutieren. Ich kann mir vorstellen, dass wir an diesem Tisch nicht alle einer Meinung sein werden, möchte Sie jedoch höflich dazu auffordern und ermuntern, unnötige Diskussionen zu vermeiden. Es ist wichtig, dass wir uns in der vorgegebenen Zeit einigen, uns gegenseitig respektvoll behandeln und aussprechen lassen."
Während des gesamten Planspiels sind folgende Punkte für euch sehr wichtig:
- Ihr legt sehr viel Wert darauf, dass sich alle höflich und mit Respekt behandeln.
- Jede und jeder darf ausreden, ihr legt die Gesprächsreihenfolge fest.
- Euch ist besonders die Meinung der beiden Nichtregierungsorganisationen sehr wichtig, denn sie vertreten die Menschen mit Behinderungen - und um sie geht es ja schließlich!
Im Anschluss an das Planspiel findet für alle eine gemeinsame Auswertung statt. Sie wird vom Organisationsteam geleitet. Zu Beginn der Auswertung berichten die Beobachterinnen und Beobachter, was sie gesehen und gehört haben:
- Auf welche Punkte konntet ihr euch einigen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Wenn es keine Beobachterinnen und Beobachter gab, wird diese Zusammenfassung von allen Beteiligten gemeinsam erarbeitet.
Eure Rolle: Moderation Frau/Herr McKay aus Neuseeland und Team
Die Moderation führt durch das Planspiel und unterstützt die Auswertung. Ihr seid inhaltlich neutral und versucht, alle miteinander ins Gespräch zu bringen. Dabei achtet ihr darauf, dass alle fair miteinander sprechen. Insbesondere kümmert ihr euch um das Wohl der Menschen mit Behinderungen. Denn dieser Menschenrechtsvertrag soll für sie gelten und ihnen das Leben erleichtern.
- Um das Planspiel zu beginnen, bittet ihr alle gewählten Sprecherinnen und Sprecher pünktlich zu den Verhandlungen zu kommen. Die anderen spielen das Publikum.
- Begrüßt die Anwesenden und erläutert, worum es in den heutigen Verhandlungen geht.
- Erklärt den Gästen und dem Publikum die Diskussionsregeln.
- Stellt die Gäste nacheinander vor und lasst sie ihr kurzes Eingangsstatement halten.
- Bedankt euch für die Beiträge der Sprecherinnen und Sprecher.
- Ihr könnt Nachfragen stellen oder die Sprecherinnen und Sprecher bitten, genauer zu erklären, was sie meinen.
- Nach Aussagen, die eine ganz besondere Meinung darstellen, könnt ihr die Kommentare der anderen Sprecherinnen und Sprecher dazu einholen. Ihr könnt zum Beispiel nachfragen, ob diese zustimmen, widersprechen oder etwas ergänzen möchten.
- Wenn ihr es euch zutraut, versucht am Ende der Diskussion die Standpunkte zusammenzufassen. Ihr könnt den tatsächlichen Artikel 24 der Konvention zu Hilfe nehmen und anhand von diesem versuchen, eine Einigung über Formulierungen herzustellen.
- Beendet das Planspiel, indem ihr euch bei allen Teilnehmenden und dem Publikum bedankt.
Planspiel: Rollenkarte Afrikanische Union
Planspiel: Rollenkarte Afrikanische Union
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen."
Allgemeine Informationen über euch
Als Afrikanische Union seid ihr ein Zusammenschluss afrikanischer Staaten und damit eine internationale, zwischenstaatliche Organisation. Ihr wollt afrikanische Positionen und Interessensangelegenheiten des Kontinents, der einzelnen afrikanischen Länder und deren Bevölkerung repräsentieren. Es ist für euch sehr wichtig, den Frieden und die Sicherheit in Afrika sicherzustellen. Ihr fordert mehr Demokratie, verantwortungsbewusste Regierungsführung und den Schutz der Menschenrechte in allen afrikanischen Staaten. Ihr vertretet beispielsweise Senegal und Kenia in den Verhandlungen.
Euch ist bewusst, dass mit einer Behinderung zu leben etwas alltägliches ist. Denn immerhin leben der Weltgesundheitsorganisation zufolge mindestens 15% der Menschen weltweit mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten. Das sind etwa 650 Millionen Menschen. Ausserdem gibt es immer mehr alte und chronisch kranke Menschen, Menschen mit Mangel- oder Fehlernährung, Landminenverwundete durch Kriege, Menschen mit Gewalterfahrungen, mit HIV und AIDS. Es gibt Umweltschädigungen, schlechten Zugang zu Elektrizität, Wasser und zur Sanitärversorgung. Viele der Gründe hängen eng mit der Armut der Menschen zusammen oder werden durch Armut bedingt. Eure Forschungen haben ergeben, dass etwa 80% von den 650 Millionen Menschen in Ländern in Armut leben. Da viele Menschen in afrikanischen Staaten in Armut leben, geht ihr davon aus, dass auch viele Menschen mit Behinderungen in Afrika oder zum Beispiel der Karibik und Asien leben. Ihr findet es erschütternd, dass nur etwa 1 bis 5% dieser Menschen mit Behinderungen Zugang zu Bildung erhalten.
Euer Schwerpunkt bei den Verhandlungen: Die Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen
Als Afrikanische Union seid ihr überzeugt, dass es ein rechtsverbindliches Instrument für Menschen mit Behinderungen geben muss. Ihr bezieht eure Forderungen auf die besondere Notlage von Menschen mit Behinderungen auf dem afrikanischen Kontinent, die häufig unter extremer Armut leiden und im Besonderen auf die Situation von Frauen mit Behinderungen. Frauen mit Behinderungen sehen sich besonders schweren Lebensbedingungen gegenüber. Sie haben oftmals nur geringen Zugang zu Bildung, Arbeit und sozialen Diensten. Sie repräsentieren dadurch die wohl am meisten ausgegrenzte Gruppe. Besonders hebt die Afrikanische Union den Aspekt der sexuellen Identität für Frauen in den Vordergrund und ganz speziell für Frauen mit Behinderungen. Ihnen wird oftmals verboten zu heiraten oder Kinder zu haben, alleine aufgrund ihrer Behinderung.
Eure Forderungen an den Vertrag insgesamt:
Ihr wollt, dass die Belange von Frauen und Mädchen mit Behinderungen ausdrücklich bedacht und erwähnt werden. Besonders relevant erscheint euch für Frauen mit Behinderung eine angemessene Frauengesundheits- und Bildungspolitik.
Eure Argumente:
Einige Beispiele belegen den besonderen Bedarf:
- in der Geburtshilfe kennt sich kaum jemand mit einer natürlichen Geburt von querschnittsgelähmten Frauen aus,
- Arztpraxen sind häufig nicht barrierefrei,
- Frauen und Männer mit Behinderungen die ein Kind bekommen benötigen eine sogenannte Elternassistenz, wenn sie aufgrund der Behinderung nicht alleine für das Kind sorgen können. Das kann für rollstuhlfahrende Frauen die Assistenz bei der Pflege des Kindes in den ersten Lebensjahren sein oder bei blinden Müttern eine Assistenzkraft zum Vorlesen und zur Hausaufgabenbetreuung.
- Frauen mit Behinderungen sind insbesondere in Heimen von Pflegekräften häufig sexueller Gewalt ausgesetzt. Hiergegen müssen sie sich schützen können, beispielsweise indem es weniger Großeinrichtungen gibt, sie in Selbsthilfe und Selbstverteidigung geschult werden und ihre Pflegekräfte selbst aussuchen können.
- Alle benachteiligenden Faktoren, die auf Frauen ohne Behinderungen weltweit zutreffen, treffen auf die Frauen mit Behinderungen häufig in vielfacher Weise zu. Aus diesem Grund sind sie in besonderer Weise vor Armut, Ausbeutung und schlechter Versorgung zu schützen. Hierfür müssen bereits Mädchen mit Behinderungen von frühster Kindheit an besonders in ihrer Entwicklung gefördert werden.
Bislang gibt es keinen Rechtsanspruch für diese Form der Unterstützung und Schulung. Dies ist für euch nicht zu akzeptieren.
Tipp: Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde."
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Es muss besondere Regelungen für Mädchen und Frauen geben
Auch in der Bildung ist euch die besondere Berücksichtigung von Mädchen und Frauen sehr wichtig. Sie müssen besonders gefördert werden und auch besondere Bedeutung in der Bildungspolitik bis hinein in die Lehrpläne erhalten, um auch ihr Recht auf Bildung zu verwirklichen.
Eure Forderung:
Um das Recht von Frauen und Mädchen auf Bildung zu verwirklichen, ist es notwendig, dass sich Mädchen und Frauen selbst für ihre Assistenten und Assistentinnen, beispielsweise in der Schule, entscheiden können, um nicht der Gefahr sexueller Gewalt in der Pflege ausgesetzt zu sein. Auch die Lehrpläne und Methoden müssen berücksichtigen, dass Mädchen und Frauen mit Behinderungen genauso ein Recht haben auf sexuelle Aufklärung wie alle anderen Kinder und ihre Behinderung dabei respektvoll berücksichtigt werden muss. Sie haben das Recht auf Teilhabe an Klassenfahrten, an Pausentreffen und an Exkursionen, bei denen sicher gestellt sein muss, dass Übergriffe auf Mädchen und Frauen nicht möglich sind - sie aber gleichzeitig Teil der Gruppe sein können. Auch die Teilnahme am Sportunterricht muss in einer menschenwürdigen Weise sicher gestellt werden. Und dies auch für Mädchen und Frauen, die beispielsweise auf Pflege und Unterstützung beim Umziehen angewiesen sind.
Grundlegend muss ein barrierefreier Zugang zu allen Bildungsangeboten und eine freie Wahl von Bildungs- und Ausbildungsstätten von Kindergarten über Schule bis Hochschule sichergestellt sein.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt. Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
www.africa-union.org/root/au/index/index.htm
Planspiel: Rollenkarte Australische Regierungsdelegation
Planspiel: Rollenkarte Australische Regierungsdelegation
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen."
Allgemeine Informationen über euch
Ihr vertretet Australien bei den Verhandlungen in New York. Bei euch in Australien hat jeder Bundesstaat und jedes Gebiet sein eigenes Bildungssystem. In den Schulsystemen gibt es deswegen kleine Unterschiede. In jedem Bundesstaat gibt es öffentliche und private Schulen. Es gibt gesonderte Förderschulen und spezielle Bildungsprogramme innerhalb von Regelschulen für Kinder mit Behinderungen und für Kinder mit anderen besonderen Bedürfnissen oder Begabungen.
Euer Schwerpunkte und Forderungen bei den Verhandlungen: Keine Hindernisse mehr für Menschen mit Behinderungen
Als Vertreter der australischen Regierung fordert ihr eine Konvention, die den Rechten von Menschen mit Behinderungen umfassend gerecht wird. Für euch bedeutet dies, dass Menschen mit Behinderungen ein Recht auf Barrierefreiheit und Zugang zu ihrer Umwelt haben. Das bedeutet, dass es keine Hindernisse für Menschen mit Behinderungen geben soll.
Hierzu gehört der barrierefreie Zugang zu:
- Öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen und Straßen,
- Sozialwohnungen und sozialen Einrichtungen,
- öffentliche Dienstleistungen, insbesondere aus dem Gesundheits- und Bildungswesen,
- Beschäftigung, Arbeitsplätze und
- unterstützende Informations- und Kommunikationsdienste.
Wenn diese Maßnahmen für einzelne Menschen nicht ausreichen, muss ein Recht auf eine individuelle Vorkehrung, die den Bedürfnissen des- oder derjenigen angemessen ist, verankert werden.
Tipp: Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde."
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung:
Unter Bildung versteht ihr nicht nur ein Schulsystem, in dem Leistung abgerufen wird. Kinder mit und ohne Behinderungen sollen durch Bildung ihre sozialen Fähigkeiten erweitern, Freunde finden, sich in ihrer Gemeinde wohl fühlen und dadurch auch Spaß daran entwickeln, sich zu engagieren für ihre Gemeinde. Bildung soll in einer Schule in der direkten Umgebung stattfinden, also in der Gemeinde in der man lebt und in die auch die Kinder aus der Nachbarschaft gehen. Ihr findet nicht gut, dass Kinder lange Schulwege haben und in getrennte Schulen gehen, nur weil sie eine Behinderung haben. Das reißt soziale Umfelder auseinander und löst Gemeinschaften auf, die sich gegenseitig stützen sollten. Damit sich auch Menschen mit Behinderungen in ihren Gemeinden wohl fühlen, müssen mehr Menschen auch leichte Sprache, Braille und Gebärdensprache sprechen. Deshalb setzt ihr euch dafür ein, dass zumindest Braille und Gebärdensprache als offizielle Sprachen anerkannt werden und auch unterrichtet werden.
Ihr fordert außerdem eine rechtliche Absicherung von Orientierungs- und Mobilitätstrainings für Menschen mit Sehbehinderungen. Menschen die nicht gut sehen können oder die vollständig blind sind, muss ein Training zukommen, mit dem sie lernen, sich in ihrer Stadt oder Gemeinde zurechtfinden. Das beinhaltet ein Training zum Busfahren, Einkaufen und für alle anderen für sie wichtigen Aktivitäten. Ihr findet, dass Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung bisher nicht genügend beachtet werden. Alle sehenden und hörenden Menschen müssen sensibler mit ihnen umgehen und ihnen mehr Beachtung schenken. Deswegen müssen ihre Rechte ganz deutlich im Artikel 24 zur Geltung kommen.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt. Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Brasilianische Regierungsdelegation
Planspiel: Rollenkarte Brasilianische Regierungsdelegation
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Bei euch in Brasilien gibt es eine Schulpflicht für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren. Die Einhaltung zu überwachen ist jedoch sehr schwer, denn Brasilien ist ein großes Land mit vielen geografischen und sozialen Unterschieden.
1971 habt ihr in der Bildung eine Reform durchgeführt. Seitdem gibt es bei euch eine Schule für Alle. Diese Schule umfasst acht Schuljahre. Danach kann man noch mal für drei Jahre eine weiterführende Schule besuchen. Es gibt auch verschiedene Bildungsprogramme für Erwachsene. Diese sind oft kostenlos. Aber Kinder mit Behinderungen haben es bei euch teilweise schwer. Denn wenn sie in armen Gebieten leben, können sie oft keine Schule besuchen. Manchmal schämen sich auch die Eltern für ihre Kinder und schicken sie deshalb nicht in die Schule. Für euch steht fest: Das kann sich durch eine Behindertenrechtskonvention und durch Öffentlichkeitsarbeit für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ändern.
Euch ist bewusst, dass die Menschenrechte in Brasilien immer wieder gefährdet sind. Es gibt Schwierigkeiten in folgenden Bereichen: Immer wieder kommt es vor, dass Menschen gefoltert werden. Die Gefängnisse sind schlecht ausgestattet und Inhaftierte leben oft unter unmenschlichen Bedingungen. Indigenen Gemeinschaften, also der Bevölkerungsgruppe, die zuerst in Brasilien lebte, sowie landlosen Arbeiterinnen und Arbeitern und kleinen ländlichen Gemeinden werden nach wie vor Landrechte verweigert und sie werden bedroht. Ihr habt diese Schwierigkeiten im Blick, jedoch ändert sich die Situation nur langsam.
Eure Schwerpunkte und Forderungen bei den Verhandlungen: Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bedeutet, dass sie wie alle anderen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und auch als dazugehörig wahrgenommen werden. Das betrifft nicht nur das alltägliche Zusammenleben, sondern auch die Politik und die Wirtschaft. Zur Teilhabe gehört, dass sie mit allen anderen in eine Schule, zur Arbeit und zur Wahl gehen und zum Beispiel auch, dass sie ein eigenes Konto haben. So wie alle anderen. Für all das müssen Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft willkommen sein und es muss vieles geändert werden, damit sie ohne Barrieren überall mitmachen können. Barrieren sind Hindernisse, wie hohe Bordsteine oder eine Treppe ins Rathaus, aber auch Texte in schwieriger Sprache.
Eure Forderungen an den Vertrag insgesamt: Nichtdiskriminierung, Gleichheit aller Menschen und volle Teilhabe in der Gemeinschaft
Eurer Ansicht nach sollte die Konvention ihren Fokus auf drei wesentliche Inhalte legen:
- Nichtdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der Politik, der Wirtschaft, im sozialen und kulturellen Leben und in allen anderen Lebensbereichen.
- Gleichheit aller Menschen und volle Achtung der Menschenrechte. Es sollten Aktionen durchgeführt werden, um die Menschenrechte bekannter zu machen, vor allem bei Menschen mit Behinderungen, damit ihre Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gefördert werden.
- Menschen mit Behinderungen soll die volle Teilhabe in der Gemeinschaft ermöglicht werden, in allen Lebensbereichen, wie Arbeit, Medien, Wohnen, Erholung, Bildung, Sport und auch bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
Ein paar Beispiele:
- Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sollen ohne fremde Hilfe an Veranstaltungen teilnehmen können. Dazu darf der Veranstaltungsort nicht ausschließlich Treppen und keine engen Türen haben.
- Blinde Menschen können ohne fremde Hilfe Informationen erhalten. Die Informationen stehen dazu auch in Brailleschrift oder als Tonaufnahme zur Verfügung.
- Texte sind auch in Leichter Sprache verfasst, so können alle sie lesen, zum Beispiel auch Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (2)
Eure Forderung zum Recht auf Bildung: Bildung muss bewirken, dass sich Einstellungen ändern
Euch geht es darum, dass sich die Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen ändern. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Menschen mit Behinderungen hilflos sind und nicht selbst entscheiden können. Aufgrund einer solchen Haltung haben jahrhundertelang andere Menschen für Menschen mit Behinderungen entschieden und bestimmt, was gut für sie ist und was nicht. Das muss sich ändern. Ihr fordert das Ende von Fürsorge und Bevormundung und die Förderung von Selbstbestimmung und Teilhabe. Dafür muss es eine Schule für Alle geben. Die Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen werden sich nur ändern, wenn alle zusammen lernen, in gegenseitigem Respekt füreinander aufwachsen und Behinderung auch ein Thema in den Lehrplänen wird. Die Kinder mit Behinderungen sollen in jedem Fall mit den Nachbarskindern und Geschwistern in eine Schule gehen können. Das stärkt die Gemeinschaft und macht auch für ihre Familien vieles leichter. Eine solche Bildung kann zu einem besseren Verständnis der Rechte von Menschen mit Behinderungen führen. Doch dafür bedarf es entscheidender Änderungen in der Bildung und den Schulen.
Ihr könnt verstehen, wenn andere Verhandlungspartnerinnen und -partner Schulsysteme mit verschiedenen Schulformen fordern. Euch ist es aber wichtig, dabei die Risiken nicht aus den Augen zu verlieren. Unterschiedliche Schulsysteme nebeneinander zu unterhalten kann dazu führen, dass nicht alle Schulen gleich gut ausgestattet sind. Wenn es in der Konsequenz nur eine Schule gibt, die barrierefrei ist, dann ist keine Schulwahlmöglichkeit für Kinder und Eltern vorhanden. Ihr denkt, dass im Resultat das Sonderschulsystem mit seinen Folgen bestehen bleibt.
Ihr seid euch mit der Afrikanischen Union einig, dass die Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen in der Konvention besonders berücksichtigt werden müssen. Denn sie sind besonders betroffen von Ausgrenzung und Gewalt.
Tipp:
Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt. Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Chinesische Regierungsdelegation
Planspiel: Rollenkarte Chinesische Regierungsdelegation
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Als chinesische Delegation vertretet ihr euer Land und eure Regierung bei den Verhandlungen in New York. Für euch ist wichtig klarzustellen, dass die chinesische Regierung der Erziehung auch von behinderten Menschen immer viel Beachtung geschenkt hat. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit mehrere Gesetze und Verordnungen erlassen, in denen der Schutz des Rechts von Menschen mit Behinderungen auf Bildung verankert worden ist. Bei euch gibt es Sonderschulen und landesweite Berufsbildungsstellen für Menschen mit Behinderungen. Außerdem Rehabilitations- und Trainingszentren.
Euch ist bewusst, dass ihr aufgrund der menschenrechtlichen Situation in eurem Land besonders kritisch betrachtet werdet. Trotz Eurer immer wichtiger werdenden Rolle auf der Weltbühne werdet ihr ständig kritisiert. Es in der Kritik an euch häufig um soziale Unruhen im Land und den Umgang der chinesischen Regierung mit diesen, um Korruption, unzureichende Gesundheitsversorgung und Unterdrückung von einzelnen Gruppen. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist angeblich sehr groß bei euch.
Ihr wisst, dass es auch Kritik an eurem Umgang mit den Menschenrechten gibt. Gesprochen wird von der Beschneidung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der Versammlungsfreiheit und der Religionsfreiheit. Die Inhaftierung und strafrechtliche Verfolgung von Menschen, die sich für diese Rechte einsetzten, die Kontrolle der Medien, des Internets und die ungeklärte Menschenrechtslage in Tibet sind leider immer wieder Themen bei Treffen wie diesem hier bei den Vereinten Nationen.
Ihr versteht nicht, warum sich andere Saaten in eure Angelegenheiten einmischen und findet, dass es beispielsweise wichtiger wäre, auf die Situation der Menschen in den so genannten Entwicklungsländern des Südens hinzuweisen, in denen eurer Meinung nach alles drunter und drüber geht.
Euer Schwerpunkt bei den Verhandlungen: Zusammenhänge zwischen Behinderung und Armut
Die Zusammenhänge zwischen Armut und Behinderung sind Eurer Meinung nach komplex. Es fehlen Menschen mit Behinderungen zum einen häufig der Zugang zu angemessener Schulbildung und Möglichkeiten der Erwerbsfähigkeit. Die soziale Absicherung von Menschen mit Behinderungen ist schlechter als bei dem Durchschnitt der Bevölkerung. Sie haben weniger Zugang zu finanziellen Ressourcen und zur Gesundheitsfürsorge. Häufig fehlt ihnen aufgrund fehlender Zugänge zu diesen auch ein stabiles soziales Umfeld, ein weiteres Armutsrisiko. Menschen mit Behinderungen und Menschen in Armutsverhältnissen haben häufiger chronische Erkrankungen, Mangel- oder Fehlernährung, Gewalterfahrungen, schlechteren Zugang zu Elektrizität und Wasser. Viele dieser Faktoren bedingen sich gegenseitig: Sie sind von Armut ausgelöst oder werden durch Armut bedingt.
Menschen mit Behinderung haben oft nicht die Möglichkeiten und finanziellen Mittel, um sich eine angemessene medizinische Versorgung zu organisieren. Eure Forschungen haben ergeben, dass etwa 80% von den 650 Millionen Menschen mit Behinderungen in Ländern mit hohen Armutsanteilen leben und daher selbst von Armut betroffen sind. Sie haben weniger Möglichkeiten als Menschen, die nicht in Armut leben, diese Situation zu verändern. Ihr findet es erschütternd, dass im Resultat nur etwa 1 bis 5% dieser Menschen mit Behinderungen Zugang zu Bildung erhalten.
Eure Forderungen an den Vertrag insgesamt: Förderung der Armutsbekämpfung
Euch ist besonders wichtig, dass jede Form der Armut von Menschen mit Behinderungen, vor allem in ländlichen Gebieten, reduziert wird. Die Interessen und Bedürfnisse der Menschen in den Entwicklungsländern des Südens zu vertreten, findet ihr deshalb sehr wichtig. Hier seht ihr die Armut am weitesten verbreitet. In China hingegen wird bereits sehr viel für die Armutsbekämpfung getan.
Forderungen: Eurer Meinung nach sollten alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um Menschen mit Behinderungen in der Arbeitsplatzsuche, der selbständigen Erwerbstätigkeit und auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen. Hierfür ist für euch ein Ausbau sozialer Hilfssysteme von besonderer Bedeutung. Hierzu gehören Beratungsstellen und angemessene und stabile Arbeitseinkommen. Diese seht ihr vor allem in den so genannten Entwicklungsländern noch nicht verwirklicht.
Tipp: Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (2)
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Es muss Schulen geben für alle Kinder, aber nicht zwingend eine Schule für alle
Hintergrund: Das Recht auf Bildung findet ihr wichtig, seht ihr aber in eurem Land weitgehend für die meisten Menschen verwirklicht. Ihr findet es richtig, dass keinem Menschen aufgrund seiner Behinderung der Zugang zu Bildung verwehrt werden darf. Dafür habt ihr ein gut organisiertes Schulsystem mit besonderen Schulen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, bei dem ihr wenige Mängel feststellen könnt und das deshalb beibehalten werden soll.
Forderungen: Alle Schulsysteme stellen für euch einen Weg dar, den Zugang zu Bildung zu gewährleisten. Ihr wisst, dass die anderen Verhandlungspartner eine gemeinsame Schule für alle Schülerinnen und Schüler als einzige Möglichkeit, das Recht auf Bildung zu verwirklichen ansehen. Ihr könnt diese Haltung jedoch nicht nachvollziehen und fordert, sich nicht auf ein Schulsystem einigen zu müssen. Dort, wo noch Probleme bei der Verwirklichung des Rechts auf Bildung bestehen – vor allem in anderen Ländern - ist es für euch wichtig zu betonen, dass man schrittweise und langsam vorgehen muss. Auch die Vereinbarungen der Menschenrechtsverträge können und sollen nicht von heute auf morgen umgesetzt werden müssen.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt. Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Europäische Union
Planspiel: Rollenkarte Regierungsvertreter und Regierungsvertreterinnen der Europäischen Union
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Der Kontinent Europa umfasst mehr als 40 Länder, in der Europäischen Union sind derzeit 27 Staaten Mitglied. Im 20. Jahrhundert gab es zwei Weltkriege, die unter anderem Europa, aber auch Asien, große Zerstörung gebracht haben. Um weitere Kriege zwischen benachbarten Staaten zu vermeiden und mehr wirtschaftliche, soziale und politische Stabilität in den Ländern und zwischen ihnen zu erreichen, entwickelte sich über Jahrzehnte die Europäische Union (EU). Das Besondere an der EU ist, dass die Mitgliedsländer unabhängige Staaten bleiben, jedoch einen Teil ihrer Befugnisse an die EU abgeben. Entscheidungen zu speziellen Fragen, die für alle Mitgliedsstaaten von Bedeutung sind, werden gemeinsam getroffen. Dazu sind viele Treffen und Diskussionen nötig. So auch bei den Verhandlungen zur Behindertenrechtskonvention. Ihr seid Vertreterinnen und Vertreter verschiedener europäischer Länder und habt je nach Land eine bestimmte Meinung, müsst euch aber im Namen der Europäischen Union auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen. Diesen müsst ihr nach außen geschlossen vertreten. Ihr kommt beispielsweise aus Deutschland, Italien, Großbritannien, Finnland, Portugal, Frankreich und den Niederlanden. (2)
Eure Schwerpunkte und Forderungen bei den Verhandlungen: Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
Menschen mit Behinderungen sind eurem Verständnis nach gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, sie haben die gleichen Rechte wie alle anderen. Sie haben ein Recht auf Würde, auf Gleichbehandlung, unabhängige Lebensführung und uneingeschränkte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Euer Hauptanliegen ist es, Menschen mit Behinderungen zu ihren Rechten zu verhelfen. Ihr möchtet erreichen, dass Menschen mit Behinderungen selbst über ihr Leben bestimmen. Sie sollen alles Nötige bekommen, um ihren Alltag selbst meistern zu können – genauso wie Menschen ohne Behinderungen. (3)
Euch ist es ganz wichtig, die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Chancengleichheit bedeutet für euch, dass alle Menschen gleiche Rahmenbedingungen haben; Das bedeutet, über alles zum Leben notwendige verfügen zu können, zum Beispiel Zugang zum Gesundheitssystem, zu Arbeit und Bildung zu haben. Wenn das nicht gegeben ist, spricht man von Diskriminierung. Menschen werden zum Beispiel aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres Alters, ihrer Religion oder einer Behinderung diskriminiert.
Eure Forderungen an den Vertrag insgesamt: Die Umsetzung von Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen
Fehlende Chancengleichheit ist eine Verletzung der Menschenrechte, das steht für euch fest. Denn die Menschenrechte fordern Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Menschen mit Behinderungen sollen ein sicheres, freies und unabhängiges Leben in der Gesellschaft führen können. Ihr seid euch zudem sicher, dass fehlende Chancengleichheit als ungerecht empfunden wird, zu Protesten führen kann und damit den sozialen Frieden gefährdet.
Um Chancengleichheit zu erreichen, muss Folgendes passieren:
- Öffentlichkeitsarbeit, die über die Rechte von Menschen mit Behinderungen informiert. Zum Beispiel mehr Menschen mit Behinderungen in der Werbung, im Radio, in Filmen; dabei sollten ihre Stärken dargestellt werden.
- Menschen mit Behinderungen sollen alle Hilfsmittel bekommen, die sie für ein Leben in der Gemeinschaft benötigen. Dazu gehören technische Hilfsmittel, zum Beispiel spezielle Sehlupen, Hörgeräte, Rollstühle, Autos, Fahrräder, aber auch persönliche Assistenzen, die mit ins Kino oder mit zum Einkaufen gehen oder bei der Pflege unterstützen.
Tipp:
Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (4)
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Bildung muss menschlicher Vielfalt gerecht werden
Ihr seid euch in der Europäischen Union nicht ganz einig, wie das Recht auf Bildung gestaltet werden soll. Ihr habt ganz unterschiedliche Auffassungen darüber, müsst nach außen aber als Einheit auftreten. Das heißt, ihr führt in eurer Gruppe heftige Diskussionen, vor allem bei der Frage "Eine Schule für Alle oder getrennte Schulen?". Getrennte Schulen beizubehalten würde bedeuten, dass es eine Schule für Kinder ohne Behinderungen und spezielle Schulen für Kinder mit Behinderungen gibt. Ihr seid gespalten: England und die Niederlande sind eher konservativ und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, also getrennte Schulen. Deutschland ist neutral und hat keine endgültige Meinung, und Finnland ist für die Inklusion, also eine Schule für Alle. Nach langen Diskussionen könnt ihr euch jedoch auf die folgenden Punkte zum Recht auf Bildung einigen:
Gemeinsam setzt ihr euch für eine Bildung ein, die der menschlichen Vielfalt und der Würde des Menschen gerecht wird. Das bedeutet, dass diese Bildung die Chancengleichheit im Blick hat, damit alle gleichberechtigt an der Bildung, aber auch am sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen können. Chancengleichheit bedeutet sowohl, dass alle Menschen an der Bildung teilhaben können, als auch, dass die Vermittler und Vermittlerinnen der Bildung alle Kinder in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit annehmen, egal, ob jemand eine Behinderung hat, groß oder klein ist, eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion. Auch wenn jemand eine andere Sprache spricht, muss auf ihn oder sie in der Schule geachtet werden. Auch diese Kinder müssen Unterstützung bekommen, genauso wie ein Kind mit Behinderungen. Hierfür fordert ihr individuelle Bildungspläne und genügend gut ausgebildete Fachkräfte. Denn anders kann es nicht gelingen, dass Bildung allen gerecht wird.
Bleibt in den Verhandlungen offen und gespannt auf die Beiträge der anderen, denn eure Position bleibt durch die verschiedenen Haltungen eurer Mitglieder etwas vage und unklar.
Tipp:
Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt. Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: http://www.infopoint-europa.de/halloeuropa/Erweiterungen.htm
3: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429&langId=de
4: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Internationales Bündnis von Menschen mit Behinderungen
Planspiel: Rollenkarte Internationales Bündnis von Menschen mit Behinderungen (International Disability Alliance, IDA)
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Ihr seid Mitglieder der IDA. Ihr habt euch 1999 gegründet und seid ein Netzwerk aus globalen und regionalen Organisationen, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Euer Ziel ist es, 650 Millionen Menschen mit Behinderungen weltweit zu repräsentieren. Eurer Meinung nach werden die Rechte von euren Mitgliedern nicht genügend berücksichtigt und manchmal ganz vergessen. Ihr trefft euch mit möglichst vielen eurer Mitglieder zweimal jährlich in Genf oder New York zu einem Austausch.
Eure Mitgliedsorganisationen sind beispielsweise:
Down Syndrome International (DSI) - eine internationale Organisation zur Förderung der Rechte von Menschen mit Down-Syndrom.
Inclusion International (II) - eine Organisation von und für Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihren Familien.
International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) - eine weltweite Organisation für die Anerkennung der Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Hörbehinderungen.
The World Blind Union (WBU) – ein Zusammenschluss von schätzungsweise 160 Millionen blinden Menschen oder Menschen mit Sehbehinderungen.
The World Federation of Deafblind (WFDB) – ein Zusammenschluss von Organisationen und Verbänden für die Rechte von hör/sehbehinderten Menschen.
World Network of Users and Survivors of Psychiaty (WNUSP) - eine Organisation von psychiatrieerfahrenen und psychiatrieüberlebenden Menschen.
Arab Organization of Disabled People (AODP) – eine Organisation zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen aus arabischen Ländern der Welt.
European Disability Forum (EDF) - eine unabhängige europäische Nichtregierungsorganisation. Gemeinsam setzt ihr euch für die Rechte von über 50 Millionen Menschen mit Behinderungen in der europäischen Union ein.
The Latin American Network of Non-Governmental Organizations of Persons with Disabilities and their Families (RIADIS) - ein Netzwerk, das sich aus verschiedenen Behindertenorganisationen in Lateinamerika und der Karibik zusammensetzt.
Euer Schwerpunkt bei den Verhandlungen: Es bedarf keiner neuen Ideen, die bereits bestehenden Menschenrechte müssen angepasst werden
Menschen mit Behinderungen brauchen keine Sonderrechte. Das darf eurer Meinung nach auf keinen Fall vergessen werden. Sie sollten sich unbedingt an den bereits bestehenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten aus dem Sozialpakt orientieren. Der Sozialpakt setzt sich beispielsweise für gleiche Rechte unabhängig der Hautfarbe, Religion, Sprache, dem Geschlecht oder der Herkunft ein. Es ist sehr schade, dass Menschen mit Behinderungen nicht im Sozialpakt erwähnt worden sind. Deswegen ist diese Konvention für euch umso wichtiger.
Eure Forderungen an den Vertrag insgesamt: Gleichheit und Nichtdiskriminierung
Ihr wollt eine umfassende Berücksichtigung von Gleichheit und Nichtsdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen erreichen mit dem Vertrag. Jeder soll gleichberechtigter Teil der Gesellschaft sein. Menschen mit Behinderungen dürfen nicht mehr an den Rand gedrängt werden.
Tipp: Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (2)
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Ausbau von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprache, ausreichende Hilfsmittel in Schulen
Hintergrund: Ihr seid überzeugt, dass weltweit die Mehrzahl der Menschen mit Behinderungen keine oder ungenügende Bildung erhalten. Das Recht auf Bildung wahrzunehmen wird ihnen einfach von ihren Familien, den Schulen oder dem Land, in dem sie leben, nicht ermöglicht. Eure Erfahrungen haben euch gezeigt, dass Kinder mit Behinderungen, die trotzdem in eine Schule gehen, dort oft schlecht unterrichtet werden oder in getrennte Schulklassen oder sogar Schulen gehen müssen. Viele Kinder, die gehörlos, blind oder hör/sehbehindert sind, werden zum Beispiel oft nicht in ihrer Sprache, also der Gebärdensprache oder in Braille unterrichtet. Kinder mit Lernschwierigkeiten, die geistig behindert genannt werden, brauchen Leichte Sprache, um zu verstehen, was gesprochen wird.
Argumente: Eurer Meinung nach sollte es genau umgekehrt sein: Braille, Leichte Sprache und Gebärdensprache sollten in allen Schulen als reguläre Fremdsprache angeboten werden, genauso wie Latein, Türkisch, Englisch, Französisch. Kindern, die in Gebärdensprache oder mit Brailleschrift aufwachsen wird eurer Meinung nach andernfalls das Recht auf angemessene Kommunikation und Sprache und damit auch auf ihre kulturelle Identität verwehrt.
Forderungen: Um diese Rechte zu verwirklichen, müssen Schulen besser ausgestattet werden mit notwendigen Hilfsmitteln wie zum Beispiel elektronischen Sprachhilfen, Talker genannt für Kinder, die nicht selbständig sprechen können, Büchern in Brailleschrift, Lichtfunktionen für Kinder die nicht hören können, beispielsweise eine blickende Lampe für das Pausenzeichen und Pflegebäder und behindertengerechte Toiletten. Lehrerinnen und Lehrer sollen Gebärdensprache, Brailleschrift und Leichte Sprache beherrschen. Ihr wollt, dass alle Schulen angemessen ausgestattet und alle Lehrerinnen und Lehrer gut ausgebildet sind. Ihr fordert deswegen eine Schule für Alle.
Für euch ist wichtig zu betonen, dass davon alle Kinder profitieren. Eurer Meinung nach, stellt leichte Sprache, Braille und Gebärdensprache eine Bereicherung für alle Menschen dar und nicht nur für hör- oder sehbehinderte Menschen oder für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das sieht man auch daran, dass alles, was in leichter Sprache veröffentlicht wird von allen Menschen gerne gelesen und besser verstanden wird als Veröffentlichungen in schwerer Sprache und Fachsprache.
Für euch ist eine inklusive Bildung, in der alle miteinander lernen und die Hilfe bekommen die sie brauchen, eine bessere Bildung für Alle.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt. Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Inclusion International
Planspiel: Rollenkarte Inclusion International
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Ihr vertretet Inclusion International, einen weltweiten Zusammenschluss von Organisationen. Ihr setzt euch weltweit für die Menschenrechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten ein. Früher sagte man "Menschen mit geistiger Behinderung", das findet ihr aber nicht gut. Ihr findet diese Bezeichnung abwertend. Inclusion International macht seit über 40 Jahren Menschenrechtsarbeit und hat etwa 200 Mitgliedsverbände in 115 Ländern. Euer Vorsitzender ist Robert Martin aus Neuseeland. Er hat selbst eine Lernbehinderung und aus diesem Grund verschiedene Berater und Assistenzen. Robert Martin hat sich schon immer dafür eingesetzt, dass Kinder mit Lernbehinderungen das Recht haben, die Regelschule zu besuchen. Seiner Meinung nach müssen in den Schulen aber qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung stehen und das Umfeld der Schule muss sich auf die Kinder einstellen (Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Nachbarschaft, Mitschülerinnen und Mitschüler).
Eure Schwerpunkte und Forderungen bei den Verhandlungen: Menschen mit Behinderungen leisten einen wertvollen Beitrag
Eure Vision ist eine Welt, in der Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie Menschen mit anderen Behinderungen und ihre Familien die gleichen Chancen haben wie alle anderen und Wertschätzung und volle gesellschaftliche Teilhabe erleben. Sie sollen Teil des gesellschaftlichen Lebens in allen Aspekten sein, jeden Tag. Dabei ist es besonders wichtig anzuerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in die sie betreffenden Entscheidungen immer eingebunden werden müssen und nicht über sie bestimmt werden darf. Ihre Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit muss gestärkt werden.
Eure Forderungen an den Vertrag insgesamt: Der Beitrag von Menschen mit Behinderungen muss Wertschätzung erfahren
Für euch steht fest, dass Menschen mit Behinderungen einen wertvollen Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt in der Gemeinschaft leisten. Dies können sie jedoch nur tun, wenn sie ernst genommen werden und selbstbestimmt sie betreffende Entscheidungen treffen dürfen. Alle Menschen machen das Leben der Gemeinschaft bunter bereichern sie. Ihr möchtet, dass das in der Konvention festgehalten wird. Alle Menschen, auch als Künstler und Künstlerinnen oder Sportlerinnen und Sportler bei den Paralympics, leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Sie vertreten ihre Länder und Sportarten bei den Olympischen Spielen für Menschen mit Behinderungen. Dies können sie erreichen, da ihr Beitrag willkommen ist und auch gefördert und wertgeschätzt wird. Leider werden die Paralympics von der Öffentlichkeit noch relativ wenig wahrgenommen und im Fernsehen bisher kaum übertragen. Viele Sender zeigen nur einzelne Ergebnisse oder Ausschnitte der Spiele. Ihr hofft, dass das Interesse an den Leistungen von Menschen mit Behinderungen in Zukunft zunehmen wird. Ihr würdet euch freuen, wenn es auch einmal Spiele für Alle Menschen gemeinsam gibt.
Tipp:
Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (2)
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Bildung muss die Kreativität und Begabung fördern
Als Vertreterinnen und Vertreter von Inclusion International drängt ihr darauf, dass der neue Menschenrechtsvertrag, die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten und allen anderen Kindern ein Recht auf kostenlosen Schulunterricht zusichert. Wenn dies in der Konvention stehen würde, wäre es verbindliches Recht und muss für alle Kinder in allen Ländern, die den Vertrag unterzeichnen, umgesetzt werden.
Ihr findet es nicht gut, dass es auch heute noch in vielen Schulen Tests gibt, die festlegen, ob man gut genug ist für diese Schule oder nicht. Ihr fordert eine Schule für Alle, in die jede und jeder gehen darf, ohne einen Test bestehen zu müssen. Eurer Meinung nach wäre es mit einer Schule für Alle viel einfacher zu erreichen, dass alle Kinder eine Schulbildung erhalten. Denn dann würden alle Kinder gleichberechtigt in eine Schule gehen, ohne Unterscheidung nach Intelligenz, Armut oder Reichtum, guten oder schlechten Sprachkenntnissen. Auch an dieser Stelle ist es euch wieder sehr wichtig zu betonen, dass Menschen mit Behinderungen einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten und ihr euch wünscht, dass dieser gesehen und anerkannt wird. Dafür ist es wichtig, dass in den Bildungseinrichtungen die Begabungen und die Kreativität aller Kinder gefördert werden. Damit sie all ihre Fähigkeiten entfalten können und ihre Persönlichkeit gestärkt wird. Um dies zu erreichen, werden gut ausgestattete Schulen, durchdachte Lehrpläne, gut ausgebildete Lehrkräfte, viel Assistenz und besondere Hilfsmittel benötigt. Ihr findet, alle Kinder sollen gleich behandelt und individuell unterstützt werden. Dabei denkt ihr auch an Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder nicht so gut sehen und hören können. Ihr seid euch sicher, dass mit entsprechend ausgestatteten Schulen alle gemeinsam unterrichtet werden können und kein Kind zurückbleibt oder ausgegrenzt wird.
Es darf nur eine Schule für Alle geben, sonst kann nie erreicht werden, dass alle gleich behandelt werden und der Beitrag von Menschen mit Behinderungen, egal welcher Art, geschätzt wird.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt.
Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Japanische Regierungsdelegation
Planspiel: Rollenkarte Japanische Regierungsdelegation
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Als Japaner und Japanerinnen seid ihr besonders stolz auf euer leistungsorientiertes Schulsystem. Eure Schülerinnen und Schüler gehören zu den besten und gebildetsten Schulabgänger und Schulabgängerinnen der Welt. Ihr legt sehr viel Wert auf Disziplin. Als japanische Regierung bietet ihr kostenlose, öffentliche Bildung für alle Kinder in Grund- und Mittelschulen an. Die Verwirklichung des Rechts auf Bildung ist euch sehr wichtig.
Die Kosten für einen einzigen Schüler und jede Schülerin mit Behinderung in einem Förderzentrum sind bei euch zehnmal so hoch wie die Kosten eines einzigen Schülers in einer Regelschule. Seit 1993 laufen bei euch Bemühungen, Kinder mit leichten Behinderungen in Regelschulen zu integrieren. Jedoch haben nicht alle Kinder, die sich eine solche Bildung wünschen, auch Zugang zu dieser. Schulbehörden haben ein Komitee, dass Eltern im besten Interesse des Kindes berät, welche Schule ihr Kind besuchen sollte. Das Komitee trifft jedoch die letzte Entscheidung. Regelschulen haben keine Verpflichtung, alle Kinder mit Behinderungen aufzunehmen.
Euer Schwerpunkt bei den Verhandlungen: Die Konvention muss die Freiheit und Sicherheit von Menschen mit Behinderungen sicherstellen
Ihr vertretet die unwiderrufliche Meinung, dass die Konvention alle Vertragsparteien dazu verpflichten muss, die Freiheit und die Sicherheit von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen. Jede grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung von Menschen mit Behinderungen muss verboten werden. Ihr seid der Meinung, dass sich die Konvention unbedingt an den bereits bestehenden Menschenrechten orientieren muss und damit auch an den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten aus dem Sozialpakt. Menschen mit Behinderungen sollen auch unabhängig leben können.
Eure Forderungen an den Vertrag insgesamt: Stärkung der Freiheitsrechte
Jeder Staat, der die Konvention unterschreibt und damit Vertragsstaat wird, muss in aller erster Linie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit von Menschen mit Behinderungen fördern und unterstützen. Ihr setzt euch für die Einbeziehung (Partizipation) von Menschen mit Behinderungen ein.
Tipp: Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (2)
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Bildung muss kostenlos sein
Ihr setzt euch dafür ein das Kinder mit Behinderungen ein Recht auf staatliche und kostenlose Bildung erhalten, unabhängig von der Art oder schwere ihrer Behinderungen. Für euch ist klar, dass im Einklang mit dem besten Interesse des Kindes eine Wahl zwischen den Schulsystemen bestehen muss. Staaten sollen verschiedene Schulsysteme bereithalten.
Ihr wollt nicht, dass die Staaten verpflichtet werden, nur ein Schulsystem für alle Kinder anzubieten. Inklusive und wohnortnahe Bildung ist ein Wunschziel, muss aber Eurer Meinung nach nicht immer ermöglicht werden.
Tipp für mehr Spannung in der Diskussion:
Ihr versteht überhaupt nicht, was China so alles zu sagen hat. Denn immerhin werden in China die Menschenrechte überhaupt nicht geachtet. Dort gibt es quasi keine Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Wenn ihr in der Argumentation nicht weiterkommt, könnt ihr die Aufmerksamkeit auf China lenken.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt.
Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Kanadische Regierungsdelegation
Planspiel: Rollenkarte Kanadische Regierungsdelegation
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Durch eure Gruppe wird die Position Kanadas während der Verhandlungen vertreten. Euer Land hat 33,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Hauptstadt ist Ottawa-Carleton. Als Kanadierinnen und Kanadier seid ihr stolz auf eure kulturelle Vielfalt und legt viel Wert darauf, ein Einwanderungsland zu sein. Euer Ziel ist es, zu einer modernen, multikulturellen, aufgeschlossenen, kreativen und innovativen Nation zu werden. Minderheiten müssen sich bei euch nicht der Mehrheit anpassen.
Bei euch wurden seit Beginn der 1980er Jahre in einigen Provinzen die Sonderschulen erfolgreich abgeschafft. Entscheidend auf diesem Weg war, dass die Regelschullehrerinnen und -lehrer viel Unterstützung von Sonderpädagoginnen und -pädagogen bekamen. Die Abschaffung der Sonderschulen wurde Schritt für Schritt, mit viel Kommunikation und guter Unterstützung erreicht.
Eure Schwerpunkte und Forderungen bei den Verhandlungen: Die Anerkennung der Würde von Menschen mit Behinderungen
Eurer Meinung nach sind Staaten dazu verpflichtet, Gleichheit und Nichtdiskriminierung aller Menschen in ihrer nationalen Gesetzgebung und Politik festzuschreiben. Ein zentrales Element, um Gleichheit und Nichtdiskriminierung zu erreichen, ist der Schutz der Würde aller Menschen. Die Würde ist unantastbar und muss in der Gesetzgebung und im täglichen Leben geachtet werden. Aus diesem Grund muss in der Konvention auch deutlich die Würde von Menschen mit Behinderungen betont werden. Denn jedes Land, das die Konvention unterschreibt, muss sich an das halten, was darin steht und die Gesetzgebung danach ausrichten.
Menschen mit Behinderungen sollen nicht von anderen Menschen gesagt bekommen, was gut für sie ist. Sie sollen, wie alle anderen Menschen auch, Unterstützung dafür bekommen, selbst entscheiden zu können, was gut für sie ist. Denn sie können eigene Entscheidungen treffen und haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Dies wurde lange Zeit nicht beachtet und so werden die Rechte von Menschen mit Behinderungen seit Jahrhunderten weltweit und in vielfältiger Weise verletzt. Menschen mit Behinderungen wurden und werden wegen ihrer Behinderung bevormundet, misshandelt oder sogar getötet. Dies muss sich eurer Meinung nach ändern. Denn für euch steht fest: Jeder Mensch, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht, Alter, Behinderung etc. besitzt Menschenwürde. Und diese muss geschützt werden. Sie kann nur geschützt werden, wenn es keine Diskriminierung mehr gibt und der Wert und die Freiheit jedes Menschen anerkannt wird.
Forderungen an den Vertrag insgesamt: Die Würde von Menschen mit Behinderungen muss geschützt werden
Die Würde jedes Menschen ist zu achten, also auch die Würde von Menschen mit Behinderungen. Dies hat für euch oberste Priorität und ist die zentrale Forderung. Eurer Ansicht nach haben die Staaten und hat jeder einzelne Mensch die Pflicht, die Menschenwürde nicht nur zu achten, sondern auch zu schützen. Der Schutz der Menschenwürde ist für euch die Grundlage aller weiteren Menschenrechte. Die menschliche Würde wird zum Beispiel durch Folter, Unterdrückung, erniedrigende Behandlung und durch Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht oder Behinderung verletzt. Zum Beispiel, wenn ein Mensch mit Behinderung eingesperrt oder geschlagen wird oder nicht genug zu essen bekommt, wird seine oder ihre Würde verletzt. Aber auch, wenn er oder sie gehänselt und verspottet oder bevormundet wird.
Euer Anliegen ist es, die Würde von Menschen mit Behinderungen vor allem durch Bildung und gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu schützen. Denn die Menschen über ihre Rechte und Menschenwürde, über Freiheit, Toleranz, Selbstbestimmung, Nichtdiskriminierung und Schutz vor Gewalt zu informieren, ist eine entscheidende Grundlage für das gute Zusammenleben in der Gesellschaft.
Tipp: Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (2)
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Bildung muss der Würde von Kindern gerecht werden
Das Schulsystem muss in jedem Fall die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes berücksichtigen und damit der Würde der Kinder gerecht werden. Die Lernbedingungen müssen so weit optimiert werden, dass alle Kinder in einer Schule angemessen unterrichtet werden können. Lehrer und Lehrerinnen müssen den Willen und die Möglichkeiten haben, auf die Kinder individuell und angemessen reagieren können. Der Unterricht und die ganze Schule müssen so gestaltet sein, dass sich die Kinder wohlfühlen und bei allem was sie brauchen unterstützt werden.
Für euch steht fest, dass viele Kinder und Jugendliche ganz genau wissen, was gerecht und ungerecht ist. Ihr seht die Aufgabe der Schule und der Jugendhilfeeinrichtungen darin, Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen herauszufinden, was gerecht ist und was nicht. Dazu müssen sie über ihre Rechte informiert werden und erfahren, wie sie ihre Rechte, aber auch die Rechte von anderen schützen können.
Ihr unterstützt und fordert eine Schule für Alle, da sie der Würde aller Kinder am besten gerecht werden kann. Für euch ist aber auch klar, dass man individuell auf jedes Kind eingehen muss, um dessen Würde zu schützen. Ihr weist ausdrücklich darauf hin, dass man dafür viel Fingerspitzengefühl braucht. Für den Schutz der Würde jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin ist es sehr wichtig, dass alle zusammenarbeiten und keiner zurückbleibt.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt.
Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Norwegische Regierungsdelegation
Planspiel: Rollenkarte Norwegische Regierungsdelegation
Phase 1
Julia Bertmann, 28.
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
Ihr vertretet das Königreich Norwegen. Norwegen ist eine parlamentarische Monarchie in Nordeuropa. In Norwegen gibt es 4,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Hauptstadt ist Oslo.
Kinder und junge Menschen unter 18 Jahren bilden 24% der Bevölkerung. Ihr legt großen Wert darauf, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche Zugang zu Bildung und anderen staatlichen Angeboten haben. Aber auch bei euch gibt es soziale Probleme und es gibt Kinder, die Gewalt oder Vernachlässigung erfahren. Diese Kinder haben weniger Möglichkeiten als andere Kinder und häufiger Schwierigkeiten in der Schule.
Euer Schwerpunkt bei den Verhandlungen:
Wichtig ist euch der Begriff "Universelles Design".
Mit universellem Design ist gemeint, dass Geräte, Umgebungen und Systeme derart gestaltet sein müssen, dass sie für so viele Menschen wie möglich ohne weitere Anpassung oder Spezialisierung nutzbar sind. Wenn das nicht möglich ist, müssen möglichst einfache zusätzliche Angebote für Menschen mit Behinderungen die Nutzung ermöglichen.
Beispiel für Universelles Design: Waschmaschine "Klassik":
Mit der Entwicklung der Waschmaschine "Klassik" wurde das Ziel verfolgt, die Wäschepflege für die Nutzer und Nuterinnen einfacher und komfortabler zu machen. Die Bedienelemente sind klar angeordnet, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Die Waschmaschine zeichnet sich vor allem durch folgende Punkte aus:
- Funktionen und Programme sind in großer Schrift auf der Bedienblende (die Prinzipien breite Nutzbarkeit und einfache und intuitive Benutzung werden erfüllt)
- Leicht erkennbare Darstellung durch zweizeiliges Display (die Prinzipien breite Nutzbarkeit und einfache und intuitive Benutzung werden erfüllt)
- Hinterleuchtete Anzeige (die Prinzipien breite Nutzbarkeit und einfache und intuitive Benutzung werden erfüllt)
- Verringerte Komplexität: fünf wesentliche Waschprogramme stehen zur Auswahl (die Prinzipien breite Nutzbarkeit, einfache und intuitive Benutzung und Fehlertoleranz werden erfüllt)
- Erhöhte Bauweise durch eingebauten Sockel, falls gewünscht (die Prinzipien Flexibilität in der Benutzung, niedriger körperlicher Aufwand und Größe und Platz für Zugang und Benutzung werden erfüllt)
- Adaption der Bedienung durch blinde Nutzende möglich (die Prinzipien Flexibilität in der Benutzung und sensorisch wahrnehmbare Informationen werden erfüllt)
- Möglichst optimale Handhabung der Maschine durch die Verwendung von gut bedienbaren Tasten und Drehschaltern (die Prinzipien breite Nutzbarkeit und einfache und intuitive Benutzung werden erfüllt)
Die Waschmaschinenreihe "Klassik" wurde 2009 mit dem "universal design award 09" sowie mit dem "universal consumer favorite 09" ( ) ausgezeichnet.
Eure Forderung an den Vertrag insgesamt: Eine Umwelt ohne Hindernisse und Barrieren für Menschen mit Behinderungen, gleich welcher Art und welchen Umfangs
Ihr seid der Meinung, dass individuelle Einschränkungen vor allem dann für die Einzelnen problematisch werden, wenn Hindernisse hinzukommen, die Zugänge versperren. Diese Hindernisse nennt ihr "Man-made-barriers": Von Menschen gemachte Barrieren. Diese scheinen Euch das eigentliche Problem zu sein und gleichzeitig eine technisch lösbare Aufgabe darzustellen.
Die Abschaffung von "Man-made-barriers" meint beispielsweise: nichts versperrt mehr Zugänge, es gibt keine Bordsteine, die Sprache ist überall leicht, die Nachrichten sind zum Beispiel auch in Gebärdensprache, es gibt überall auch Beschriftungen in Blindenschrift, also zum Beispiel im Aufzug oder Bus oder Flugzeug oder im Supermarkt.
Forderung nach Universellem Design meint beispielsweise: Gebäude, Produkte, Straßen oder Dienstleistungen, zum Beispiel im Rathaus, sind auf der ganzen Welt so gestaltet, dass sie ohne besondere Hilfe oder spezielle Anpassung von allen Menschen genutzt werden können.
Tipp: Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren, wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." ( )
Eure Forderungen zum Recht auf Bildung: Es muss Schulen geben für alle Kinder, aber nicht zwingend eine Schule für alle
Als Vertreter und Vertreterinnen der norwegischen Regierungsdelegation ist euch wichtig, dass Bildung nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch kleine Kinder, erwachsene und alte Menschen zugänglich sein muss. Für euch ist ein lebenslanges Lernen sehr wichtig. Zudem wollt ihr, dass alle Bildungseinrichtungen entsprechend des universellen Designs umgestaltet werden müssen. Wenn dies nicht möglich ist, haltet ihr aber auch speziell umgebaute Schulen für eine Möglichkeit, das Recht auf Bildung zu verwirklichen. Wichtig ist euch, dass überhaupt gut ausgestattete Bildungseinrichtungen und gut ausgebildetes Personal vorhanden sind.
Tipp: Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt.
Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Rollenkarte Weltorganisationen gehörloser, gehörlosblinder und blinder Menschen
Planspiel: Rollenkarte Weltorganisationen gehörloser, gehörlosblinder und blinder Menschen
Phase 1
Julia Bertmann, 28:
"Ich komme gut klar, aber die Leute…
Mit meiner Behinderung komme ich gut klar, aber es gibt Leute, die nicht behindert sind, die sagen: Diese junge Frau tut mir leid, sie sieht so komisch aus. Was hat sie denn? Ist sie krank? Das sagen ihre Augen. Sie trauen sich nicht, das laut zu sagen, weil sie denken, sie ist doof und mit der spricht man nicht.
Eine Behinderung ist keine Krankheit. Wir Behinderte sind so geboren. Wir können nichts dazu. (…) Ich möchte so behandelt werden wie nichtbehinderte Menschen. Ich mag mich so wie ich bin. I am what I am. Ich lebe genau so wie nichtbehinderte Menschen." (1)
Allgemeine Informationen über euch
World Blind Union (Weltorganisation für blinde Menschen)
Als World Blind Union vertretet ihr mehr als 160 Millionen blinde und sehbeeinträchtigte Menschen in 177 Mitgliedsländern. Ihr seid eine Nichtregierungsorganisation. Eure Vision ist eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben.
World Federation of the Deafblind (Weltorganisation für gehörlose und gleichzeitig blinde, bzw. sehbehinderte Menschen)
Als Vertreterinnen und Vertreter der World Federation of the Deafblind seid ihr ein Zusammenschluss von hör-sehbehinderten Menschen und vertretet diese weltweit. Euer Ziel ist es, die Lebensqualität von hör-sehbehinderten Menschen weltweit zu verbessern und ihre gesellschaftliche Isolation aufzubrechen.
World Federation of the Deaf (Weltorganisation gehörloser Menschen)
Als World Federation of the Deaf habt ihr euch 1951 in Rom/Italien zusammengeschlossen. Ihr vertretet Menschen mit Hörbehinderungen. Eure Arbeitsschwerpunkte sind:
- die Gebärdensprache bekannter zu machen,
- die Bildung für Menschen mit Hörbehinderungen zu verbessern,
- den Zugang zu Information und Dienstleistungen für Menschen mit Hörbehinderungen auszubauen.
Euer Schwerpunkt bei den Verhandlungen: Die Lebensqualität von Menschen mit Sinnesbehinderungen muss verbessert werden
Ihr seid der festen Überzeugung, dass es für euch als Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen wichtig ist, eure Lebensart, Kultur, Sprache und euer Umfeld selbst wählen zu können. Ihr findet, Menschen mit Sinnesbehinderungen sind die am stärksten isolierte Menschengruppe, die am häufigsten aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Dies hängt damit zusammen, dass es euch viel schwerer fällt als anderen Menschen, Kontakte zu knüpfen. Ihr habt oft keine Chance, euch mitzuteilen und werdet deswegen ausgegrenzt. Ihr findet es bedauerlich, dass die meisten Menschen viel zu wenig darüber wissen, wie ihr lebt und welche Schwierigkeiten ihr habt. Eine umfassende Teilhabe an der Bildung, dem Arbeitsleben und Freizeitaktivitäten war für euch bisher nicht möglich, da die allermeisten Menschen eure Sprachen nicht beherrschen, eure Kommunikationswege nicht kennen und damit eure Kultur nicht teilen.
Ihr weist besonders auf die extreme Isolation von Menschen hin, die sowohl hör- als auch sehbehindert sind. Sie können ihre Umgebung nur über ihren Tastsinn, ihr Vibrationsempfinden, ihren Geruchs-, Geschmacks- und Gleichgewichtssinn erkunden.
Forderungen an den Vertrag insgesamt: Lebensbedingungen für Menschen mit Sinnesbehinderungen verbessern
Ihr wollt, dass jeder blinde, sehbehinderte oder hörbehinderte Mensch so selbstständig und selbstbestimmt wie möglich leben kann. Hierfür muss sie oder er so viel Unterstützung und Förderung erfahren, wie sie oder er benötigt. Ihr setzt euch deshalb für die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen, für gesellschaftliche und berufliche Eingliederung ein. Menschen, die nicht sehen oder hören können sollen wie alle anderen Menschen auch ganz selbstverständlich Teil der Gesellschaft sein und sich willkommen fühlen. Um dies zu gewährleisten, muss mehr auf ihre persönlichen, unterschiedlichen Bedürfnisse eingegangen werden.
Dazu gehört Folgendes:
- Verkehrsampeln haben neben einer Vibrationsfunktion auch eine Sprachfunktion,
- Hörfilme und Übersetzungen in Gebärdensprache laufen im Fernsehen,
- Wahlschablonen ermöglichen blinden Menschen die geheime Wahl,
- Medikamentenverpackungen und –beipackzettel werden leicht verständlich, größer und auch in Brailleschrift beschriftet,
- Geldscheine und Münzen sind blinden- und sehbehindertengerecht,
- Hotels, Restaurants und Bars verbessern ihr Angebot für Menschen, die Gebärdensprache nutzen oder auf den Tastsinn bei der Kommunikation angewiesen sind,
- Menschen, die sowohl hör- als auch sehbehindert sind haben eine umfassende Assistenz, um überall dort teilzunehmen.
Tipp
Schreibt diese Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird sie in der Verhandlung zwei Minuten lang vorstellen. Sprecht euch in eurer Gruppe gut ab, denn ihr sollt ein einheitliches Bild nach außen abgeben. Macht euch durch euer Gruppenemblem erkennbar. In der Gruppe dürft ihr so viel diskutieren wie ihr wollt. Ihr könnt dabei eure Rolle auch ausschmücken, mit eigenen Argumenten und Ideen bereichern oder etwas dazu erfinden. Beachtet aber bitte, dass ihr euch nicht zu weit von den Anregungen auf der Rollenkarte entfernt.
Beachtet bitte, dass das Recht auf Bildung in dieser Phase noch nicht im Mittelpunkt steht!
Phase 2
Haydee Beckles aus Panama:
"Ich habe meine Schulausbildung in einer Regelschule begonnen, aber ich war sehr langsam und schlief auf meinem Stuhl ein, daher hat der Lehrer gesagt, dass ich auf eine spezielle Schule gehen müsse. Sie haben mich auf eine Sonderschule geschickt. In dieser Schule haben sie kein Englisch gesprochen, nur Spanisch, und so musste ich Spanisch lernen. Dies war nicht meine Muttersprache, weil wir zu Hause Englisch gesprochen haben. Ich habe mich also angepasst und lebte von da an in zwei Welten. Zum einen im Sonderschulsystem, dort haben sie nur wenig von mir erwartet, also tat ich das Wenige. Zum anderen war ich zu Hause, meine Mutter und mein Vater haben mich in alles inkludiert, also einbezogen. Sie haben mich gelehrt, die Dinge auf meine eigene Weise zu tun. Ich habe gelernt meine Hausaufgaben langsam zu machen, mit all meinen Geschwistern. Ich habe gelernt, Diktate zu schreiben, Rechtschreibung zu üben und im Wörterbuch nachzuschlagen, mein Zimmer aufzuräumen und den Abwasch zu machen ohne etwas kaputt zu machen. Auf diese Weise habe ich gelernt, selbständig in der Gemeinschaft, gemeinsam mit allen anderen, zu leben. Mit meinem heutigen Verständnis sehe ich, dass meine Entwicklung besser verlaufen wäre, wenn ich in einer Regelschule unterrichtet worden wäre. Ich bin aus Panama hergekommen, um Sie alle zu bitten, anderen Kindern mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, in eine Schule für Alle zu gehen, in ihrer Gemeinde." (2)
Eure Forderung zum Recht auf Bildung: Es soll weiterhin mehrere Schulformen geben
Der Hintergrund eurer Forderungen: Ihr seid erschüttert darüber, dass weltweit betrachtet die Mehrzahl der Kinder mit Hör/Sehbehinderungen keinen Zugang zu Bildung hat. Sie werden ausgegrenzt oder die angebotene Bildung ist nicht hochwertig. Es gibt oft nicht genügend Schulmaterial und schlecht ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Das größte Problem und die zentrale Menschenrechtsverletzung ist, dass Kindern mit einer Hörbehinderung, blinden Kindern und hör-sehbehinderten Kindern kein Unterricht in Gebärdensprache beziehungsweise Brailleschrift ermöglicht wird.
Besonders wichtig ist euch, dass die Bedürfnisse von Menschen mit Sinnesbehinderungen in der Bildung umfassend berücksichtigt werden. Sie brauchen Hilfsmittel, um sich verständlich zu machen. Sie sind auf eine Kommunikation durch spezielle Schrift, Übersetzungen in Gebärdensprache, besondere Arbeitsblätter, Sprachcomputer angewiesen. Das Lernumfeld muss dafür sehr umfangreich ausgestattet sein.
Ihr fordert alle Anwesenden dazu auf, dass der Vertrag folgende Punkte zum Recht auf Bildung berücksichtigen soll: Blinde, gehörlose und hör-sehbehinderte Kinder und Jugendliche und ihre Eltern sollen die Bildungseinrichtung frei auswählen dürfen. Dazu soll es in Zukunft wie bisher zwei Schulformen geben, Regelschulen und spezielle Schulen für Kinder mit Sinnesbehinderungen. So können diese Kinder entweder mit anderen sinnesbehinderten Kindern oder in der Regelschule unterrichtet werden. Gleichzeitig soll es in der Regelschule Unterricht auch für hörende und sehende Kinder in Brailleschrift und Gebärdensprache geben. Wenn viele Kinder diese Sprachen und Schriften kennen und lernen und es auch für Lehrer und Lehrerinnen an Regelschulen normal geworden ist, diese Sprachen zu unterrichten, wird es möglich, eine Schule für alle zu verwirklichen.
Solange dies nicht der Fall ist, befürchtet ihr, dass Kinder mit Sinnesbehinderungen in einer Schule für Alle keine Chance haben, ihre eigene Kultur und Sprache zu entwickeln und zudem weiterhin ausgegrenzt würden. Sie haben dort keine Chance, Freundinnen und Freunde zu finden und sind von den anderen Kindern isoliert. Da zwischen den Kindern Sprachbarrieren bestehen, ist es zu schwer für Kinder mit Hör/Sehbehinderungen, Kontakt mit sehenden oder hörenden Kindern aufzunehmen.
Ihr bedauert sehr, euch beim Thema Schule für Alle gegen die anderen Vertreterinnen und Vertreter stellen zu müssen. Aber ihr seid der Meinung, dass Inklusion in Form einer Schule für Alle noch nicht funktioniert.
Tipp
Auch in Phase 2 dürft ihr wieder kreativ die Argumente und Forderungen ausschmücken und etwas dazu erfinden. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht zu weit von den Inhalten auf der Rollenkarte entfernt.
Schreibt eure Positionen in Stichpunkten auf ein Flipchart oder an die Tafel. Eure Sprecherin oder euer Sprecher wird diese wieder der Versammlung vorstellen. Denkt daran, dass in Phase 2 auch jemand anders für eure Gruppe sprechen kann als in Phase 1. Für die Vorstellung in der Versammlung habt ihr wieder zwei Minuten Zeit. Dann folgt eine Diskussion. Bereitet euch gut vor und bedenkt, dass ihr euch auch von anderen überzeugen lassen dürft und natürlich versuchen sollt, andere zu überzeugen. Die Ergebnisse der Diskussion sind offen. Wichtig ist nur, dass es am Ende eine Einigung gibt. Also seid diplomatisch.
Wenn andere Verhandlungsteilnehmende euch ablenken oder andere Menschen mit Behinderungen in den Vordergrund stellen als ihr, könnt ihr dies verstehen und auch annehmen. Euch ist aber trotzdem wichtig, eure inhaltlichen Schwerpunkte zu betonen und darüber zu verhandeln.
Übersicht über die anderen Gruppen
Damit ihr einschätzen könnt, was in den Verhandlungen auf euch zukommt, hier eine kurze Übersicht darüber, was die anderen Gruppen fordern. Überlegt in eurer Gruppe, wie ihr zu diesen Forderungen steht, ob ihr sie gut findet oder ablehnt. Bereitet euch damit auf die kommende Verhandlung vor.
Die Afrikanische Union fordert die besondere Förderung der Rechte von Mädchen und Frauen mit Behinderungen, auch in der Bildung und für eine Schule für Alle.
Australien möchte, dass jedes Kind in eine Schule für Alle geht, die wohnortnah ist und in die auch die Nachbarskinder gehen.
Brasilien findet, dass Bildung gemeinsam in einer Schule stattfinden soll, weil sich dadurch die Einstellung von Menschen ohne Behinderung gegenüber Menschen mit Behinderungen positiv verändern kann.
China möchte die Förderung der Armutsbekämpfung ausweiten und verschiedene Schulformen ermöglichen: Es muss der chinesischen Delegation zufolge für jedes Kind eine Schule geben, aber nicht unbedingt eine Schule für Alle.
Die Europäische Union möchte Chancengleichheit durch Bildung ermöglichen. Ihre Mitglieder sind sich nicht ganz einig, was genau das für das Schulsystem heißt.
Inclusion International fordert eine Schule für Alle, denn nur eine Schule für Alle kann die Kreativität und Begabungen von allen Kindern fördern.
Das Internationale Bündnis von Menschen mit Behinderungen fordert eine Schule für Alle und die Einführung von Brailleschrift, Leichter Sprache und Gebärdensprache als Fremdsprachen.
Japan legt besonders viel Wert auf eine kostenlose Bildung für jedes Kind. Das Schulsystem mit unterschiedlichen Schulformen sollte beibehalten werden.
Kanada ist der Meinung, dass Bildung unbedingt der Würde der Kinder gerecht werden muss und dass dies nur in einer Schule für Alle geschehen kann.
Norwegen legt großen Wert auf Lebenslanges Lernen, also Bildung für alt und jung. Norwegen hat keine klaren Vorstellungen darüber, ob es in Zukunft eine Schule für Alle oder verschiedene Schulformen geben sollte.
Die Weltorganisation gehörloser Menschen, die Weltorganisation für gehörloseblinde Menschen und die Weltorganisation für blinde Menschen sind sich einig, dass es verschiedene Schulformen geben muss. Aus ihrer Sicht ist die Forderung nach einer Schule für Alle nicht angemessen für Menschen, die blind, gehörlos oder gehörlosblind sind.
Quellen:
1: Julia Fischer, Anne Ott, Fabian Schwarz (Hg.) 2010: Mehr vom Leben. Frauen und Männer mit Behinderung erzählen. Balance Buch, Bonn, S. 266.
2: S. 138 Originalstatement aus den Dokumenten von Inclusion International, übersetzt vom Deutschen Institut für Menschenrechte
Planspiel: Weltkarte
Weltkarte
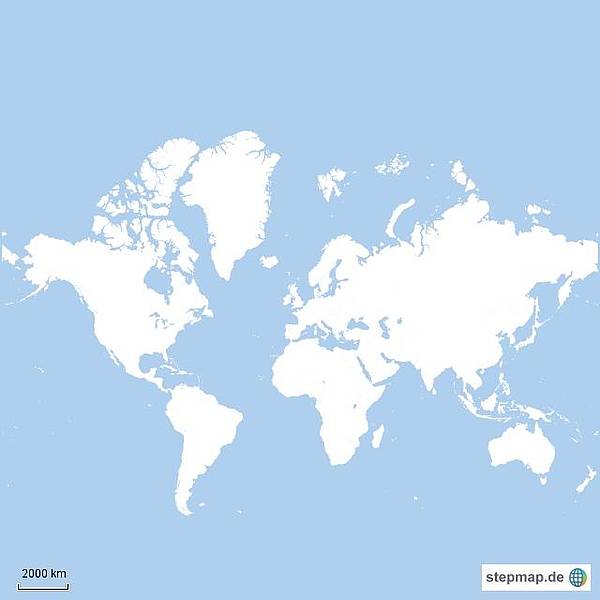
Planspiel: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Sozialpakt und Kinderrechtskonvention
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Sozialpakt und Kinderrechtskonvention
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) (1948)
Artikel 26: Recht auf Bildung
Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.
Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft (…) beitragen (…). Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt, engl. ICESCR)
(Inoffizielle Kurzfassung) (1976)
Artikel 13
Jeder hat ein Recht auf Bildung. Dies muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewußtseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken.
Der Grundschulunterricht muß verpflichtend für alle gelten und kostenlos zugänglich sein.
Jeder Vertragsstaat, in dem es keine Grundschulpflicht und keinen unentgeltlichen Zugang zur Grundschule gibt, ist verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren einen ausführlichen Aktionsplan auszuarbeiten und anzunehmen, der die schrittweise Verwirklichung dieses Grundsatzes vorsieht.
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK, engl. CRC) (1990) (Inoffizielle Kurzfassung)
Artikel 28: Erziehung und Bildung
Jedes Kind hat das Recht auf Bildung, und es ist dabei die Aufgabe des Staates, den kostenlosen Besuch einer Schule zur Pflicht zu machen, verschiedene Formen der weiterbildenden Schulen zu entwickeln und Kindern entsprechend ihren Fähigkeiten den Besuch von Hochschulen zu ermöglichen. Die dabei nötige Disziplin in Schulen darf keine Rechte und vor allem nicht die Würde des Kindes verletzen.
Du hast ein Recht auf Bildung. Die Disziplin in der Schule darf nicht gegen deine Menschenwürde verstoßen. Der Besuch der Grundschule muss verpflichtend und kostenlos sein. Reiche Länder sollen ärmeren Ländern helfen, dies zu erreichen.
Artikel 29: Ziele der Bildung
Deine Bildung soll darauf ausgerichtet sein, deine Persönlichkeit, deine Begabungen und deine geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu bringen. Sie soll dich aufs Leben vorbereiten und dir Achtung vor deinen Eltern, deiner Gesellschaft und anderen Kulturen gegenüber vermitteln. Du hast das Recht, deine Rechte kennenzulernen.
(Quelle: "Kompass", ab Seite 403)
Planspiel: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Art. 24 in Leichter Sprache
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK), Artikel 24 in Leichter Sprache
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(in Leichter Sprache)
Artikel 24: Recht auf Bildung
Schule
Alle Kinder sollen in die gleichen Schulen gehen.
Behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder sollen gemeinsam lernen.
Es soll keine Sonder-Schulen geben.
Die Lehrer und Lehrerinnen müssen für alle Kinder da sein.
Sie müssen für jedes Kind die richtige Hilfe kennen.
Dafür brauchen auch die Lehrer und Lehrerinnen eine gute Ausbildung.
Manche Kinder brauchen viel Unterstützung.
Das geht auch in der Schule für alle.
Die Unterstützungs-Person kommt dann mit in die Klasse.
Auch nach der Schule geht das weiter.
Auch in der Ausbildung lernen alle zusammen.
Und an der Universität.
www.behindertenbeauftragter.de
www.ich-kenne-meine-rechte.de/index.php
Rollenspiel: Talkshow
"Wer bestimmt, was für mich gut ist?" - Rollenspiel: Talkshow
Einführung
Inhalt des Rollenspiels
In der Talkshow geht es um die 12-jährige Klara Demirel. Sie hat seit ihrer Geburt eine Sehbehinderung, die zunehmend schlechter wird. Klara, ihre Eltern, ihre Freundinnen, ihre Lehrerin und andere Pädagoginnen und Pädagogen sowie Expertinnen und Experten diskutieren darüber, wie sich Klaras weitere Schullaufbahn gestalten kann und wer eigentlich darüber entscheiden darf. Die Situation ist verschiedenen aktuellen Fällen nachempfunden und spiegelt reale Konflikte von Kindern mit Behinderungen und deren Eltern wider, bietet aber auch Hintergrundinformationen und Ansätze für Lösungsvorschläge.
Ziel des Rollenspiels
Das Rollenspiel "Talkshow", in dem verschiedene Personen Argumente austauschen, möchte wesentliche menschenrechtlich relevante Fragen in spielerischer Form thematisieren. Im Zentrum stehen die Fragen: Wer darf über andere Menschen bestimmen? Wie werden Behinderungen bewertet? Was können Behinderungen für Menschen bedeuten? Am Beispiel der Frage der Schulwahl sollen Fragen nach Selbstbestimmung und Teilhabe als alltäglich und für alle Menschen interessant und wichtig deutlich werden.
Die Situation
Die deutsch-türkische Familie Demirel lebt in einem kleinen Ort in einer ländlichen Gegend – im Umkreis von 50 km gibt es keine Stadt. Die 12-jährige Tochter Klara hat seit ihrer Geburt eine Sehbehinderung, und ihr Sehvermögen wird zunehmend schlechter. Sie ist jetzt in der 6. Klasse. Bisher geht Klara wie die anderen Kinder und Jugendlichen aus ihrem Dorf in die Realschule im Nachbarort. Dort wird sie in drei Stunden pro Woche von einer Sonderpädagogin unterstützt. In den restlichen Stunden arbeitet sie mit den anderen Schülerinnen und Schülern an der Tafel, im Buch oder auf Arbeitsblättern. Viele Lehrerinnen und Lehrer geben ihr dieselben Arbeitsblätter, wie sie auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler bekommen - nur mit stärkeren Kontrasten, weniger Farben und vergrößerter Schrift. Zum Lesen benutzt Klara manchmal eine Hellfeldlupe. Das ist eine Lupe mit der man besonders gut lesen kann, weil man sie nicht in der Hand halten muss, sondern auf den Text stellen kann. So wackelt nichts und man kann aus jeder Entfernung gut lesen.
Weil die Sehbehinderung zugenommen hat, braucht Klara nun mehr Unterstützung. Entweder müsste eine Person sie öfter unterstützen oder sie bräuchte weitere technische Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein Lesegerät, das ihr die Texte stark vergrößert auf einem Bildschirm anzeigt. Am besten beides. Die Eltern, Klara, das Sozialamt und die Schule müssen nun gemeinsam eine Lösung finden. Schulleitung und Amt finden, dass Klara am besten ein Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Schülerinnen und Schüler (früher: Sonderschule) besuchen soll. Dieses ist für Kinder mit einer Sehbehinderung besonders gut ausgestattet. Dieses Förderzentrum ist aber fast 100 Kilometer von Klaras zu Hause entfernt. Sie könnte dann nur noch an den Wochenenden nach Hause kommen und würde in der Woche mit anderen Jugendlichen, die auch nicht gut sehen können, in einem Internat leben. Klara und ihre Familie möchten etwas anderes.
Die Expertinnen und Experten
Die eingeladenen Expertinnen und Experten sind geteilter Meinung und diskutieren mit. Ihre Haltungen reichen von "Behinderung ist ein medizinisches Problem!" über "Die Umwelt und die Gesellschaft behindern Menschen!", "Behinderte haben ein Defizit" bis hin zu der menschenrechtlich fundierten Haltung "Menschen mit Behinderungen leisten jeden Tag einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft" und "Behinderungen entstehen im Zusammenspiel zwischen Umwelt und individuellen Gegebenheiten". Solche oder auch ganz andere Aussagen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Mithilfe dieser Talkshow könnt ihr feststellen, warum es nicht sinnvoll ist, Behinderung allein als medizinisches oder individuelles Problem zu verstehen und was man menschenrechtlich unter Behinderung versteht.
Ablauf und Struktur des Rollenspiels
Damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt, ist es wichtig, ein Thema erst einmal von möglichst verschiedenen Seiten kennenzulernen. Die Talkshow bietet diese Möglichkeit. In der Diskussion sollte deutlich werden, dass unterschiedliche Menschen Zusammenhänge verschieden beschreiben und aus anderen Perspektiven beleuchten. Zu Beginn habt ihr Zeit, euch auf die eigene Rolle vorzubereiten. Dann treffen sich die Gäste in der Talkshow und diskutieren über ihre verschiedenen Standpunkte. Diese können sich während der Diskussion auch verändern. Ein Moderationsteam leitet die Talkshow. Die Moderation hat eine wichtige Funktion: Sie strukturiert das Gespräch, stellt Fragen und fasst Aussagen zusammen.
Ein kurzer Überblick - Was passiert in einer Talkshow?
- Die Organisationsgruppe oder die Moderationsgruppe erklären den Teilnehmenden die Zielsetzung und den Verlauf der Talkshow. Die Teilnehmenden bilden elf Kleingruppen (mindestens zwei Personen pro Gruppe).
- Die Rollenkarten werden verteilt. Jede Gruppe hat 15 Minuten Zeit, um sich einzuarbeiten. In jeder Kleingruppe werden ein oder zwei Sprecherinnen oder Sprecher gewählt, die als Gäste an der Talkshow teilnehmen.
- Die Moderationsgruppe eröffnet die Talkshow. Diese besteht aus zwei Phasen: 1. Alle Gäste stellen ihre Position in jeweils zwei Minuten vor. 2. Anschließend wird 20 Minuten lang gemeinsam diskutiert.
- Nach einer Pause wird die Talkshow gemeinsam besprochen: Welche Argumente wurden für welche Schulform genannt? Welche Sichtweisen gab es in der Diskussion hinsichtlich Klaras Situation und der Frage, wer über die Schule entscheiden darf? Welche Sichtweisen und Argumente haben euch überzeugt und warum?
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Talkshow
- Moderationsgruppe – Frau oder Herr Sonnentor und Team
- Organisationsgruppe
- Frau und Herr Demirel
- Klara Demirel
- Schuldirektorin - Herta Müller
- Klassenlehrerin - Andrea Schmitt
- Mitschülerinnen - Sarah und Yasemin
- Mitarbeiterin vom Sozialamt – Jutta Meyer
- Experte aus dem Bereich Medizin - Detlef Hase
- Expertin aus dem Bereich Erziehung – Ellen Sanchez
- Experte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Dr. Hans-Peter Wagenknecht
- Experte in eigener Sache - Erwin Wiese
Dieses Material braucht ihr für die Talkshow
Stühle, Papier, Stifte, Rollenkarten.
Vorbereitung
Die Gruppe oder Schulklasse wird in Kleingruppen eingeteilt. Eine Gruppe ist für die Moderation verantwortlich, die anderen Gruppen übernehmen jeweils eine der genannten Rollen.
Jede Kleingruppe sollte aus mindestens zwei Personen bestehen. In der Gruppe "Moderation" sollen möglichst mehr als zwei Personen mitarbeiten.
Sobald die Rollen verteilt sind, erhalten alle Kleingruppen ihre Rollenbeschreibung. Mit dieser können sie sich auf die Talkshow vorbereiten. Dazu haben sie 15 Minuten Zeit.
Gruppengröße
Am besten funktioniert das Rollenspiel mit mindestens 24 Teilnehmenden. Wenn ihr wenige Mitspielerinnen und Mitspieler seid, könnt ihr auch in jeder Gruppe nur eine Person die Rolle spielen lassen und die Organisation auch von der Moderationsgruppe übernehmen lassen. Dann ist das Spiel aber anspruchsvoller, weil die Teilnehmenden sich alleine vorbereiten und ihre Rolle vertreten müssen, ohne vorher mit ihren Mitspielerinnen oder Mitspielern diskutiert zu haben.
Zur Weiterarbeit
- Wie hat euch das Spiel gefallen?
- Welche Informationen fehlten euch, bzw. welche Informationen wollt ihr gern recherchieren?
Zu den Rollenkarten
Rollenkarte Moderationsgruppe
Rollenkarte Organisationsgruppe
Rollenkarte Herr und Frau Demirel
Rollenkarte Klara Demirel
Rollenkarte Schuldirektorin Frau Müller
Rollenkarte Sozialamtsmitarbeiterin Jutta Meyer
Rollenkarte Lehrerin Andrea Schmitt
Rollenkarte Mitschülerinnen Sarah und Yasemin
Rollenkarte Mitarbeiter medizinischer Fachdienst, Detlef Hase
Rollenkarte Erzieherin mit spezieller Ausbildung, Ella Sanchez
Rollenkarte Erwin Wiese, Experte in eigener Sache
Rollenkarte Experte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Dr. Hans-Peter Wagenknecht
Talkshow: Rollenkarte Moderationsgruppe
Rollenkarte: Moderationsgruppe
Vorbereitung
- Lest den Einführungstext und die Übersicht über die Talkshowgäste, damit ihr wisst: um welche Situation es geht, wer eure Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind und welche Standpunkte sie vertreten.
- Bestimmt zwei Sprecherinnen oder Sprecher für die Moderation. Alle anderen übernehmen eine beratende Aufgabe. Eine Person kann "Zeitwächter" oder "Zeitwächterin" sein. Seine oder ihre Aufgabe ist es, auf die vereinbarten Zeiten zu achten.
- Erarbeitet als Moderationsteam gemeinsam einen kurzen Text, mit dem ihr die Talkshow einleiten könnt.
- Dann bestimmt ihr eine Sitzordnung für die Talkshow. Überlegt: Ist es gut, wenn die Vertreter und Vertreterinnen gegensätzlicher Positionen nebeneinander am Tisch sitzen?
- Ihr legt auch fest, in welcher Reihenfolge die Teilnehmenden sprechen dürfen. Überlegt: Wann ist eine Talkshow spannender: Wenn die gegnerischen Positionen abwechselnd sprechen, oder wenn erst mehrere Personen für eine Position und dann einige für eine andere Position sprechen?
- Nach 15 Minuten ist die Vorbereitungszeit beendet. Ihr ladet die Sprecherinnen und Sprecher der Kleingruppen – eure Talkshowgäste - ein, Platz zu nehmen. Dann stellt ihr die Teilnehmenden einander vor und erklärt, wie die Talkshow ablaufen wird. Danach beginnt ihr mit eurer Einführung und fordert die Gäste nacheinander auf, dazu kurz, in zwei Minuten, Stellung zu nehmen. Anschließend diskutieren die Gäste miteinander.
- Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Moderatorin oder Moderator Frau bzw. Herr Sonnentor und Team
Die Moderatorin bzw. der Moderator führt durch die Talkshow und unterstützt die Auswertung. Ihr seid unparteiisch und versucht, alle miteinander ins Gespräch zu bringen. Dabei achtet ihr darauf, dass alle fair miteinander sprechen. Besonders kümmert ihr euch um das Wohl von Klara. Denn es wird über ihr Leben und ihre Zukunft gesprochen.
- Um die Talkshow zu beginnen, bittet ihr alle Sprecherinnen und Sprecher pünktlich an den Tisch zu kommen. Die anderen spielen das Publikum.
- Begrüßt eure Gäste und das Publikum und erläutert, worum es in der heutigen Talkshow geht.
- Erklärt den Gästen und dem Publikum die Diskussionsregeln.
- Stellt die Gäste nacheinander vor und lasst sie ihr kurzes Eingangsstatement halten. Das bedeutet, sie sollen in zwei Minuten ihre wichtigste Aussage zusammenfassen und vortragen.
- Bedankt euch für die Beiträge der Gäste.
- Ihr könnt Nachfragen stellen oder die Teilnehmenden bitten genauer zu erklären, was sie meinen.
- Nach besonders strittigen Aussagen könnt ihr spontan die Meinung der anderen Gäste einholen. Ihr könnt zum Beispiel fragen, ob diese zustimmen, widersprechen oder etwas ergänzen möchten.
- Wenn ihr es euch zutraut, versucht am Ende der 20-minütigen Diskussion die Standpunkte zusammenzufassen. Gab es eine Einigung? Haben sich manche von den Argumenten anderer überzeugen lassen?
- Beendet die Talkshow, indem ihr euch bei allen Gästen und dem Publikum bedankt.
Eure Einleitung der Talkshow könnte ungefähr so beginnen:
"Heute wollen wir hier im Studio aktuelle und für alle Menschen interessante Fragen diskutieren: Wer darf über andere Menschen entscheiden? Vor allem dann, wenn es sich um Kinder und Jugendliche handelt. In unserm Fall verschärft sich die Fragestellung dadurch, dass Klara, 12 Jahre alt, schlecht sieht und insofern als 'behindert' eingestuft wird. Darf sie entscheiden, auf welche Schule sie gehen möchte, oder ihre Eltern, oder Ämter, Lehrer und Lehrerinnen, Schuldirektoren oder -direktorinnen? Diese Frage wollen wir mit Klara und ihrer Familie, ihren Mitschülerinnen und verschiedenen anderen Menschen, die sich mit der Frage befassen, besprechen. Zusätzlich werden wir einige Expertinnen und Experten befragen, die unterschiedliche Positionen vertreten.
Anlass unserer Diskussion ist die Frage, welche Schule die 12-Jährige in Zukunft besuchen wird.
Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, Klara! Klara hat eine starke Sehbehinderung und möchte wie bisher ihre Schule besuchen. Einige Beteiligte sind jedoch anderer Meinung. Mithilfe der hier anwesenden Diskussionsteilnehmerinnen und –teilnehmer möchten wir folgende Fragen beantworten:
- Welche Schule ist für Klara die richtige?
- Wer soll eigentlich die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
- Was verstehen wir unter ‚Behinderung’?
- Was steht in der UN-Behindertenrechtskonvention und anderen Rechtstexten zu dieser Frage?"
Eure Fragen an die Talkshow-Gäste könnten ungefähr so beginnen:
- An Klara: "Auf welche Schule möchtest du gerne gehen? Bitte begründe deine Wahl. Wer soll diese Entscheidung deiner Meinung nach treffen?"
- An die Schulleitung, das Sozialamt und den medizinischen Experten: "Warum glauben Sie, dass nicht Klara und ihre Eltern, sondern finanzielle und medizinische Umstände über Klaras Schulbesuch entscheiden sollen?"
- An die Lehrerin: "Was würde Klara helfen, um in ihrer jetzigen Klasse weiter gut lernen zu können?"
- An die Erzieherin und die Experten und Expertinnen: "Was meinen Sie, wer diese Entscheidung treffen darf? Wie ist die Situation rechtlich aus Sicht der Menschenrechtsdokumente zu bewerten? Ist Klara nach der Kinderrechtskonvention und der Behindertenrechtskonvention diejenige, die befragt und ernst genommen werden muss? Darf sie auf einer Regelschule bleiben, wenn sie das möchte?"
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke sind nicht erlaubt.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Übersicht über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Talkshow
Frau und Herr Demirel: Die Eltern wünschen sich, dass Klara weiter in die Schule im Nachbarort gehen kann. Sie wollen nicht die Woche über von ihrem Kind getrennt sein. Außerdem wollen sie den bestmöglichen Schulabschluss für ihre Tochter.
Klara Demirel: Klara möchte weiter gemeinsam mit ihren Freundinnen in die Schule im Nachbarort gehen.
Mitschülerinnen - Sarah und Yasemin: Beide Mädchen möchten, dass Klara weiter mit ihnen zur Schule geht.
Schuldirektorin - Herta Müller: Die Direktorin möchte, dass Klara in das Förderzentrum wechselt. Wenn Klara an ihrer Schule bleibt, bedeutet das für sie viel Arbeit, denn sie muss Geld für technische Hilfsmittel und Personal beantragen.
Klassenlehrerin - Andrea Schmitt: Die Klassenlehrerin unterrichtet Klara gern in ihrer Klasse.
Mitarbeiterin vom Sozialamt – Jutta Meyer: Das Sozialamt möchte, dass Klara das Förderzentrum besucht. Sonst müsste das Amt viel Geld für Klaras Unterstützung ausgeben. Die Kosten für das Förderzentrum würde ein anderes Amt bezahlen.
Experte aus dem Bereich Medizin - Detlef Hase: Herr Hase findet, dass Klara mit ihrem Defizit – ihrem schlechter werdenden Sehen – beim medizinischen und pädagogischen Fachpersonal eines Förderzentrums am besten aufgehoben wäre.
Expertin aus dem Bereich Erziehung – Ellen Sanchez: Frau Sanchez findet, dass Klara selbst entscheiden soll, wo und wie sie am Besten lernen kann. Sie bezieht sich auf wichtige Grundprinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention: Partizipation und Selbstbestimmung.
Experte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Dr. Hans-Peter Wagenknecht: Herr Wagenknecht findet, dass es gar keine verschiedenen Spezialschulen geben sollte, sondern nur eine Schule für alle. Alles andere sei Diskriminierung. Auch er bezieht sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention, in der mit dem Begriff "Inklusion" seiner Meinung nach genau das beschrieben wird.
Experte in eigener Sache - Erwin Wiese: Herr Wiese findet, dass Klara entscheiden soll, denn Menschen mit oder ohne Behinderungen wissen am besten selbst, was gut für sie ist.
Planspiel: Rollenkarte Organisationsgruppe
Rollenkarte: Organisationsgruppe
- Mache dich zuerst mit der Einführung, den Rollenkarten sowie den Hinweisen zur Auswertung vertraut.
- Stelle der Gruppe die Einführung vor.
- Teile die Gruppe in Kleingruppen auf.
- Berate die Kleingruppen auf Nachfrage. Stelle dich vor allem der Moderation zur Verfügung – denn du hast den Überblick und kennst alle Rollen. Deshalb kann deine Unterstützung für die Moderation hilfreich sein.
- Schreib während der Talkshow wichtige Argumente auf. Beobachte, ob sich vielleicht jemand von den Argumenten einer anderen Person überzeugen lässt. Deine Aufzeichnungen sind sehr wichtig für alle, denn nur mit ihnen ist es nach der Talkshow möglich, noch einmal in Ruhe über die Argumente nachzudenken oder sie weiter zu diskutieren.
- Leite nach der Talkshow eine Reflexion an. Fasse zuerst die Diskussion (den Prozess) zusammen und beginn dann die Auswertung (Ergebnis).
Notiere Folgendes zum Prozess:
- Wer hat welche Position vertreten?
- Welche unterschiedlichen Sichtweisen auf Behinderung wurden vorgetragen?
- Wie wurden sie begründet?
- Wer hatte eine eindeutige Meinung? Wessen Position war nicht eindeutig?
- Wer hat seine Meinung im Verlauf der Diskussion geändert?
Notiere Folgendes zum Ergebnis:
- Welche Sichtweisen waren euch schon bekannt, welche waren neu?
- Welche Sichtweise haben eurer Meinung nach die meisten Menschen in Deutschland? Wie sind sie wohl zu dieser Sichtweise gekommen?
- Welche Sichtweise entspricht dem menschenrechtlichen Grundsatz des Diskriminierungsverbotes ("Niemand darf auf Grund seines Geschlechts, Alters, seiner Herkunft, seines Gesundheitszustandes, seiner Religion usw. benachteiligt werden")?
- Welche Sichtweise überzeugt euch? Warum?
Übersicht über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Talkshow
Frau und Herr Demirel: Die Eltern wünschen sich, dass Klara weiter in die Schule im Nachbarort gehen kann. Sie wollen nicht die Woche über von ihrem Kind getrennt sein. Außerdem wollen sie den bestmöglichen Schulabschluss für ihre Tochter.
Klara Demirel: Klara möchte weiter gemeinsam mit ihren Freundinnen in die Schule im Nachbarort gehen.
Mitschülerinnen - Sarah und Yasemin: Beide Mädchen möchten, dass Klara weiter mit ihnen zur Schule geht.
Schuldirektorin - Herta Müller: Die Direktorin möchte, dass Klara in das Förderzentrum wechselt. Wenn Klara an ihrer Schule bleibt, bedeutet das für sie viel Arbeit, denn sie muss Geld für technische Hilfsmittel und Personal beantragen.
Klassenlehrerin - Andrea Schmitt: Die Klassenlehrerin unterrichtet Klara gern in ihrer Klasse.
Mitarbeiterin vom Sozialamt – Jutta Meyer: Das Sozialamt möchte, dass Klara das Förderzentrum besucht. Sonst müsste das Amt viel Geld für Klaras Unterstützung ausgeben. Die Kosten für das Förderzentrum würde ein anderes Amt bezahlen.
Experte aus dem Bereich Medizin - Detlef Hase: Herr Hase findet, dass Klara mit ihrem Defizit – ihrem schlechter werdenden Sehen – beim medizinischen und pädagogischen Fachpersonal eines Förderzentrums am besten aufgehoben wäre.
Expertin aus dem Bereich Erziehung – Ellen Sanchez: Frau Sanchez findet, dass Klara selbst entscheiden soll, wo und wie sie am Besten lernen kann. Sie bezieht sich auf wichtige Grundprinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention: Partizipation und Selbstbestimmung.
Experte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Dr. Hans-Peter Wagenknecht: Herr Wagenknecht findet, dass es gar keine verschiedenen Spezialschulen geben sollte, sondern nur eine Schule für alle. Alles andere sei Diskriminierung. Auch er bezieht sich auf die UN-Behindertenrechtskonvention, in der mit dem Begriff "Inklusion" seiner Meinung nach genau das beschrieben wird.
Experte in eigener Sache - Erwin Wiese: Herr Wiese findet, dass Klara entscheiden soll, denn Menschen mit oder ohne Behinderungen wissen am besten selbst, was gut für sie ist.
Talkshow: Rollenkarte Herr und Frau Demirel
Rollenkarte: Herr und Frau Demirel
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin und einen Sprecher wählen. Sie nehmen später als Herr und Frau Demirel an der Talkshow teil. Alle anderen in eurer Gruppe spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Die Eltern Demirel
Herr und Frau Demirel sind die Eltern von Klara. Frau Demirel ist als kleines Mädchen mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Sie arbeitet als Büroangestellte. Ihr Mann ist Bauingenieur und oft auf Geschäftsreisen. Herr Demirel ist in Deutschland geboren.
Die Eltern möchten, dass Klara weiterhin mit ihren Freundinnen in die Realschule im Nachbarort gehen kann. Wegen ihrer Behinderung wurde sie in der Schule bisher in drei Stunden pro Woche von einer Sonderpädagogin unterstützt. Mit dieser Unterstützung kam sie bisher prima klar. Leider verschlechtert sich ihre Sehbehinderung jetzt immer mehr. Deshalb braucht sie in Zukunft mehr Unterstützung als bisher. Diese Unterstützung muss vom Schulamt und vom Sozialamt organisiert und finanziert werden.
Klara kommt zu Hause sehr gut klar und hat gute Freundinnen, die in der Nachbarschaft leben.
Frau und Herr Demirel sind unsicher, ob Klara in einem Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Schülerinnen und Schüler (Sonderschule) genauso gut unterrichtet wird wie in einer Realschule. Frau Demirel macht sich große Sorgen um Klaras Zukunft. Wie soll sie mit einem Sonderschulabschluss später mal einen guten Job bekommen?
Außerdem bricht es ihr als Mutter fast das Herz, dass sie ihre Tochter dann nur noch an den Wochenenden sehen würde.
Die Demirels möchten auch nicht, dass Klara nur noch als "das Kind mit einer Behinderung" gesehen wird. Denn Klara ist für sie einfach Klara – ein ganz normaler Mensch, der vieles schon gut kann und einiges noch lernen muss. Frau Demirel fragt sich auch, wie Klaras Großeltern, Tanten, Onkel und Kusinen auf einen Sonderschulbesuch reagieren würden. Es könnte sein, dass die Familie Klara dann anders behandelt. Bisher stand nie Klaras Behinderung im Vordergrund. Die Mutter wünscht sich, dass dies auch so bleibt.
Herr und Frau Demirel verstehen überhaupt nicht, wieso sie als Familie in dieser Situation so wenig Unterstützung bekommen. Vor allem Herr Demirel ist sauer. Sie haben sich immer um eine gute Nachbarschaft bemüht und sind in ihrem Ort und ihrer Gemeinde sehr aktiv.
Die Eltern möchten, dass Klaras Wunsch, weiterhin mit ihren Freundinnen in eine Schule zu gehen, unterstützt wird.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtet ihr, die Eltern von Klara?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was wünschen sich die Eltern Demirel für ihre Tochter?
- Was für einen Schulbesuch wünschen sich die Eltern?
- Welche Argumente haben sie für ihren Wunsch?
- Wer soll ihrer Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke sind nicht erlaubt.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Talkshow: Rollenkarte Klara Demirel
Rollenkarte: Klara Demirel
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle als Klara ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Klara Demirel, 12 Jahre alt
Klara geht gern schwimmen und mag Computerspiele. Sie lebt mit ihren Eltern in einem kleinen Dorf und geht im Nachbarort in die 6. Klasse einer Realschule.
Wegen einer Sehbehinderung kann Klara nur wenig sehen. Auch eine Brille hilft nicht weiter. Klara sieht die Welt ganz verschwommen - fast so, als würde man durch Milchglas schauen. Klar, dass sie in der Schule deswegen mehr Unterstützung als andere Kinder braucht. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen bei den Arbeitsblättern mehr auf die Farben und die Kontraste achten. Alles muss immer groß genug geschrieben werden. Im Klassenraum sollte es auch immer hell genug sein. Dann kann Klara dem Unterricht auch gut folgen.
Um sich an einem neuen Ort zurechtzufinden, braucht Klara immer erst einmal eine Assistenz. Das ist eine Person, die ihr ein paar Wochen lang zeigt, wie und wo alles ist. Auch für den Schulweg bekam sie am Anfang Hilfe. Diese Assistenzen werden auch Mobilitätstrainer genannt, denn sie unterstützten Klara dabei, mobil (beweglich) zu sein.
In der Schule braucht Klara Hilfsmittel. Es gibt Computer, die alles vergrößern können: Bücher, Arbeitsblätter und sogar das, was an der Tafel steht. Sie heißen Bildschirmlesegeräte. Damit kann Klara alles richtig gut lesen. Trotzdem kann es schon mal passieren, dass der Unterricht ein bisschen langsamer vorangeht, weil sie erst das Buch richtig ins Gerät einlegen muss oder manchmal in der Zeile verrutscht. Dann fragt sie eben nach. Fragen hat doch jeder, und im Kopfrechnen ist sie einfach spitze, viel schneller als die meisten anderen. Das Schreiben geht nicht so gut, da bringt Klara manchmal die Buchstaben durcheinander. Das hat sie mit ihrer Freundin Sarah gemeinsam. Schreiben ist nicht so ihr Ding.
Klara möchte genau das Gleiche machen wie ihre Freundinnen, die alles sehen können. Sie findet, sie ist ein als ganz normales Mädchen. Sie will in die gleiche Schule gehen wie ihre Freundinnen. Sie weiß gar nicht, was sie auf einer besonderen Schule weit weg von zu Hause soll. Sie findet, nicht ihre Behinderung oder sie sind das Problem, sondern diejenigen, die sie ärgern oder ihr nicht helfen. Sie braucht Unterstützung und Hilfsmittel und nicht Menschen, die ihr sagen wollen, was am Besten für sie ist. Denn sie ist 12 Jahre und weiß, was gut für sie ist.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du, Klara?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was wünscht sich Klara?
- Auf welche Schule möchte Klara gehen?
- Welche Argumente hat sie für ihren Wunsch?
- Wer soll ihrer Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Talkshow: Rollenkarte Schuldirektorin Frau Müller
Rollenkarte: Schuldirektorin Frau Müller
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle als Schuldirektorin ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Schuldirektorin Herta Müller
Frau Müller möchte, dass Klara in eine Klasse mit anderen sehbehinderten Kindern im 100 Kilometer entfernten Förderzentrum geht. Sie findet es zumutbar, dass Klara dort mit einem Bus hingefahren wird, die Woche über im Internat lebt und nur an den Wochenenden nach Hause kommt. Denn genau für solche Schülerinnen und Schüler wie Klara wurde das Förderzentrum eingerichtet. Dort sind die Klassen kleiner und auf die Behinderungen kann viel besser eingegangen werden. Für Klaras Förderung stehen dort schon die benötigten Geräte bereit, es gibt die richtigen Räume, mehr und speziell ausgebildetes Personal, zum Beispiel Sehbehindertenpädagoginnen und -pädagogen.
Frau Müller vermutet, dass Kinder mit Behinderungen in Förderzentren engere Freundschaften schließen. Schließlich haben alle ähnliche Probleme und verstehen sich dadurch gegenseitig besser. Niemand wird wegen einer Behinderung ausgegrenzt. Außerdem kann Klara am Förderzentrum dieselben Schulabschlüsse machen wie an einer Regelschule.
Frau Müller sieht nicht ein, warum sie für Klaras Unterstützung in ihrer Realschule so viel Geld auftreiben soll. Es ist ihrer Meinung nach viel zu teuer, in einer Regelschule alle Hindernisse zu entfernen, die Klara begegnen können. Ganz zu schweigen vom organisatorischen Aufwand. Wenn sie sich darum kümmern muss, hat sie für andere Sachen weniger Zeit und darunter leidet der Schulbetrieb. Auch die Anschaffung der technischen Geräte und deren Transport zwischen den einzelnen Klassenzimmern wären nur mit großem Aufwand zu organisieren. Eigentlich müsste Klaras Klasse fast immer im selben Raum Unterricht haben. Das wäre dann aber anders als bei allen anderen Klassen.
Herta Müller befürchtet auch, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft zu viel Arbeit mit Klara hätten. Die Klassen sind sehr groß, und in jeder Klasse gibt es Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemen. Wenn sich die Lehrerinnen und Lehrer viel um Klara kümmern müssten, hätten sie für die anderen Kinder weniger Zeit. Und eine Sonderpädagogin oder ein Schulhelfer im Unterricht könnten den Ablauf stören.
Die Direktorin kann zwar den Wunsch von Klara und ihren Eltern verstehen, sie besteht aber auf ihrer fachlichen und jahrelangen Erfahrung. Sie ist der Meinung, dass vor allem Eltern viel zu emotional reagieren und dann nicht mehr objektiv einschätzen können, was für ihre Kinder am besten ist. Die Eltern müssten endlich Klaras Behinderung akzeptieren. Frau Müller findet, Fachkräfte können besser entscheiden, welche Schule die richtige ist. Sie ist sich sicher, dass die Schulbehörde ihre Meinung unterstützt.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du als Schuldirektorin Herta Müller?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was wünscht sich Frau Müller für ihre Schule und für ihre Lehrerinnen und Lehrer?
- Was für einen Schulbesuch schlägt sie für Klara vor?
- Welche Argumente hat sie für ihren Vorschlag?
- Wer soll ihrer Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
- Spielt Geld für Frau Müllers Meinung eine Rolle? Wenn ja, inwiefern?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Talkshow: Rollenkarte Sozialamtsmitarbeiterin Jutta Meyer
Rollenkarte: Sozialamtsmitarbeiterin Jutta Meyer
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle von Jutta Meyer ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Jutta Meyer, Sozialamtsmitarbeiterin
Frau Meyer hat im Sozialamt immer viel Arbeit und ist genervt, dass ihr Chef sie heute zu der Talkshow geschickt hat. Es gäbe so viel Wichtigeres zu tun! Dafür muss sie dann wieder Überstunden machen.
Jutta Meyer findet, Klara sollte unbedingt ein Förderzentrum besuchen. Dort wäre Klara viel besser aufgehoben, daran besteht für sie überhaupt kein Zweifel. Medizinisch und pädagogisch geschultes Personal ist vor Ort und es gibt sehr viele Therapiemöglichkeiten. Alle Geräte sind vorhanden und die Räume sind barrierefrei. Ein Mobilitätstraining, wie es Klara für den Besuch der Regelschule bräuchte, wäre also gar nicht nötig.
Klara würde einfach montags mit dem Bus an der Haustür abgeholt und zum Förderzentrum gebracht. Dort hätte sie alles in einem: Schule und Internat. Den Bus und die Kosten für das Förderzentrum bezahlt das Schulamt in dem Ort, wo das Förderzentrum ist. So eine spezielle Unterstützung ist ja auch viel teurer. Frau Meyers Amt entstünden dafür keine Kosten. Allerdings müsste das Sozialamt Klaras Internatsplatz bezahlen.
Würde Klara hingegen weiter in die Regelschule gehen, dann würde die Genehmigung von Geldern für weitere technische Geräte oder für mehr Unterstützung durch eine Pädagogin oder einen Pädagogen auf jeden Fall eine Zeit lang dauern. Das Geld muss ja erst einmal aufgetrieben werden. Bisher wurde Klara drei Stunden pro Woche von einer Sonderpädagogin unterstützt. Weil sich ihre Sehbehinderung jetzt immer mehr verschlechtert, braucht sie in Zukunft mehr Unterstützung. Ob diese bewilligt werden würde, ist gar nicht sicher, denn die Gemeinde muss sparen.
Was Frau Meyer besonders nervt, sind Eltern, die allein entscheiden wollen, was das Beste für ihr Kind ist. Warum können sie nicht einfach mal der Meinung der Fachkräfte folgen?
Frau Meyer schließt sich der Meinung der Schulleiterin an, dass Klara in das Förderzentrum gehen sollte. Die Fachkräfte wissen schließlich am besten, was gut für die Kinder ist. Deshalb möchte sie auch auf jeden Fall noch die Meinung von dem Medizin-Experten Detlef Hase zu dem Ganzen hören.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du, die Sozialamtsmitarbeiterin Jutta Meyer?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was für einen Schulbesuch schlägt sie für Klara vor?
- Welche Argumente hat sie für ihren Vorschlag?
- Wer soll ihrer Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
- Spielt Geld für in der Argumentation von Frau Meyer eine Rolle? Wenn ja, inwiefern?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Talkshow: Rollenkarte Lehrerin Andrea Schmitt
Rollenkarte: Lehrerin Andrea Schmitt
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle der Lehrerin ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Andrea Schmitt, Lehrerin von Klara
Frau Schmitt war am Anfang etwas skeptisch, Klara in ihre Klasse aufzunehmen. Schließlich hat sie 28 Schülerinnen und Schüler, die alle unterschiedlich sind. Außerdem wurde sie nicht gut auf Klara und ihren besonderen Unterstützungsbedarf vorbereitet. Als Lehrerin an einer Regelschule wurde sie einfach ins kalte Wasser geworfen und fühlte sich allein gelassen. Denn in der üblichen Lehrerausbildung wird man nicht im Umgang mit Kindern mit Behinderungen geschult. Deshalb kann sie andere Lehrerinnen und Lehrer verstehen, wenn sie Klara nicht in ihrer Klasse haben wollen oder nicht wissen, wie sie Klara unterrichten sollen. Aber Frau Schmitt findet auch, dass es eine moralische Verpflichtung gibt, sich für die Interessen aller Schülerinnen und Schüler einzusetzen.
Inzwischen findet Frau Schmitt es für sich selbst, für die Klasse und auch für die gesamte Schule einfach toll, dass Klara da ist. Die Unsicherheiten vom Anfang sind verschwunden und alle wissen, was Klara braucht. Und Klara weiß auch, dass die anderen etwas von ihr brauchen: deutliche Ansagen zum Beispiel, was ihr beim Lernen hilft und was nicht. Außerdem sind viele Schülerinnen und Schüler sensibler im Umgang mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern geworden. Es ist für alle viel einfacher geworden zu sagen, dass man etwas noch nicht so gut kann, und nach Hilfe zu fragen.
Frau Schmitt wird zurzeit in drei Stunden pro Woche von einer Sonderpädagogin unterstützt. Die hilft ihr bei der Vorbereitung von speziellen Aufgaben und Materialien für Klara oder übt mit Klara zum Beispiel das Lesen am Bildschirmlesegerät.
Frau Schmitt unterrichtet Klara in Mathe und Deutsch. In Mathe ist Klara ein großes Talent. Klara kann dort natürlich die gleichen Arbeitsblätter wie die anderen verwenden, nur größer kopiert. In Deutsch ist Klara nicht so gut. Sie hat Schwierigkeiten in Rechtschreibung und Grammatik. Das Lesen fällt ihr trotz der technischen Geräte zur Unterstützung schwer. Außerdem ist Klaras Verhalten manchmal ganz schön schwierig. Sie passt im Unterricht oft nicht richtig auf und redet zuviel mit Sarah, einer Freundin.
Frau Schmitt findet, dass Klara zukünftig auf jeden Fall mehr Unterstützung in der Schule braucht – zum Beispiel einen Schulhelfer oder eine Assistenz. Denn Klara kann immer schlechter sehen. Das Sozialamt hat vorgeschlagen, dass Mitschülerinnen und Mitschüler die Unterstützung von Klara übernehmen können. Aus pädagogischer Sicht kann Andrea Schmitt das aber nicht befürworten. Eine solche Unterstützung bedeutet zu viel Verantwortung für 12-jährige Kinder. Denn die sollen ja erstmal noch Kinder bleiben dürfen.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du, die Lehrerin Andrea Schmitt?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was für einen Schulbesuch schlägt sie für Klara vor?
- Welche Argumente hat sie für ihren Vorschlag?
- Wer soll ihrer Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Talkshow: Rollenkarte Mitschülerinnen Sarah und Yasemin
Rollenkarte: Mitschülerinnen Sarah und Yasemin
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle von Klaras Mitschülerinnen ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Sarah und Yasemin, Mitschülerinnen von Klara
Sarah und Yasemin hatten am Anfang irgendwie ein komisches Verhältnis zu Klara. Sie wussten nicht so genau, wie sie mit ihr umgehen sollen. Aber bald hat sich herausgestellt, dass Klara eigentlich sehr cool ist. Allein schon, wie sie mit ihrer Behinderung umgeht. Sie nimmt das meistens locker und ist auch nicht böse auf die Welt.
Sarah und Yasemin müssen Klara schon öfter mal helfen, weil sie etwas nicht lesen kann oder nicht mitkommt. Klara sitzt deshalb in der Mitte zwischen ihnen. So können sie beide aufpassen, ob Klara mitkommt. Das ist manchmal anstrengend. Manchmal sind die drei so miteinander beschäftigt, dass sie alle den Anschluss verpassen.
Klara versteht das Meiste sehr schnell und wenn sie zusammen Hausaufgaben machen, erklärt sie ihnen Mathe. In Deutsch braucht Klara öfter mal mehr Hilfe. Dann gibt es auch manchmal Stress, weil Klara sich über ihre Schwierigkeiten in Deutsch ärgert.
Manche von den Jungs verspotten Klara ab und zu. Das finden Sarah und Yasemin ganz schön gemein. Klara geht aber ganz gut damit um. Die meisten Jungs haben deswegen schon das Interesse am Spotten verloren. Irgendwie gehört Klara für die meisten in der Klasse und in der Schule mittlerweile ganz normal dazu. Das ist ganz anders als am Anfang.
Dass Klara in Zukunft in ein Förderzentrum gehen soll, finden Sarah und Yasemin „voll daneben“. Denn dann gäbe es ja keine gemeinsamen Hausaufgaben mehr und kein Quatschen. Und sie könnten sich nur noch am Wochenende treffen. Außerdem hat Klara da keine Freundinnen. Wer weiß, wer da so hingeht, in dieses Förderzentrum. Im Unterricht könnten sie beide Klara doch einfach genauso helfen wie bisher. Oder noch ein bisschen mehr, wenn Klara jetzt noch schlechter sehen kann.
Klaras Freundinnen meinen, dass dieser ganze Wirbel mit Angst zu tun hat. So wie sie am Anfang Angst vor Klara hatten, haben das andere Menschen wahrscheinlich auch. Menschen mit einer Behinderung sieht man sonst ja nie. Wo sind die eigentlich, es gibt doch nicht nur Klara, oder? Sie wünschen sich, dass die Schule weniger Angst hat und Klara bleiben darf. Sarah und Yasemin verstehen auch gar nicht, warum Klaras Wunsch nicht gehört wird. Mit 12 ist man doch nicht "klein" oder "dumm". Man kann schon ganz gut für sich selbst entscheiden.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtet ihr, Sarah und Yasemin?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was wünscht sich Klara?
- Was für einen Schulbesuch schlagen Sarah und Yasemin vor?
- Welche Argumente haben sie für ihren Vorschlag?
- Wer soll ihrer Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Talkshow: Rollenkarte Mitarbeiter medizinischer Fachdienst, Detlef Hase
Rollenkarte: Mitarbeiter medizinischer Fachdienst, Detlef Hase
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle als Detlef Hase ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Detlef Hase, Medizinischer Fachdienst (Experte 1)
Detlef Hase ist der Ansicht, dass Mediziner und Medizinerinnen am besten entscheiden können, was gut für einen Menschen mit einer Behinderung ist und was nicht. Schließlich sei eine Behinderung ein medizinisches Problem. Wenn jemand eine Behinderung hat, muss man sich um ihn oder sie kümmern und für ihn oder sie die offensichtlich richtigen Entscheidungen treffen. Man muss auf die Person aufpassen und sich um sie sorgen. Dass ein Mensch mit Behinderung, in diesem Fall Klara, eine kleine Schrift nicht lesen kann, liegt ja nicht an der Schrift, sondern an Klara und ihrem Defizit. Oder dass ein Rollstuhlfahrer nicht in ein Haus mit Treppen kommt, liegt ja nicht an den Treppen. Detlef Hase meint: "Man kann ja nicht die ganze Welt für Menschen mit Behinderungen umbauen!"
Als Experte denkt Herr Hase auch an das große Ganze, also das Wohl der "normalen" Leute. Bevor man für Millionen Euro jedes Haus und jede Situation anpasst, sollte man lieber einige Spezialhäuser bauen – zum Beispiel Kliniken und spezielle Schulen. Die sind dann ohne Treppen und nutzen große Schrift – also bestens geeignet für Menschen mit Behinderungen. Seiner Meinung nach sollte Klara deshalb in das Förderzentrum gehen. Detlef Hase teilt die Meinung der Schuldirektorin und des Sozialamts.
Als Mediziner schaut er nach Anhaltspunkten, ob bei Klara eine Behinderung vorliegt. Das steht so im Gesetz. Das Gesetz legt fest, ob ein Mensch behindert ist oder nicht. Eine Behinderung ist ein persönliches körperliches oder seelisches Problem. So steht es im Sozialgesetzbuch und auch im Behindertengleichstellungsgesetz. Je nachdem, wie schwer jemand behindert ist, bekommt er oder sie bestimmte Leistungen vom Staat. Meistens sind das sogenannte Sachleistungen. Zum Beispiel Geld für einen speziellen Kinderwagen, für eine Frühförderung oder für einen Heimplatz beziehungsweise für den Besuch eines Förderzentrums. Im Fall von Klara wären die folgenden Sachleistungen notwendig:
- die Schulbehörde bezahlt den Schulplatz im Förderzentrum,
- das Sozialamt bezahlt den Internatsplatz (Übernachtung, Verpflegung, Betreuung).
Hintergrundinformation
Wenn eine Behinderung als rein medizinisches Problem betrachtet wird, ist sie vor allem eine krankhafte Störung. Nicht die Menschen mit Behinderung selbst, sondern Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger oder Eltern sagen dann, was gut für sie ist. Weil Behinderung in dieser Sichtweise eine Krankheit ist, werden Menschen mit Behinderungen bemitleidet und als nicht vollständig gesehen. Denn ihnen fehlt ja etwas: ein Arm, ein Bein, die Fähigkeit zu laufen, zu sehen oder eigene Entscheidungen treffen zu können. Deshalb werden Behinderte auch häufig nicht so ernst genommen.
Ausschnitt aus dem Behindertengleichstellungsgesetz
Als Unterstützung für seine Argumente kann Detlef Hase einen Ausschnitt aus dem Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 vorlesen:
"Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist." (1)
Aus medizinischer Sicht ist Klara also eindeutig behindert. Sie wird ihr Leben lang Probleme mit dem Sehen haben und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwann gar nichts mehr sehen kann, also blind ist. Ihr Leben in der Gesellschaft ist dadurch beeinträchtigt.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du, Detlef Hase, Mitarbeiter des Medizinischen Fachdienstes?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was für einen Schulbesuch schlägt Detlef Hase für Klara vor?
- Welche Argumente hat er für seinen Vorschlag?
- Wer soll seiner Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
- Wie beschreibt Herr Hase "Behinderung"?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig
Quelle:
(1) §3 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG)
Talkshow: Rollenkarte Erzieherin mit spezieller Ausbildung, Ella Sanchez
Rollenkarte: Erzieherin mit spezieller Ausbildung, Ella Sanchez
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle als Erzieherin ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Ella Sanchez, Erzieherin mit einer speziellen Ausbildung zur Unterstützung von Kindern mit Behinderungen (Expertin 2)
Aus pädagogischer Sicht vertritt Frau Sanchez die Meinung, dass Fragen rund um das Thema Behinderung nicht so einfach zu beantworten sind. Erst einmal sind alle Menschen verschieden. Jeder Mensch entwickelt sich in seinem Leben anders als andere. Das betrifft seine oder ihre Interessen, aber auch das, was er oder sie gut kann.
Ella Sanchez hat eine klare Gegenposition zu Detlef Hase. Denn sie findet, er denkt rein medizinisch und sieht nur, was ein Mensch nicht kann. Aus ihrer Sicht gibt es keine "normalen", sondern nur ganz unterschiedliche Menschen. Häufig fordert Frau Sanchez alle Anwesenden auf, einmal darüber nachzudenken, wie viele unterschiedliche Menschen gerade im Raum sind. Für sie steht fest, dass Klara weiter in eine Regelschule und nicht in das Förderzentrum gehen sollte. Es sollte einfach so bleiben wie bisher, denn allen Beteiligten gehe es doch gut damit. Vor allem soll Klara selbst entscheiden, was gut für sie ist. Sie weist auf die Kinderrechtskonvention hin, in der eindeutig festgehalten ist, dass jedes Kind seine Meinung äußern darf und ihr auch Gehör geschenkt werden muss.
Für den Besuch der Schule sollte Klara ihrer Meinung nach zukünftig mehr Unterstützung bekommen. Die unterstützende Person soll ihr bei dem helfen, was sie noch nicht kann oder was sie nicht können wird.
Ella Sanchez findet es schade, dass sich Kinder überhaupt für eine Schule entscheiden müssen. Es sollte ihrer Ansicht nach nicht verschiedene Schulen, sondern nur eine Schule für alle Kinder geben.
Sie sagt, es gibt gar kein "behindert sein", sondern nur "behindert werden". Ihrer Meinung nach behindern die Umwelt oder die Gesellschaft einen Menschen. Die Gesellschaft errichtet Barrieren, wie zum Beispiel Treppen, Gehsteige, Busse oder Züge, in die man nicht so einfach rein kommt, oder verwendet zu kleine Schrift oder zu schwere Sprache. Weil es solche Barrieren gibt, können nicht alle Menschen überall mitmachen. Genau das passiert jetzt auch bei Klara. Man versucht, sie aus dem "normalen Leben" rauszuschubsen, weil sie nicht in das Konzept der "normalen" Schule passt. Stattdessen könnte man doch auch die Schule verändern! Ella Sanchez ist für Inklusion. Das bedeutet: Alle Menschen werden einbezogen, alle sind gleichermaßen willkommen. Sie findet, die Menschen müssen umdenken: Wir brauchen eine Schule für alle mit den Räumen und Hilfsmitteln, die nötig sind, damit alle gut lernen können.
Hintergrundinformation
Nicht nur Frau Sanchez sagt, dass die Umwelt oder die Gesellschaft einen Menschen behindern. Es gibt auch eine Wissenschaft die das so sieht, sie heißt "Disabilitiy Studies". Diese Wissenschaft geht davon aus, dass Behinderung von außen gemacht wird und nur teilweise "von innen" kommt. Die Disability Studies fragen, wie genau dieses "von außen behindern" geht.
Zum Beispiel:
- Wer entscheidet eigentlich darüber, wer behindert ist und wer nicht?
- Warum können es sich nicht behinderte Architektinnen und Architekten erlauben, nur Treppen und keine Rampen zu bauen?
- Warum wird in Schulen nicht in Gebärdensprache oder Leichter Sprache unterrichtet?
- Warum gibt es im Fernsehen, Theater und Museum nur so selten einen Kommentar, der für blinde Menschen eingesprochen wird, damit auch sie dem Film, dem Theaterstück folgen oder die Ausstellung erleben können?
- Warum werden Schulbücher nur in kleiner Schrift gedruckt?
- Warum müssen Kinder mit einer Behinderung auf eine besondere Schule gehen und alle anderen nicht?
Ausschnitt aus dem "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen"
Als Unterstützung für ihre Argumente kann Ella Sanchez einen Ausschnitt aus dem "Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" und aus dem "Übereinkommen über die Rechte des Kindes" vorlesen. Die Bundesrepublik Deutschland hat diese internationalen Gesetzestexte unterschrieben und muss sie auch umsetzen.
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Präambel
"Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens – (…)
e) in der Erkenntnis, dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen und wirksamen Teilhabe auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen an der Gesellschaft hindern, (…) haben Folgendes vereinbart: (…)" (2)
Übereinkommen über die Rechte des Kindes
Artikel 12 Berücksichtigung des Kindeswillens
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du, Ella Sanchez, als Erzieherin mit einer speziellen Ausbildung?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was für einen Schulbesuch schlägt sie für Klara vor?
- Welche Argumente hat sie für ihren Vorschlag?
- Wer soll ihrer Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
- Wie beschreibt Frau Sanchez "Behinderung"?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Quelle:
(2) Netzwerk Artikel 3, Übersetzung: Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Talkshow: Rollenkarte Erwin Wiese, Experte in eigener Sache
Rollenkarte: Erwin Wiese, Experte in eigener Sache
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle als Mensch mit Behinderung ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Erwin Wiese, Experte in eigener Sache (Experte 3)
Als Mensch mit einer Behinderung findet es Herr Wiese eine Frechheit, dass überhaupt jemand daher kommen kann und sagen will, was für Menschen mit Behinderungen gut ist und was nicht. Das wissen die Menschen mit Behinderung - und so auch Klara - ja wohl selbst am besten. Auch Kinder können schon ganz genau sagen, was sie möchten. Nur weil Klara schlecht sehen kann, heißt das noch lange nicht, dass sie schlecht denken oder nicht für sich sprechen kann. Für Erwin Wiese gilt immer das Motto aus der Behindertenselbsthilfe-Bewegung: "Nichts über uns ohne uns." Menschen mit Behinderungen wissen ganz genau, was sie brauchen und können das auch äußern.
Menschen mit Behinderungen werden seit Jahrhunderten diskriminiert, weggesperrt oder sogar getötet. Sie denken auch seit Jahrhunderten, es sei ihre Schuld, wenn sie nicht ernst genommen werden. Aber das stimmt nicht – sie werden von ihrer Umwelt, von den Menschen um sie herum nicht ernst genommen, durch die Bauweise von Gebäuden behindert und von Veranstaltungen ausgeschlossen. Erwin Wiese ist deshalb auch ganz und gar nicht mit der medizinischen Sicht auf Behinderung einverstanden.
Herr Wiese hat selbst eine Assistenz, also eine Person, die ihn unterstützt. Sie kommt für ein paar Stunden in der Woche zu ihm und mit ihr kann er voll am Leben teilhaben und alles selbst bestimmen. Erwin Wiese wäre froh gewesen, wenn er als Kind auch schon eine solche Unterstützung gehabt hätte. Dann hätte er mit den Kindern aus der Nachbarschaft in die Schule gehen können. Stattdessen musste er in eine Sonderschule gehen. Und er musste auch dort übernachten, weil die Schule zu weit weg war von zu Hause. Nur an den Wochenenden nach Hause zu kommen, war nicht schön.
Die Behinderung von Erwin Wiese heißt Muskeldystrophie oder auch Muskelschwund. Die Muskeln im ganzen Körper werden immer schwächer. Deswegen braucht er einen Rollstuhl und findet es oft auch schwierig, mit Schmerzen oder ständigen Veränderungen seiner Situation umzugehen. Seiner Meinung nach sollten die Menschen und die Gebäude um ihn herum ihn nicht noch zusätzlich behindern.
Ausschnitt aus dem Sozialgesetzbuch
Als Unterstützung für seine Argumente kann Herr Wiese einen Ausschnitt aus dem Sozialgesetzbuch vorlesen:
"Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen." (3)
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du, Erwin Wiese, als Mensch mit Behinderung?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was für einen Schulbesuch schlägt er für Klara vor?
- Welche Argumente hat er für seinen Vorschlag?
- Wer soll seiner Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
- Wie beschreibt Erwin Wiese "Behinderung"?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Quelle:
(3) Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation & Teilhabe behinderter Menschen - Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBI. | S. 1046, zuletzt geändert durch Artikel 8 Abs 2 des Gesetzes vom 18.12.2007 (BGBI. | S. 2984)
Talkshow: Rollenkarte Experte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Dr. Hans-Peter Wagenknecht
Rollenkarte: Experte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Dr. Hans-Peter Wagenknecht
Vorbereitung
Lest eure Rollenkarte und erarbeitet euch eure Rolle. Dazu habt ihr 15 Minuten Zeit.
In dieser Zeit sollt ihr auch eine Sprecherin oder einen Sprecher wählen. Diese Person nimmt später in der Talkshow die Rolle als Experte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Alle anderen spielen das Publikum.
Das Ziel für die Arbeit in eurer Kleingruppe ist:
- die Einarbeitung in die Rolle: Wer sind wir?
- die Einarbeitung in die Situation: Worum geht es eigentlich?
- die Ausarbeitung einer Strategie: Was wollen wir und wie bekommen wir das argumentativ hin?
- das Formulieren eines kurzen Eingangsstatements: Wie sagen wir das, was wir wollen, damit es überzeugend und gut verständlich ist?
Ein Tipp: Die Rolle ist unten nur sehr kurz beschrieben. Ihr dürft sie mit persönlichen Details, eigenen Beispielen zu den Argumenten oder Erfahrungen ausschmücken. Es darf also erfunden werden, aber ihr sollt nur solche Dinge ergänzen, die glaubwürdig sind und die den Standpunkt der Person nicht grundsätzlich verändern.
Nach den 15 Minuten Vorbereitungszeit in der Kleingruppe versammeln sich alle Sprecherinnen und Sprecher um einen Tisch. Die anderen der Gruppe bilden das Publikum. Jeder Sprecher, jede Sprecherin hat zwei Minuten Zeit, um seine oder ihre Position deutlich zu machen. Danach können alle Talkshow-Gäste miteinander diskutieren. Diese Diskussion dauert ungefähr 20 Minuten.
Nach der Talkshow werten alle gemeinsam die Diskussion aus, dabei ist auch das Publikum gefragt. Die Auswertung wird vom Organisationsteam geleitet. Es berichtet zu Beginn, was es gesehen und gehört hat:
- Welche Formen des Schulbesuchs wurden vorgeschlagen?
- Mit welchen Argumenten wurden die Vorschläge begründet?
Eure Rolle: Dr. Hans-Peter Wagenknecht, Experte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Experte 4)
Dr. Hans-Peter Wagenknecht ist ein Experte auf dem Gebiet der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Er will deutlich machen, dass es überhaupt nicht darum geht
- was eine Behinderung ist oder keine,
- was ein Mensch mit Behinderungen kann oder nicht kann,
- was ein Mensch ohne Behinderung kann oder nicht kann.
Ihm geht es darum, dass jeder Mensch eine Bereicherung für die Gesellschaft ist. Menschen mit Behinderungen leisten jeden Tag einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Jeder lernt von jedem, ganz egal wie der andere ist. Niemand darf wegen einer Behinderung benachteiligt werden.
Hans-Peter Wagenknecht findet gut, was die Mitschülerinnen von Klara sagen. Denn die finden es toll, mit Klara in der gleichen Klasse zu sein. Sie sagen auch, dass so alle viel voneinander und auch besser lernen. Seiner Meinung nach sollte es nur eine Schule für alle geben. Dann müsste man nämlich gar nicht überlegen, in welche Schule Klara gehen soll. Das Bildungssystem soll nicht diskriminieren, sondern allen die gleichen Chancen bieten. Die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen sollen gefördert werden. Sie sollen ihre Kreativität ausleben dürfen. Schulen, aber auch andere Bildungseinrichtungen wie Kindergärten oder Ausbildungsstätten, sollen Unterschiede positiv vermitteln und durch ihre Arbeit die Vielfalt von Menschen anerkennen und unterstützen.
Die menschliche Würde von Klara muss geschützt werden. Das geschieht, indem man Klara ernst nimmt und ihr zuhört, sagt Herr Wagenknecht.
Ausschnitt aus der "Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen"
Zur Unterstützung für seine Argumente kann Hans-Peter Wagenknecht einen Ausschnitt aus dem Grundgesetz und aus der "Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" vorlesen:
Grundgesetz:
"Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." (4)
Präambel der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens -
m) in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können, und in der Erkenntnis, dass die Förderung des vollen Genusses der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Menschen mit Behinderungen sowie ihrer uneingeschränkten Teilhabe ihr Zugehörigkeitsgefühl verstärken und zu erheblichen Fortschritten in der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft und bei der Beseitigung der Armut führen wird, (…).
haben Folgendes vereinbart (…)
Euer Auftrag:
Lest den Text und arbeitet euch in die Rolle ein. Was möchtest du, Hans-Peter Wagenknecht, als Experte für die Rechte von Menschen mit Behinderungen?
Formuliert ein kurzes Eingangsstatement. Dabei helfen euch folgende Fragen:
- Was für einen Schulbesuch schlägt er für Klara vor?
- Welche Argumente hat er für seinen Vorschlag?
- Wer soll seiner Meinung nach die Entscheidung über den Schulbesuch treffen?
- Wie beschreibt Herr Wagenknecht "Behinderung"?
Diskussionsregeln
Haltet euch während der Talkshow an diese Diskussionsregeln:
- Alle Diskussionsteilnehmenden dürfen ausreden.
- Beleidigungen und diskriminierende Ausdrücke werden vermieden.
- Fasse dich kurz. Schweife nicht ab und wiederhole dich nicht unnötig.
Quelle:
(4) Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland: Abs. 2 Satz 2 & Abs. 3 Satz 2 angefügt durch das Gesetz vom 27.10.1995
Persönliche Zukunftsplanung: Inklusion als Menschenrecht
Inklusion als Menschenrecht – Zukunftsplanung als Weg
von Stefan Doose
Was bedeutet Inklusion?
Der im deutschsprachigen Raum relativ junge Begriff Inklusion bedeutet, dass alle Menschen überall dabei sein dürfen und teilhaben können. Niemand wird ausgegrenzt, weil er oder sie anders ist, zum Beispiel eine Behinderung, einen anderen Glauben oder eine andere Muttersprache hat. Im Gegenteil: Vielfalt ist willkommen und wird wertgeschätzt.
Für Kinder mit Behinderungen bedeutet dies, in den regulären Kindergarten und die Schule vor Ort gehen zu können, mit anderen Kindern in der Freizeit zu spielen, ins öffentliche Schwimmbad gehen zu können oder im Sportverein mitzumachen. Damit dies möglich ist, müssen Barrieren abgebaut werden und muss individuelle Unterstützung zur Verfügung stehen. Dies ist in Deutschland bislang leider noch nicht überall der Fall.
Dem Konzept der Inklusion ging das der Integration voraus. Personen mit hohem Unterstützungsbedarf sollten in die Gesellschaft eingegliedert werden, indem sie in Sondereinrichtungen ausgegliedert und spezielle Maßnahmen ergriffen wurden. So steht ein ausdifferenziertes System von Sonderkindergärten, Sonderschulen, Werkstätten, Wohnheimen und Freizeitclubs für Menschen mit Behinderungen bereit, die die Integration ermöglichen sollen. In der Regel zieht die erste Ausgliederung in eine Sondereinrichtung die nächste Sonderbehandlung nach sich - erst im Kindergarten, dann in der Schule, dann im Arbeits-, Freizeit- und Wohnbereich.
Inklusion ist weitreichender als Integration. Es geht dabei nicht nur um die (Wieder-) Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, mit Migrationshintergrund oder zum Beispiel mit einer anderen Religion. Es geht darum, dass alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit gleichberechtigt teilhaben können und dass Menschen nicht ausgegrenzt werden, weil sie anders sind oder es als zu schwierig erscheint, sie gut zu unterstützen. Damit Inklusion möglich wird, müssen sich die Kultur und die Praxis in vielen unserer regulären Einrichtungen und Organisationen noch ändern. Zum Beispiel müssen Gebäude dafür rollstuhlgerecht sein.
Es gibt mit dem Index für Inklusion sowohl für Kindertageseinrichtungen als auch für Schulen eine Anregung, wie so ein Prozess gestaltet werden kann.
Die Kenntnis der Menschenrechte und der einschlägigen Gesetze kann dabei helfen, Inklusion einzufordern oder sogar einzuklagen.
Persönliche Zukunftsplanung kann dabei helfen, die Teilhabe eines Kindes in wichtigen Lebensbereichen zu organisieren und zu verwirklichen.
Alle Menschen haben Menschenrechte
Alle Menschen haben die gleichen Menschenrechte. In der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 in 30 Artikeln erstmals universell zahlreiche Menschenrechte mit einer unverbindlichen Resolution anerkannt. So das Recht jedes Menschen auf Leben, Freiheit und Sicherheit seiner Person, das Recht auf Bildung, Arbeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. In den folgenden Jahrzehnten haben die Vereinten Nationen Menschenrechte in verschiedenen sogenannten Konventionen (Übereinkommen, Pakten) weiterentwickelt. Ganz wesentlich waren dabei der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966. In den folgenden Jahren wurden diese Rechte für bestimmte Zielgruppen weiter konkretisiert, so gibt es beispielsweise die UN-Kinderrechtskonvention oder das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die Übereinkommen werden jeweils nach der Ratifikation durch einen Staat für diesen verbindlich.
Das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz
Menschenrechte finden sich auch in Verfassungen wieder, zum Beispiel in Artikel 3 unseres Grundgesetzes.
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner „Rasse“, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Artikel 3, Absatz 3, Grundgesetz)
Wussten Sie übrigens, dass das Benachteiligungsverbot von Menschen mit Behinderungen erst am 15. November 1994 mit der neuen Verfassung für das geeinte Deutschland in Kraft trat? Es kennzeichnet für Deutschland den Beginn einer neuen Sichtweise: Behinderung wird nicht mehr hauptsächlich als ein medizinisches Problem der betroffenen Person gesehen, die behandelt werden muss und unserer Fürsorge bedarf. Der gesellschaftliche Umgang mit Behinderung wird nun als eine Bürgerrechtsfrage begriffen. So ist die Ursache dafür, dass ein Kind im Rollstuhl nicht in den örtlichen Kindergarten rollen oder mit dem Schulbus fahren kann, nicht die Beeinträchtigung des Kindes, nicht laufen zu können, sondern die Tatsache, dass öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen oder Busse nicht für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind.
Gesetze für Chancengleichheit
In den letzten Jahren wurden in Deutschland einige neue Gesetze verabschiedet, die Menschen mit Behinderungen vor Benachteiligungen schützen sollen:
Seit dem Jahr 2002 gibt es auf Bundesebene das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (Behindertengleichstellungsgesetz, BGG) und in Folge Landesgleichstellungsgesetze. Die Gleichstellungsgesetze konkretisieren das Benachteiligungsverbot des Grundgesetzes auf Bundes- bzw. Landesebene. Sie sind bindend für die öffentliche Verwaltung und definieren zum Beispiel „Behinderung“ und „Barrierefreiheit“. Im Behindertengleichstellungsgesetz wurde zudem Gebärdensprache als offizielle Verkehrssprache anerkannt.
Auch das 2001 in Kraft getretene Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen setzt einen klaren Schwerpunkt auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Darin sind beispielsweise das Wunsch- und Wahlrecht bezüglich der Art der Erbringung von Leistungen oder das Recht auf ein Persönliches Budget vorgesehen.
Im August 2006 trat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft, das nun auch im Bereich des Zivil- und Arbeitsrechts verbietet, Menschen aufgrund des Geschlechts, der „Rasse“, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung zu benachteiligen. Dies ist beispielsweise bedeutend beim Abschluss von Verträgen, wie Mietverträgen oder Versicherungen, sowie bei Einstellungen.
Kinder haben Kinderrechte
Die eigenständigen Rechte von Kindern sind weltweit immer wieder in Gefahr. Deshalb gibt es seit dem 20. November 1989 das „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ (UN-Kinderrechtskonvention), das in Deutschland am 5. April 1992 in Kraft getreten ist. Kinderrechte sind Menschenrechte, die auf die besondere Situation von Kindern hin ausformuliert wurden.
Kinder haben nach der UN-Kinderrechtskonvention unter anderem das Recht auf Schutz vor Diskriminierung (Art. 2), das Recht auf Wohlergehen (Art. 3), Leben und Entwicklung (Art. 6), Achtung ihrer Meinung (Art. 12), Privatsphäre und Schutz der Ehre und des Rufes (Art. 16), Schutz vor jeder Form von Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung (Art. 19), Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft trotz Behinderung (Art. 23), Bildung (Art. 28) und Freizeit, Spiel und Kultur (Art. 31).
Auf der Website des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finden Sie die Publikation „Die Rechte der Kinder von logo! einfach erklärt“, sie beinhaltet die UN-Kinderrechtskonvention in einfache Sprache übersetzt.
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Am 13. Dezember 2006 wurde nach langjähriger Vorarbeit das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) in der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Das Übereinkommen konkretisiert die Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen und vor dem Hintergrund ihrer besonderen Lebenslagen. Es ist für Deutschland seit dem 26. März 2009 rechtlich verbindlich.
Die UN-Konvention enthält viele fortschrittliche Regelungen und Rechte für Menschen mit Behinderungen. Von besonderer Bedeutung sind zum Beispiel Artikel 24, der das Recht auf inklusive Bildung auf allen Ebenen beinhaltet - von der Krippe über die Schule bis zur Volkshochschule -, oder Artikel 19, der das Recht auf verschiedene gemeindenahe Dienstleistungen einschließlich persönlicher Assistenz enthält. Menschen mit Behinderungen dürfen selbst entscheiden, wo und mit wem sie leben wollen und sind nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben. Die UN-Konvention beinhaltet aber auch den Arbeitsauftrag an den Gesetzgeber, an Gemeinden und Einrichtungen, dafür zu sorgen, dass zukünftig Menschen mit Behinderungen inklusiv am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können, ohne Barrieren.
Was haben Inklusion und Menschenrechte mit Persönlicher Zukunftsplanung zu tun?
Persönliche Zukunftsplanung ist ein wertegeleiteter Ansatz. Es geht darum, Inklusion und die Menschenrechte konkret mit einzelnen Menschen umzusetzen. Mehr über Persönliche Zukunftsplanung erfahren Sie unter "Personenzentriertes Denken und Persönliche Zukunftsplanung - Grundlagen und Grundgedanken".
Eine gesellschaftliche Veränderung hin zur Inklusion kann nur gelingen, wenn viele Menschen vor Ort beginnen, eine neue Praxis zu leben. Persönliche Zukunftsplanung kann eine Möglichkeit sein, für ein Kind eine gute Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Ein Zitat der US-amerikanischen Menschenrechtsaktivistin Eleanor Roosevelt beschreibt diesen Zusammenhang sehr eindrücklich:
"Und letztendlich kommt es doch immer auf dasselbe an, wenn wir über Menschenrechte sprechen. Es geht um die Plätze nah am Haus. So nah und so klein, dass sie auf keiner Weltkarte wiederzufinden sind. Doch ist genau dies die Welt eines jeden Individuums; die Nachbarschaft, in der wir wohnen; die Schule, in die wir gehen; die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, wo wir arbeiten. Das ist der Ort, wo jeder Mann, jede Frau oder jedes Kind die gleichen Rechte sucht, gleiche Chancen, Gleichbehandlung ohne Diskriminierung. Wenn diese Rechte dort nichts bedeuten, dann bedeuten sie auch anderswo nichts. Ohne gezieltes Handeln von jedem, der sich dem verbunden fühlt, dies im Nahbereich zu verwirklichen, hat es wenig Sinn, nach einem derartigen Fortschritt für den Rest der Welt zu streben."
Eleanor Roosevelt (zitiert nach Doose 2011, 12)
Vertiefende Literatur zum Thema Inklusion als Menschenrecht:
Timm Albers (2011): Mittendrin statt nur dabei. Inklusion in Kindergarten und Krippe. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Heiner Bielefeldt (2009): Zum Innovationspotenzial der UN-Behindertenrechtskonvention (PDF, 131 KB, nicht barrierefrei) Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2008): Die Rechte der Kinder von logo! einfach erklärt. 8. geänderte Auflage Berlin.
Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (2011): alle inklusive! Die neue UN-Konvention. Übereinkommen der Rechte von Menschen mit Behinderungen (PDF, 11 MB, nicht barrierefrei) In Deutsch, Deutsch – Schattenübersetzung, Englisch und Leichter Sprache. Berlin.
Tony Booth, Mel Ainscow & Denise Kingston (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln (PDF, 733 KB, nicht barrierefrei) Halle: Martin-Luther-Universität.
Tony Booth, Mel Ainscow & Denise Kingston (2006): Index für Inklusion (Tageseinrichtungen für Kinder). Lernen, Partizipation und Spiel in einer inklusiven Kindertageseinrichtung entwickeln (PDF, 543 KB, nicht barrierefrei) Frankfurt: GEW.
Tony Booth (2011): Wie sollen wir zusammen leben? Inklusion als wertebezogener Rahmen für die pädagogische Praxis. Frankfurt: GEW.
Stefan Doose (2011): „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen. Broschüre mit Materialienteil. 9. überarbeitete Auflage Kassel: Mensch zuerst. Der einführende Textteil (80 S.) ist verfügbar auf der Website „Persönliche Zukunftsplanung“ (PDF, 97 KB).
Hendrik Cremer (2010): Recht auf Bildung für alle Kinder (PDF, 793 KB) In Leichter Sprache. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte.
Jo Jerg, Werner Schumann, Stephan Thalheim (2011): Vielfalt entdecken. Erfahrungen mit dem Index für Inklusion in Kindertagesstätte und Gemeinde. Reutlingen: Diakonie-Verlag.
Max Kreutzer, Borgunn Ytterhus (Hrsg.) (2011): „Dabeisein ist nicht alles“ – Inklusion und Zusammenleben im Kindergarten. München: Ernst Reinhardt Verlag.
Zukunftsplanung: Personenzentriertes Denken und Persönliche Zukunftsplanung
Zukunftsplanung: Personenzentriertes Denken und Persönliche Zukunftsplanung - Grundlagen und Grundgedanken
von Stefan Doose
"Wenn in der Zukunft Hoffnung liegt, liegt Kraft in der Gegenwart."
John Maxwell
Was ist Persönliche Zukunftsplanung?
Bei einer Persönlichen Zukunftsplanung denken mehrere Menschen gemeinsam über das Leben einer Person nach: die Person selbst, ihre Familie, Freundinnen, Freunde und Fachleute. Die Person um die es geht, kann eine Person mit oder ohne Behinderungen sein, ein Kind, jugendlich oder erwachsen. Dabei geht es zum Beispiel um folgende Fragen: Was ist mir im Leben besonders wichtig, damit es mir gut geht? Wie sieht eine wünschenswerte Zukunft für mich aus? Was sind meine Ziele? Welche Unterstützung benötige ich? Was sind die nächsten Schritte? Wer kann dabei wie helfen?
Wann ist eine Persönliche Zukunftsplanung sinnvoll?
Persönliche Zukunftsplanung bietet sich immer dann an, wenn sich im Leben etwas ändern soll, wird oder muss. Bei Kindern kann es zum Beispiel um den Übergang in die Krippe gehen, um die Einbeziehung eines Kindes mit hohem Unterstützungsbedarf in den Kindergartenalltag oder um den Übergang vom Kindergarten in die Schule.
Wer startet eine Persönliche Zukunftsplanung?
Bei Kindern sind es zunächst oft die Familien, die sich eine Zukunftsplanung für ihr Kind und für sich als Familie wünschen, weil sie sich Gedanken machen, wie es weitergehen kann. Manchmal haben auch Fachleute die Idee, dass eine Zukunftsplanung dem Kind und der Familie helfen würde.
Was ist ein Unterstützungskreis?
Die Kraftzelle einer Zukunftsplanung ist der Unterstützungskreis. Im Unterstützungskreis kommen sowohl Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde sowie Bekannte des Kindes und der Familie als auch verschiedene Fachleute zusammen, um mitzudenken und mitzuhelfen. Viele haben zunächst Hemmungen, andere Menschen um Unterstützung zu fragen. Aber viele Menschen empfinden es als Ehre, dabei zu sein und ihren Beitrag leisten zu können. Also trauen Sie sich ruhig, alle Menschen anzusprechen, von denen Sie denken, dass sie hilfreich sein könnten.
Woher stammt das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung?
Das Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung wurde im englischsprachigen Raum unter dem Namen "Person Centred Planning" seit den 80er-Jahren entwickelt. Im deutschsprachigen Raum machten es seit Mitte der 90er-Jahre unter anderem Ines Boban, Stefan Doose, Carolin Emrich, Susanne Göbel und Andreas Hinz bekannt.
Von welcher Grundhaltung geht Persönliche Zukunftsplanung aus?
Persönliche Zukunftsplanung basiert auf einem Denken, welches die Fähigkeiten und Möglichkeiten aller in den Blick nimmt und darauf aufbaut: Was kann ein Kind, bei alledem, was ihm vielleicht noch schwer fällt? Was interessiert es? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche müssen neu geschaffen werden? Dieses personenzentrierte Denken verlangt von den Beteiligten, genau hinzuschauen, hinzuhören und miteinander ins Gespräch zu kommen. Es geht darum, einander genau kennenzulernen, um herauszufinden, was der im Mittelpunkt stehenden Person selbst wichtig ist und was für sie wichtig ist, damit es ihr gut geht und sie ihre Fähigkeiten entfalten kann. Diese Grundhaltung ist die Basis Persönlicher Zukunftsplanung.
Was ist das Ziel von Persönlicher Zukunftsplanung?
Persönliche Zukunftsplanung ist nicht eine Methode, sondern umfasst viele methodische Ideen und Planungsansätze, um mit der planenden Person, ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden und Fachleuten positive Veränderungen zu bewirken. Dabei geht es vor allem darum, für die im Mittelpunkt stehende Person etwas Positives in Gang zu bringen und ihre Ziele zu erreichen. Es geht aber auch darum, dass sich Organisationen verändern und man gemeinsam vor Ort neue Möglichkeiten schafft.
"Der Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung schlägt eine Reihe von Aufgaben vor und hält verschiedene Methoden bereit, die uns helfen einen Prozess mit Menschen zu beginnen, um ihre Fähigkeiten aufzudecken, Möglichkeiten vor Ort zu entdecken und neue Dienstleistungen zu erfinden, die mehr helfen als im Weg stehen."
Beth Mount
Überblick über unser Angebot zum Thema Personenzentriertes Denken und Persönliche Zukunftsplanung für Kinder
Wir stellen Ihnen neben Grundlagentexten verschiedene Methoden des personenzentrierten Denkens und der Persönlichen Zukunftsplanung vor. Hier ein Überblick:
Inklusion als Menschenrecht – Persönliche Zukunftsplanung als Weg
Persönliche Zukunftsplanung ist ein wertegeleiteter Ansatz. Das Ziel von Persönlicher Zukunftsplanung ist es, Inklusion zu gestalten und die Menschenrechte jedes Menschen zu verwirklichen. In diesem Abschnitt finden Sie Informationen über Inklusion und Menschenrechte sowie wichtige gesetzliche Grundlagen, die Ausgangspunkt und Argumentationsbasis für Persönliche Zukunftsplanungsprozesse sein können.
Das Kind kennenlernen – ICH-Seiten, Karten und Fragen
Das Kind kennenzulernen, mit ihm auf Augen- und Ohrenhöhe zu kommunizieren, ist die Grundlage der Persönlichen Zukunftsplanung. Hier finden Sie Methoden wie ICH-Seiten, Kartensets und anregende Fragen, um die Lebenswelt des Kindes kennenzulernen und sichtbar werden zu lassen.
Methoden personenzentrierten Denkens – das einzelne Kind und die notwendige Unterstützung in den Blick nehmen
Es gibt eine Reihe von Methoden personenzentrierten Denkens, die helfen herauszufinden, was einem Kind und seiner Familie wichtig ist, was das Kind braucht, um gesund und sicher zu sein, und wie es kommuniziert.
Wertschätzung ausdrücken - Was andere an mir schätzen und mögen…
Gegenseitige Wertschätzung ist eine wichtige Basis für eine positive Entwicklung und eine Persönliche Zukunftsplanung. In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen eine Reihe kreativer Methoden vor, wie Wertschätzung ausgedrückt werden kann, zum Beispiel auf Postkarten, T-Shirts, Buttons, Elefanten, Laternen und natürlich durch die Blume…
Eine Seite über mich… – Was ihr über mich wissen solltet
Auf der „Einen Seite über mich“ werden wichtige Informationen zusammengestellt, damit andere Personen Ihr Kind gut unterstützen können. Diese Seite fasst zusammen, was Ihrem Kind wichtig ist, was andere an ihm mögen und wie es gut unterstützt werden kann. Lernen Sie anhand von Beispielen kennen, wie die „Eine Seite über mich“ beim Übergang in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule genutzt werden kann.
Fähigkeiten erkunden und Lernen dokumentieren - Ich kann etwas und lerne…
Die Fähigkeiten und Gaben eines Kindes zu sehen und zu würdigen ist eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen einer Persönlichen Zukunftsplanung. In diesem Abschnitt lernen Sie Methoden kennen, um Fähigkeiten und Lernprozesse von Kindern mit den Kindern zu erkunden und festzuhalten, zum Beispiel auf „Ich kann“-Seiten, durch Hutkarten oder das Konzept der Lerngeschichten.
Das Portfolio bzw. ICH-Buch des Kindes, eine stärkenorientierte Entwicklungsdokumentation
Das Portfolio – auch ICH-Buch genannt – ist eine tolle personenzentrierte Methode, um das Kind zu sehen und seine Entwicklung aufzuzeigen. Ein pädagogisches Portfolio orientiert sich stets an den Stärken, den Interessen und Vorlieben des Kindes. Es stellt somit die Kompetenzen des Kindes in den Vordergrund und dokumentiert anschaulich seine Lernschritte und Lernerfolge. Es eignet sich gut zur Vorbereitung einer Persönlichen Zukunftsplanung und von dieser kann wiederum im Portfolio berichtet werden.
Unterstützungskreise - Ich bin nicht allein
Persönliche Zukunftsplanung geschieht in der Regel mithilfe eines Unterstützungskreises. Im Unterstützungskreis kommen sowohl Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde sowie Bekannte als auch verschiedene Fachleute freiwillig zusammen, um die planende Person bei der Persönlichen Zukunftsplanung zu unterstützen. In diesem Abschnitt erfahren Sie mehr über die Gestaltung und Moderation eines Unterstützungskreises.
Persönliche Lagebesprechungen - Was läuft gut, was nicht?
Die Persönliche Lagebesprechung ist ein personenzentriertes Planungsformat. Sie eignet sich gut dazu, sich einen schnellen Überblick über die aktuelle Situation zu verschaffen, wichtige Themen herauszufiltern und erste Schritte zu planen. Die Stärke der Persönlichen Lagebesprechung ist, dass sie die Situation aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und diese getrennt erfasst (zum Beispiel Kind, Familie, Fachkräfte).
MAPS – Die eigenen Gaben einbringen
MAPS ist ein Planungsprozess mit einem Unterstützungskreis für Personen, bei denen sich eine Veränderung ankündigt, wie zum Beispiel das Verlassen des Kindergartens, der Beginn an einer neuen Schule oder der Schulabschluss. Bei MAPS geht es darum, die Geschichte der Person, ihre Träume und Albträume sowie ihre Gaben zu erkunden, um dann zu sehen, was sie benötigt, um ihre Gaben in die Gemeinschaft einbringen zu können.
PATH - Wege beschreiten, Übergänge gestalten
PATH ist ein Planungsprozess mit einem Unterstützungskreis für Personen, die schon eine Vorstellung davon haben, wie ihre Situation in Zukunft sein soll, aber den Weg dahin noch klären müssen. Der PATH-Prozess setzt an den gemeinsamen Werten und Visionen der planenden Person und ihres Unterstützungskreises an, zeichnet eine wünschenswerte Zukunft, beschreibt die gegenwärtige Situation, sucht dann Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Stärkungsmöglichkeiten für den Weg, beschreibt wichtige Zwischenschritte und endet mit einem konkreten Aktionsplan für den nächsten Monat.
Weitere Informationen und Materialien zum Thema Persönliche Zukunftsplanung finden Sie auch auf der Website „Persönliche Zukunftsplanung“.
"Die Zukunft, die wir wollen, müssen wir selbst erfinden!
Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen."Joseph Beuys
Vertiefende Literatur zum Thema Persönliche Zukunftsplanung:
Ines Boban (2008): Bürgerzentrierte Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen. Inklusiver Schlüssel zu Partizipation und Empowerment pur. In: Hinz, Andreas, Körner, Ingrid & Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Marburg: Lebenshilfe, S. 230-247
Stefan Doose (2011): „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen. Broschüre mit Materialienteil. 9. überarbeitete Auflage Kassel: Mensch zuerst. Der einführende Textteil (80 S.) ist verfügbar auf der Website „Persönliche Zukunftsplanung“ (PDF, 97 KB).
Stefan Doose, Carolin Emrich, Susanne Göbel (2004): Käpt’n Life und seine Crew. Ein Planungsbuch zur Persönlichen Zukunftsplanung. Zeichnungen von Tanay Oral. Kassel: Netzwerk People First Deutschland
Carolin Emrich, Petra Gromann, Ulrich Niehoff (2006): Gut Leben. Persönliche Zukunftsplanung realisieren – ein Instrument. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
Helen Sanderson & Maye Taylor (2008): Celebrating families. Simple, practical ways to enhance family life. Stockport: HSA Press. Bestellung und weiteres Material über die Website „Celebrating families“.
Zukunftsplanung: Das Kind kennenlernen
Das Kind kennenlernen – ICH-Seiten, Karten und Fragen
von Stefan Doose
"Wir müssen der Diagnose ihre eigentliche Funktion wiedergeben –
Menschen kennenzulernen."
Andrea Canevaro
Kennenlernen
Der Ausgangspunkt für personenzentriertes Denken und eine Persönliche Zukunftsplanung ist es, das Kind bzw. die planende Person kennenzulernen. Kennenlernen sollte dabei immer ein wechselseitiger Prozess sein, es geht um Begegnung und Austausch. Dabei sollte ein lebendiges Bild der Person, ihrer Vorlieben und Abneigungen, ihrer Stärken und Fähigkeiten, ihrer Interessen und Kenntnisse sowie ihrer Lebenssituation entstehen, das entwicklungsoffen ist.
Mich und meine Welt beschreiben
Die eigenen Fähigkeiten zu erkunden und weiterzuentwickeln, Neues zu lernen, neue, wertgeschätzte Rollen in verschiedenen Lebensbereichen einzunehmen (zum Beispiel Vorschulkind, Fußballstürmerin oder Verantwortlicher für eine Pflanze im Kindergarten), ist wichtig. Persönliche Zukunftsplanung ist ein stärkenorientierter Ansatz. Neue Möglichkeiten ergeben sich, wenn man weiß, was eine Person kann und interessiert. Gute Voraussetzungen für die Herausbildung eines positiven Selbst-Bewusstseins sind, sich selbst beschreiben zu können, gesehen zu werden und im Dialog mit einem Gegenüber zu sein, das an mir und meiner Entwicklung interessiert ist. Kinder und Erwachsene brauchen dazu andere Menschen, die wertschätzend mit ihnen umgehen und sie ernst nehmen.
Einige methodische Ideen, wie ein Kennenlernen des Kindes und seiner Welt erfolgen kann:
ICH-Seiten
Die ICH-Seiten sind Arbeitsblätter, auf denen ein Kind über sich und seine Beziehungen Auskunft geben kann. Ich-Seiten können auch Bestandteil eines Portfolios oder ICH-Buches sein, in dem die Entwicklung eines Kindes dokumentiert werden kann. Themen-Beispiele für ICH-Seiten sind:
- Wer bin ich? (Steckbrief)
- Was mag ich?
- Was kann ich gut?
- Meine Gruppe
- Meine Familie
- Meine Orte, an denen ich gerne bin
ICH-Seiten können natürlich auch als ICH-Plakate (PDF, KB, nicht barrierefrei) gestaltet werden.
Familienbuch
Das Familienbuch ist eine Zusammenstellung von Fotos der Familie, das die Kinder mit in die Krippe oder den Kindergarten bekommen. Diese Familienbücher sind für die Kinder zugänglich und so können sie ihre Familien zeigen und sich auch mal damit trösten.
In der Rechten Spalte finden Sie weitere Informationen über Familienbücher mit Beispielen.
Gesprächsanlässe: "Frag mich", Kartensets
Das Buch "Frag mich" von Antje Damm bietet 104 Fragen mit Bildern, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen.
Die Lebensstilkarten sind ein Kartenset der Persönlichen Zukunftsplanung. Sie dienen dazu, in einen Austausch zu kommen und einander anhand ungewöhnlicher Fragen kennenzulernen. Ursprünglich wurden sie, wie alle Kartensets der Zukunftsplanung, von "New Hats" in Salt Lake City für Jugendliche und Erwachsene mit Lernschwierigkeiten entwickelt. Aber auch Personen ohne Lernschwierigkeiten können sich mit diesen Karten auf ungewöhnliche Weise kennenlernen, und einige der Fragen können auch Kinder gut beantworten. In der Rechten Spalte finden Sie eine Auswahl der Karten mit Themen, die vielleicht auch mit Kindern genutzt werden können.
Die "Hutkarten" dienen dazu, über die eigenen Fähigkeiten ins Gespräch zu kommen. Wie in einem Hutgeschäft überlegt man, ob einem der Hut passt ("Ein Gartenmensch bin ich"), man ihn gerne ausprobieren möchte ("Sänger wäre auch nicht schlecht"), oder der Hut gar nicht passt ("Bedenkenträgerin will ich nicht sein"). In der Rechten Spalte finden Sie wieder eine Auswahl einiger Karten.
Die Traumkarten sind ein weiteres Kartenset der Persönlichen Zukunftsplanung, bei denen es um kleine und große Wünsche und Träume geht. Dieses Kartenset wurde ursprünglich für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit oder ohne Lernschwierigkeiten entwickelt. In der Rechten Spalte finden Sie eine Auswahl von Karten, die auch mit Kindern genutzt werden können.
Die vollständigen Kartensets ebenso wie die Broschüre "I want my dream" mit umfangreichem Materialteil zum Thema Persönliche Zukunftsplanung von Stefan Doose erhalten Sie auf der Website "Persönliche Zukunftsplanung" von "Mensch zuerst" in Kassel. In der Broschüre wird auch die Verwendung der Kartensets erläutert. Den Textteil der Broschüre (ohne Materialien), in dem es eine Einführung in Persönliche Zukunftsplanung für Menschen mit Lernschwierigkeiten gibt, finden Sie in der Rechten Spalte zum Download.
Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten bietet außerdem die Broschüre mit DVD "Talente" der Hamburger Arbeitsassistenz sehr empfehlenswerte Kartensets und Materialien zur Zukunftsplanung in der beruflichen Orientierung.
Körperumriss – Persönliches Profilbild
Ein Körperumriss auf einer großen Papierrolle kann gut für ein Persönliches Profilbild genutzt werden. In den Körperumriss können die eigenen Stärken und Fähigkeiten, Wünsche und Träume gemalt und geschrieben werden. In Kombination mit den Kartensets können passende Karten mit Fähigkeiten, wichtigen Dingen im Leben oder Wünschen und Träumen in das Profilbild geklebt werden. So wird deutlich, was alles in der Person steckt.
Zukunftsplaner
In dem Buch "Käpt’n Life und seine Crew. Ein Planungsbuch zur Persönlichen Zukunftsplanung" von Stefan Doose, Susanne Göbel und Carolin Emrich wird anhand der Geschichte eines Kapitäns in Leichter Sprache erklärt, was Persönliche Zukunftsplanung ist. Es gibt zahlreiche Übungen, die dazu dienen, über sich und seine Ziele nachzudenken.
Einander Kennenlernen und persönliche Informationen als Ausgangspunkte für eine Persönliche Zukunftsplanung
Hier einige Ideen, wie Sie die planende Person kennenlernen können, miteinander ins Gespräch kommen und wie sich die Person anderen vorstellen kann:
- Mehrere Ideen finden Sie unter Methoden personenzentrierten Denkens.
- Unter "Was andere an mir schätzen und mögen" gibt es viele kreative Methoden, um wertschätzende Rückmeldung von anderen zu erhalten oder selbst für andere auszudrücken.
- Eine gute Methode, um personenzentrierte Informationen zusammenzustellen, ist "Eine Seite über mich".
- Die persönlichen Informationen zur Vorstellung einer Person können zum Beispiel zum ersten Treffen des Unterstützungskreises für eine Persönliche Zukunftsplanung mitgebracht werden. Ob Kind, Jugendliche, Jugendlicher, Erwachsene oder Erwachsener - für jede planende Person können so Wege gefunden werden, wie sie anderen bedeutsame persönliche Informationen über sich präsentieren kann. Mehr über die Funktion und Gestaltung von Unterstützungskreisen erfahren Sie unter Unterstützungskreise.
- Beim MAP-Prozess geht es darum, im Unterstützungskreis die Geschichte der Person, ihre Träume und Albträume sowie ihre Gaben zu erkunden, um dann zu sehen, was sie benötigt, um ihre Gaben in die Gemeinschaft einbringen zu können. Dieser Prozess wird unter MAP erläutert. Die Aktivitäten aus diesem Abschnitt können eine gute Vorbereitung dafür sein.
Passgenaue, personenzentrierte Unterstützung können wir nur leisten, wenn wir ein lebendiges Bild von der Person mit ihren Stärken und Fähigkeiten, Interessen und Zielen, Wünschen und Träumen haben.
Weitere Informationen und Materialien zum Thema Persönliche Zukunftsplanung finden Sie außerdem auf der Website „Persönliche Zukunftsplanung“.
Vertiefende Literatur zum Thema:
Antje Borstelmann (Hrsg.) (2007): Das Portfolio-Konzept für Kita und Kindergarten. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
Antje Damm (2004): Frag mich. 108 Fragen an Kinder, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Frankfurt am Main: Moritz-Verlag.
Stefan Doose (2011): „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Plaanung mit Menschen mit Behinderungen. Broschüre mit Materialienteil. 9. überarbeitete Auflage Kassel: Mensch zuerst. Verfügbar auf der Website „Persönliche Zukunftsplanung“.
Stefan Doose, Carolin Emrich, Susanne Göbel (2004): Käpt’n Life und seine Crew. Ein Planungsbuch zur Persönlichen Zukunftsplanung. Zeichnungen von Tanay Oral. Kassel: Netzwerk People First Deutschland.
Hamburger Arbeitsassistenz (2008): talente. Ein Angebot zur Förderung von Frauen mit Lernschwierigkeiten im Prozess beruflicher Orientierung und Qualifizierung. Theoretische Grundlagen, Projektbeschreibung, Methoden, Materialien, Filme, Begleit-DVD. Hamburg: Hamburger Arbeitsassistenz.
Zukunftsplanung: Methoden personen-zentrierten Denkens
Methoden personenzentrierten Denkens
von Stefan Doose
Was ist personenzentriertes Denken?
Personenzentriertes Denken ist eine Grundhaltung, die eine Person mit dem was ihr wichtig ist, ihren Stärken und Möglichkeiten, ihren Träumen und Zielen in den Blick nimmt und darauf aufbaut. Was kann ein Kind, bei alledem, was ihm vielleicht noch schwerfällt? Was interessiert es? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche müssen neu geschaffen werden? Dieses personenzentrierte Denken verlangt, genau hinzuschauen, hinzuhören und miteinander ins Gespräch zu kommen. Es geht darum, einander genau kennenzulernen, um herauszufinden, was der Person wichtig ist und was für sie wichtig ist, damit es ihr gut geht und sie ihre Fähigkeiten entfalten kann.
Methoden personenzentrierten Denkens
Die Methoden personenzentrierten Denkens wurden von der Learning Community for Person Centred Practices und der Inklusions-Bewegung im englischsprachigen Raum entwickelt (siehe dazu die Website „Inclusion Distribution“).
Deren Ziel war ursprünglich, die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen durch Dienste und Einrichtungen individueller zu gestalten. Die Methoden wurden aber mittlerweile von Menschen jedes Alters, mit oder ohne Behinderungen, erprobt.
Helen Sanderson und Gill Goodwin haben diese Methoden in dem kleinen Heft "Personen-zentriertes Denken" zusammengestellt. Es ist jetzt auch auf Deutsch als PDF zum Herunterladen erhältlich: Personen-zentriertes Denken (PDF, 340 KB, nicht barrierefrei)
Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der Methoden vor:
Werte und Wohlbefinden – Was ist der Person wichtig, was ist für sie wichtig?
Bei dieser Methode werden zwei wichtige Fragen und eine Zusatzfrage erkundet:
1. Was ist der Person wichtig?
Bei der ersten Frage geht es darum, möglichst genau herauszufinden, was der Person im Leben bzw. in einem Lebensbereich (zum Beispiel Kindergarten, Schule, Arbeit, Familie) selbst wichtig ist: Was ist ihr im Leben wichtig? Welche Werte sind ihr bedeutsam? Was ist ihr zum Beispiel im Kindergarten wichtig? Was macht sie glücklich? Was sollte in ihrem Leben unbedingt vorkommen, was sollte vermieden werden? Dies kann sich auf die Beziehungen zu anderen Menschen, auf den Tages- und Wochenablauf, auf positive Routinen und Abläufe oder auf bestimmte Dinge beziehen.
Bei der Beantwortung soll so weit wie möglich die Sichtweise der Person selbst dokumentiert werden. Bei Babys oder Kleinkindern werden jedoch zunächst die Eltern sagen, was ihnen für ihr Kind wichtig ist und was unbedingt beachtet werden sollte. Bei Kindergartenkindern können in der Regel schon die Äußerungen des Kindes aufgeschrieben oder aufgemalt werden. Schulkinder und Erwachsene können in der Regel selbst sagen oder aufschreiben, was ihnen wichtig ist. Bei Personen, die sich nicht lautsprachlich äußern können, kann die Frage entweder durch Beobachtung von Situationen, in denen sich die Person wohlfühlt, oder mithilfe der "Unterstützten Kommunikation " beantwortet werden. Symbole aus der Unterstützten Kommunikation können auch direkt auf den Zettel oder das Plakat geklebt werden.
2. Was braucht die Person, um gesund zu sein und sich sicher zu fühlen?
Bei der zweiten Frage geht es darum, möglichst genau herauszufinden, was die Person braucht, um gesund zu sein und sich nicht in Gefahr zu bringen. Hier geht es um das Wohlbefinden und das gesundheitliche Wohlergehen. Was braucht die Person, um gesund zu bleiben oder zu werden? Welche Unterstützung benötigt sie, um zum Beispiel im Kindergarten teilhaben zu können? Was benötigt sie für ihr seelisches Wohlergehen?
Bei dieser Frage geht es um die eigene Sichtweise der Person, die aber ergänzt wird durch die Sichtweise der Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, und gegebenenfalls die von Therapeutinnen und Therapeuten oder Ärztinnen und Ärzten.
Ziel ist es, beide Fragen gleichermaßen zu beachten und in eine gute Balance zu bringen.
Was müssen wir noch lernen oder erkunden?
Manchmal sind nach Beantwortung der beiden Fragen noch einige Punkte unklar und müssen weiter beobachtet oder erkundet werden. Diese Zusatzfrage gibt Raum, offene Fragen festzuhalten.
Die Ergebnisse dieser Fragen werden auf dem Arbeitsblatt "Was ist der Person wichtig? Was ist für die Person wichtig?" (PDF, 160 KB, nicht barrierefrei) oder einem Poster festgehalten. In der Rechten Spalte finden Sie ein Beispiel für die Methode "Was ist der Person wichtig? Was ist für die Person wichtig?" (PDF, 77 KB, nicht barrierefrei).
Diese Aktivität ist auch eine gute Vorbereitung für "Eine Seite über mich" und die Persönliche Lagebesprechung.
Weitere Methoden personenzentrierten Denkens im Überblick:
Wichtige Menschen im Leben einer Person
Eine Methode, um wichtige Menschen im Leben Ihres Kindes bzw. Ihrer Familie zu identifizieren und passende Menschen für einen Unterstützungskreis zu finden, sind die "Kreise der wichtigen Menschen in meinem Leben". In der Rechten Spalte finden Sie die Anleitung zur Methode "Kreise der wichtigen Menschen in meinem Leben".
Meine Träume
Eine gute Möglichkeit, eine Person kennenzulernen und zu erfahren, was ihr wichtig ist: Gestalten Sie gemeinsam ein Blatt oder Plakat mit den Träumen der Person. Träume erzählen etwas Wichtiges darüber, wer wir sind und wer wir sein wollen, was uns wichtig ist und was uns antreibt.
Die Träume einer Person zu erkunden, ist auch ein wichtiger Teil im MAPS-Prozess im Unterstützungskreis.
So werden Entscheidungen getroffen
Diese Methode hilft darüber nachzudenken, welche Entscheidungsspielräume Menschen tatsächlich in ihrem Leben haben. Auf einem Arbeitsblatt oder Plakat werden in drei Spalten folgende Punkte aufgelistet:
- Wichtige Entscheidungen in meinem Leben?
- Wie ich daran beteiligt werden muss?
- Wer trifft die endgültige Entscheidung?
Gerade bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen mit einer kognitiven Beeinträchtigung geht es immer wieder darum, neu auszuhandeln, welche wichtigen alltäglichen und generellen Entscheidungen über ihr Leben sie alleine treffen können, wo sie mit einbezogen werden und bei welchen Fragen andere Menschen entscheiden.
Andere Menschen, wie Eltern, Erzieherinnen oder Erzieher, Lehrerinnen oder Lehrer sowie gesetzliche Betreuerinnen oder Betreuer dürfen bestimmte Dinge bestimmen, weil sie zum Beispiel das elterliche Sorgerecht, einen gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag oder die gesetzliche Betreuung haben. Es gibt aber im Alltag viele Spielräume, welche Entscheidungen Kinder und Jugendliche selbst treffen können und wie sie in Entscheidungsprozesse im Sinne von Partizipation eingebunden werden können. Ziel dieser Methode ist es, die Möglichkeiten der Partizipation und Selbstbestimmung zu erweitern.
Von bloßer Anwesenheit zu aktiver Teilhabe
Diese Methode hilft darüber nachzudenken, wie Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene besser in bestimmte, regelmäßige Aktivitäten einbezogen werden können. Dies ist besonders wichtig für Personen, die Unterstützung bei der Teilhabe brauchen, weil sie zum Beispiel eine Beeinträchtigung haben, mit ihrem Verhalten nicht verstanden werden oder die deutsche Sprache schlecht sprechen und einen anderen kulturellen Hintergrund haben.
Auf einem Plakat oder Arbeitsblatt wird notiert, welche regelmäßigen Aktivitäten es gibt, an denen die Person teilnimmt oder teilnehmen könnte und welche unterschiedlichen Grade der Teilhabe (anwesend sein, dabei sein, aktiv mitmachen) und neuen Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen und sich einzubringen, sich dort erschließen lassen.
Die Tabelle hat folgende Spalten:
- Aktivität
- anwesend sein
- dabei sein
- aktiv mitmachen
- Möglichkeiten, um neue Kontakte zu knüpfen
- Möglichkeiten, sich einzubringen
Kommunikations-Karte
Kommunikation geschieht nicht nur durch Lautsprache, sondern auch durch Blicke, Mimik, Gestik oder unser Verhalten. Babys oder Kleinkinder, die noch nicht sprechen können, Menschen, die aufgrund einer Beeinträchtigung keine Lautsprache haben, und Menschen, die kein Deutsch sprechen, sind darauf angewiesen, dass andere ihre Verhaltensäußerungen verstehen. Aber auch bei Kindern und Erwachsenen, die sprechen können, sagt das Verhalten oft mehr aus als das Gesagte.
Die Kommunikations-Karte schärft den Blick für die Kommunikation in Situationen, in denen das Verhalten einer Person mehr aussagt als das Gesagte. Die Kommunikations-Karte umfasst eine Tabelle mit folgenden Spalten:
- In dieser Situation…
- wenn das geschieht…
- glauben wir, dass es das bedeutet…
- und machen dies…
Es geht darum, eine bestimmte Situation zu beschreiben (1), das Verhalten der Person in dieser Situation (2), unsere Interpretation, was dieses Verhalten bedeutet (3), und was wir in dieser Situation tun sollten (4). Diese Methode schafft Transparenz und Verständigung zwischen Eltern, Erzieherinnen und Erziehern oder anderen Personen, zum Beispiel über das Verhalten eines Kindes. Sie sollte als Basis für weitere Beobachtungen und Lernen genutzt werden.
Lern-Tagebuch
Das Lern-Tagebuch bietet eine Möglichkeit, die Lernerfahrungen mit einem Kind oder einem Erwachsenen mit Unterstützungsbedarf zu dokumentieren und zu reflektieren. Es schafft die Grundlage, um zu überlegen, was sich bewährt hat und beibehalten werden sollte und was nicht gut gelaufen ist und zukünftig anders gemacht werden sollte.
Das Lern-Tagebuch ist auch als Tabelle mit verschiedenen Spalten aufgebaut:
- Datum
- Was hat das Kind bzw. die Person gemacht? (Was, wo, wann, wie lange?)
- Wer war dabei? (Name der Unterstützungspersonen, Freundinnen, Freunde und anderer)
- Was haben wir gelernt, was gut lief? Welche Situation eignet sich besonders gut zum Lernen? Was hat der Person an der Aktivität gefallen? Was muss so bleiben?
- Was haben wir gelernt, was nicht gut lief? Welche Situation eignet sich nicht zum Lernen? Was hat der Person nicht an der Aktivität gefallen? Was muss sich ändern?
Was läuft gut? Was läuft nicht gut?
Bei dieser Methode geht es darum, auf einem Plakat aus verschiedenen Sichtweisen (zum Beispiel der des Kindes, der Familie und der Fachleute) zusammenzutragen, was zurzeit gut und was nicht gut läuft. Jede Gruppe hat auf dem Plakat einen eigenen Abschnitt, in dem nur ihre Sichtweise aufgezeichnet wird, was gerade gut oder schlecht läuft.
Dies bietet die Möglichkeit, einen schnellen Überblick über die derzeitige Situation in verschiedenen Lebensbereichen zu bekommen und ein Problem oder eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Damit kann zum Beispiel eine Konfliktlösung unterstützt werden.
Diese Methode ist auch Kern der Persönlichen Lagebesprechung im Unterstützungskreis.
4+1 Fragen
Dies ist eine einfache Methode zum gemeinsamen Auswerten einer Situation. Alle Beteiligten beantworten gemeinsam vier Fragen, um dann mit der fünften Frage die nächsten Schritte zu planen. Die Ergebnisse werden auf einem Plakat oder Arbeitszettel festgehalten. Die Fragen lauten:
- Was haben wir versucht?
- Was haben wir gelernt?
- Worüber waren wir erfreut?
- Worüber waren wir besorgt?
- Ausgehend von dem, was wir wissen: Was ist der nächste Schritt?
Wichtig ist, dass jeder Person zugehört wird. Diese Fragen eignen sich auch gut zur Reflexion im Unterstützungskreis.
Diese und weitere Methoden des personenzentrierten Denkens finden Sie in der Broschüre "Personen-zentriertes Denken":
Helen Sanderson & Gill Goodwin (Hrsg.) (2010): Minibuch Personenzentriertes Denken. Deutsche Übersetzung Stefan Doose, Susanne Göbel, Oliver Koenig. HSA The Learning Community: Stockport.
als PDF zum Herunterladen: Personen-zentriertes Denken (PDF, 339 KB, nicht barrierefrei)
als Broschüre, bestellbar über "Mensch zuerst": Mensch zuerst – Shop
Vertiefende Informationen und Beispiele finden Sie in Englisch auf der Website „Helen Sanderson Associates“.
Zukunftsplanung: Wertschätzung
Wertschätzung ausdrücken – Was andere an mir schätzen und mögen
von Wiebke Kühl und Inken Kramp
Wertschätzung für Kinder bedeutet auch Wertschätzung für alle!
Jeder Mensch sehnt sich nach Lob und Anerkennung. Oft fühlen sich Menschen dadurch ausgegrenzt, dass sie nicht beachtet werden. Kinder hören zudem oft unangenehme Aussagen über sich. Jeden Tag wieder gibt es Situationen, die ein Kind durcheinander bringen, irritieren, deprimieren, und Kinder sind darauf angewiesen, etwas wirklich Gutes über sich zu hören. Wertschätzung setzt positive Energie frei. Wertschätzung zu geben und zu empfangen ist eine grundlegende Entscheidung des miteinander Umgehens und in unserer Kultur häufig verschüttet.
Mit zum Ausdruck gebrachter Wertschätzung wird das Heranwachsen positiv begleitet, wird Teenagern geholfen, ein gesundes Selbstbild von sich und eine positive Energie zu entwickeln. Veränderungen in jedem Alter kosten Kraft, und die Wertschätzung gibt Kraft. Es tut allen Menschen gut, positiv und wertschätzend übereinander und miteinander zu sprechen. Die Person erfährt sich so im Spiegel der Anderen:
Wer bin ich?
Was für eine Person bin ich?
Worin bin ich richtig gut?
Kinder müssen hören, dass sie geliebt werden. Es reicht nicht, es nur zu fühlen. Es reicht auch nicht, nur zu sagen: "Ich liebe dich." Es geht vielmehr um Details im alltäglichen Leben, die die Entwicklung und das Heranreifen des Kindes fördern und bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Identität hilfreich sind. Und dies gilt natürlich auch für Erwachsene!
Die richtigen Formulierungen zu finden, ist gar nicht so einfach
Hier ein paar Tipps dazu:
- Überlegen Sie, was Sie an einem Menschen mögen und sagen es ihm. Täglich!
- Verbiegen Sie sich nicht dabei. Finden Sie die Worte, die Sie gut sagen können und für die Sie aufrichtig stehen.
- Verwässern Sie die Botschaft nicht, sagen Sie es einfach.
- Sagen Sie es ganz selbstverständlich, es gehört einfach dazu.
- Sagen Sie es nicht im Streit, sondern wenn Sie Ihr Kind, Ihre Partnerin oder Ihren Partner, Ihren Kollegen oder Ihre Kollegin liebevoll betrachten.
- Kurz und prägnant - der Ton macht die Musik.
- Loben Sie im richtigen Moment und Sie werden häufiger solche Momente erleben.
- Drücken Sie sich differenziert aus, das gilt auch für Kritik.
Sagen Sie nicht "Du bist ein Chaot!" (anklagende Du-Botschaft), sondern "Manchmal bist du chaotisch!" (handlungsbezogene Botschaft).
In schwierigen Zeiten ist es notwendig, sich daran zu erinnern, was die Familie positiv ausmacht, um gemeinsam einen Weg in die Zukunft zu finden.
Beispiele, wie Kinder Wertschätzung erfahren und sehen können
Postkarte "3 Dinge, die ich an Dir mag und schätze"
Verteilen und um Ausfüllen und Rückgabe bitten.
T-Shirt
Gemeinsam mit Ihrem Kind bzw. den Kindern aus der Kindergartengruppe herausfinden, was sie im vergangenen Jahr alles gelernt haben und auf ein T-Shirt malen und schreiben. "Darauf bin ich stolz – das kann ich auch!"


Das Team wird neu eingekleidet; auf die alten Trikots schreiben sich die Mädchen und Jungen gegenseitig gute Dinge über einander: "Was ich an dir besonders mag:…", "Wofür ich dich bewundere:…", "Dein einzigartiger Einsatz in der vergangenen Saison…"

Die erste Übernachtung ohne die Eltern: Das Kind bekommt ein Kuschelkissen bzw. –tier, auf dem wertgeschätzte und gute Eigenschaften des Kindes aufgemalt, gestickt oder geschrieben sind. Dies kann ein lebenslanger Begleiter werden.

Platzsets gestalten für den täglichen Gebrauch oder auch eine besondere Tischdecke für besondere Anlässe, zum Beispiel für Geburtstag oder Sonntagsfrühstück

Buttons für das Kind gestalten oder mit den Kindern herstellen und sich gegenseitig schenken.



Tasche genäht aus einem alten, zu klein gewordenen Lieblingspullover.
Fotorahmen mit Stärken und einem Lieblingsbild, der Rahmen kann bemalt oder mit kleinen Fundstücken des Kindes beklebt werden. Es gibt Rahmen, in die zusätzlich zum Bild auch Gegenstände hineingefüllt werden können.

Die Blume wird vorwiegend von Menschen erstellt, die dem Kind nahe stehen. In den Blütenblättern wird gesammelt, was das Kind in deren Leben bringt. In die Wurzeln wird geschrieben, was das Kind braucht, um stark zu sein und wachsen zu können.

Wertschätzendes als kleine Botschaften aufschreiben oder aufmalen. Die beschriebene Person kann den Zettel im Portemonnaie bei sich tragen.
Ergänzend zum vorhandenen Motiv kann ein Spruchband mit dem Motto der Kindergartengruppe oder der Familie oder Wertschätzendes über das Kind darauf geklebt werden.
- Eine Uhr, die anstelle der Zahlen Fotos von wichtigen Menschen hat.
- Eine transparente Tasche, in die Fotos eingefügt werden können.
- Schmuck, in den wertschätzende Worte graviert werden.
- Getöpfertes mit wertschätzenden Begriffen, Lieblingsorten oder Lieblingsbeschäftigungen des Kindes.

Wertschätzung in einer Familie ausdrücken
Werte zu schätzen wissen und es den anderen auch sagen und zeigen können
Eltern wollen glückliche Kinder! Oft wird das Familienleben heute aber als schnelllebig, konzentriert und hektisch beschrieben. Kinder, die den Kindergarten besuchen, die fernsehen und Zeit mit Menschen außerhalb der eigenen Familie verbringen, bekommen täglich neue Eindrücke davon, wie unterschiedlich Familien zusammenleben und Menschen ihre Beziehungen gestalten. Eltern müssen entscheiden, welche Aktionen in ihrem Zusammenleben mit den Kindern dazu beitragen, dass die Familie zusammenhält und welche davon zu ihnen als Familie passen.
Sich bewusst Zeit zu nehmen, um gemeinsam zu träumen, zu diskutieren und die Gemeinschaft zu fördern, steht hinter dem Wort Wertschätzung.
Gemeinsam stark werden ist das Ziel
Darum ist es sinnvoll, wenn sich Familien zu folgenden Fragen Gedanken machen:
- Welche Wünsche habe ich für meine Familie?
- Wie sollen meine Kinder aufwachsen?
- Was kann ich tun, um dies zu beeinflussen?
Dies kann kein Familienmitglied allein. Stellen Sie sich vor, sie steigen in eine Zeitmaschine und reisen 30 Jahre in die Zukunft. Sie veranstalten ein großes Fest für ihre Familie und schauen zurück auf eine schöne gemeinsame Zeit miteinander. Fragen Sie sich:
- Was für eine Art von Familie wollen wir sein?
- In welche Art von zu Hause wollen wir unsere Freundinnen und Freunde einladen?
- Über was bin ich besorgt in meiner Familie?
- Was bewirkt, dass ich mich richtig wohlfühle in meiner Familie?
- Was zieht mich nach Hause?
- Was für Prinzipien verfolgen wir alle gleichermaßen?
- Welche Traditionen lieben und leben wir?
- Was bedeutet ein erfolgreiches Familienleben für jede und jeden einzelnen?
- Was muss passieren, damit es der Familie gut geht?
- Was macht mich und dich glücklich in dieser Familie?
- Welche Menschen sind außerhalb der Familie wichtig?
- Was finde ich an anderen Familien gut? Was davon würde ich auch gern einmal ausprobieren?
- Welche Familien inspirieren mich und warum bewundere ich sie?
- Was sind die einzigartigen besonderen Gaben, Talente, Fähigkeiten jedes Familienmitgliedes?
Für junge Eltern bedeutet dies:
- Was für Eltern wollen wir sein?
- Was können und wollen wir verändern?
- Welche Werte sollen unsere Kinder mit auf ihren Lebensweg bekommen?
- Wie können wir unseren Kindern dabei helfen, ihre eigenen Werte zu finden?
Ein gemeinsames Motto finden – Verbindendes schaffen
Auch über die Werte und gemeinsamen Ziele kann nur gemeinsam gesprochen und nachgedacht werden. Immer dann, wenn die Familie zusammen ist und schöne Dinge erlebt, kann sie einen gemeinsames „Motto“ kreieren, singen, herausschreien oder sich in Wort und Bild verewigen.
Ähnlich wie Familien folgt auch jeder Kindergarten einem Erziehungskonzept und steht für ein Leitbild, in dem die Werte der praktizierten Pädagogik verankert sind. Dieses sichtbar zu machen für die und mit den Kindern, geschieht oft sehr kreativ. Dies können auch Familien tun.
Beispiele für das Sichtbarmachen von Werten in einer Familie
- Alltagsgegenstände werden mit Symbolen oder Begriffen versehen und in der Familie genutzt, zum Beispiel ein Schirmständer mit den Namen und „Slogans“ der Familienmitglieder: Für die Familienmitglieder sind die Werte präsent und Besucherinnen und Besucher bekommen eine Idee davon, wie diese Familie tickt.
- Familien-Schatzkiste: Eine gut zugängliche Schatzkiste wird in Abständen immer wieder von den Familienmitgliedern mit Wünschen für die gemeinsam zu verbringende Zeit gefüllt. Regelmäßige, ritualisierte Familienzeiten können so leicht gemeinsam geplant werden. Spielabende, Ausflüge, gemeinsame Erlebnisse verbinden eine Familie mit Spaß und schaffen Zusammenhalt.
- Spaßige Familientreffen, besondere Highlights werden fotografiert und präsentiert. So bleiben sie noch lange frisch in der Erinnerung und geben Kraft.
- Karten: Jede und jeder schreibt ihre bzw. seine Wertvorstellungen für die Familie auf eine Karte, legt sie auf den Tisch und alle diskutieren über Ähnlichkeiten und Unterschiede.
- Postkarten oder andere Bilder: Alle wählen ein Bild von ihrer idealen Familie aus und erklären, was ihnen an dieser Familie gut gefällt.
- Regelmäßige Familienessen mit einem Fokus auf Wertvorstellungen: Fragen, kleine Geschichten oder Bilder werden auf Karten geschrieben bzw. gemalt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Alle ziehen eine Karte und lesen reihum die Frage oder Geschichte vor bzw. beschreiben das Bild. Danach können sich die Familienmitglieder darüber austauschen, was ihnen in der letzten Zeit besonders wichtig war.
- Poster: Alle zusammen gestalten ein Poster, das die Familie zeigt, die sie gerne sein wollen.

- Fotoalbum: Ein gemeinsames Familienalbum hält das Heranwachsen der Kinder und die Entwicklung der Familie bildlich fest. Wertvoll sind auch kleine Beschreibungen oder liebevolle Geschichten zu den Bildern, sodass die Erlebnisse möglichst intensiv in Erinnerung bleiben.
- Regelmäßige wöchentliche Aktivitäten, wie Bowling oder Spielabende helfen dabei, familientypische Rituale zu finden. Dies gibt Sicherheit und jeder und jedem die Möglichkeit, sich mit ihren bzw. seinen Ideen und Fähigkeiten einzubringen und auszuprobieren.
- Collage: Ein gemeinsames Bild herstellen und an einem besonderen Platz im Haus aufhängen. Auf dem Bild sind die Mitglieder der Familie zu sehen und ihre Werte festgehalten. Das Bild wird in größeren Abständen von der Wand genommen und überarbeitet. Es dient zur Reflexion.
- Familienwappen, Familienflagge: Bilder oder Symbole für wichtige und typische Dinge in der Familie finden und als Wappen, Aufkleber oder Flagge gestalten. Sie beschreiben sich damit als Familie und präsentieren sich auch anderen als starke Gemeinschaft.

- Herz oder Stern, bestickt mit den gemeinsamen Werten der Familie: Ein Paar kann dies herstellen, wenn es plant, ein Kind zu bekommen und es dem Baby als „Willkommen in unserer Familie“-Geschenk ins Zimmer hängen.
Was auch immer eine Familie oder ein Kindergarten ausprobieren möchte

Diese und weitere Anregungen, wie Wertschätzung in Familien gelebt werden kann, finden Sie beschrieben in den Büchern und auf den folgenden Websites:
Susan Camps (2010): Celebrating families. Toolbox. Stockport: HSA Press.
Helen Sanderson & Maye Taylor (2008): Celebrating families. Simple, practical ways to enhance family life. Stockport: HSA Press. Bestellung und weiteres Material: Website „Celebrating Families“
Zukunftsplanung: Eine Seite über mich
Eine Seite über mich… – was ihr über mich wissen solltet
Stefan Doose, Wiebke Kühl und Inken Kramp
Das Wichtigste in Kürze – was sollten andere über die Person wissen?
Stellen Sie sich vor, ihr Kind kommt in die Krippe, den Kindergarten, die Schule oder ins Krankenhaus. Welche Informationen sollten die pädagogischen oder pflegerischen Fachkräfte unbedingt haben, um das Kind gut unterstützen zu können? Welche Informationen sollten Kolleginnen und Kollegen haben, die mit Ihnen zusammenarbeiten? Welche Informationen sollten die Altenpflegerinnen und -pfleger im neuen Seniorenheim haben, in das Ihre demente Mutter zieht, um etwas über ihr Leben und ihre Vorlieben zu erfahren und sie gut unterstützen zu können? Verschiedene Anlässe – ein Anliegen: auf eine wertschätzende, personenzentrierte Weise zusammenzufassen, was der Person wichtig ist und wie sie gut unterstützt werden kann.
Eine Seite über mich (One Page Profile)
Helen Sanderson Associates, eine Beratungsorganisation aus Großbritannien, hat über diese Frage nachgedacht und die Methode „Eine Seite über mich“ (One Page Profile) entwickelt. Ziel ist es, wichtige Informationen auf einer Seite zusammenzufassen. Diese „Seite über mich“ kann je nach Anlass verschiedene Formen annehmen und sich im Laufe der Zeit ändern.
Drei Fragen und ein Foto
Typischerweise umfasst die „Seite über mich“ die Antworten auf drei Fragen und ein Foto der Person. Diese Fragen sind eine Zusammenfassung aus der Arbeit mit anderen personenzentrierten Methoden, können aber auch unabhängig davon bearbeitet werden.
Die Fragen lauten:
- Was mir wichtig ist… In diesem Punkt wird aus Sicht der Person zusammengetragen, was ihr im Leben (im Kindergarten, bei der Arbeit) wichtig ist und unbedingt beachtet werden sollte.
- Was andere an mir mögen und schätzen… In diesem Punkt werden aus Sicht von anderen Menschen (Familie, Freunde und Freundinnen, Erzieherinnen, Erzieher, andere Kinder) Eigenschaften aufgelistet, die sie an der Person schätzen. Das können Antworten sein auf die Frage: "Was bringt die Person in diese Welt, was sonst nicht da wäre?" Die Person darf, sofern sie es schon oder noch kann, aus den Vorschlägen der anderen die Dinge auswählen, die sie gerne auf ihrer Seite haben möchte.
- Wie man mich gut unterstützen kann… Dies ist für viele eine ungewohnte, aber sehr wichtige Frage. Wie sieht gute Unterstützung für die Person aus? Was braucht sie, damit sie sich wohl fühlt und gesund ist? Dabei geht es beispielsweise um folgende Aspekte: Was braucht ein Kind, um gut spielen und lernen zu können? Was braucht eine Kollegin oder ein Kollege, um gut arbeiten zu können? Welche Unterstützung wünschen Sie sich? Es kommt oft auf Details an, ob etwas genau passend ist oder nicht.
Beispiel einer "Seite über mich", die Kopiervorlagen können Sie in der rechten Spalte herunterladen:
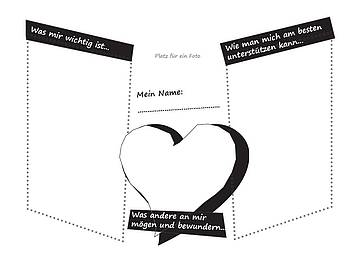
Eine Seite… verschiedene Möglichkeiten
Eine Seite über Babys und Kleinkinder
Die "Seite über mich" für Babys und Kleinkinder kann von den Eltern für den neuen Babysitter, die neue Tagesmutter oder die Krippe gestaltet werden. Im Laufe der Zeit können die vertrauten Unterstützungspersonen vielleicht neue Dinge hinzufügen, manches ändert sich ja auch. Die Seite kann gut sichtbar neben dem Wickelplatz oder die Seiten aller Kinder können an einer Wand aufgehängt werden. Sie kann bei einem Aufnahmegespräch in der Krippe als Gesprächsgrundlage dienen oder der Betreuungsperson mitgegeben werden.
Beispiel einer Seite über ein Kleinkind, in der Rechten Spalte finden Sie diese im DIN-A-4-Format:

Eine Seite über Kindergarten- und Vorschulkinder
Mädchen und Jungen im Kindergarten- oder Vorschulalter können selbst schon mehr zu ihrer "Seite über mich" beitragen. Eltern, Erzieher oder Erzieherinnen können in den Worten des Kindes aufschreiben, was ihm wichtig ist. Das Kind kann an der Gestaltung der Seite mitwirken. Die "Seite über mich" kann auch in das Portfolio eingeheftet werden oder mit Vorschulkindern für den Übergang in die Schule vorbereitet werden.
Eine Seite über Schulkinder
Schulkinder und Teenager können natürlich ihre Seite in der Regel selbst gestalten. Die "Seite über mich" kann dazu genutzt werden, zu überlegen, was den Schülern und Schülerinnen in der Schule wichtig ist und wie sie von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und ihren Lehrern und Lehrerinnen gut unterstützt werden können. Auch die Rückmeldung, was Mitschülerinnen, Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer an der Person schätzen und mögen, tut gut.
Beispiel einer Seite über ein Schulkind, in der Rechten Spalte finden Sie diese im DIN-A-4-Format:
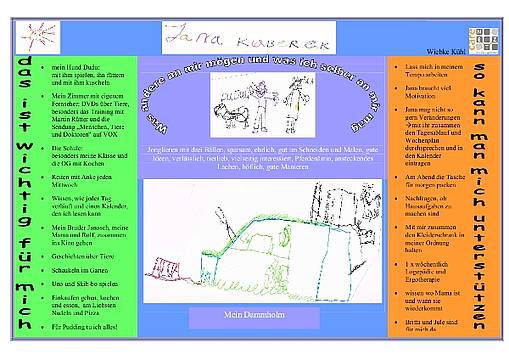
Eine "Seite über mich" für Kolleginnen und Kollegen
Personenzentriertes Denken ist eine Kulturfrage. Deshalb ist es hilfreich, im Team eine auf die Arbeitssituation bezogene "Seite über mich" zu erstellen und sich mit Kolleginnen und Kollegen darüber auszutauschen. Wissen Sie, was Ihrer Kollegin bei ihrer Arbeit wichtig ist und wie Sie sie gut unterstützen können? Wissen Sie, was die anderen an Ihnen schätzen und mögen? Dies kann Teams stärken und helfen, besser zusammenzuarbeiten. In der Kindertagesstätte können neben den Seiten der Kinder auch die Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen aufgehängt werden. Vielleicht ist es ganz gut, wenn Eltern wissen, was Ihnen in Ihrer Arbeit wichtig ist und wie Sie gut unterstützt werden können. Vielleicht sagen Ihnen Eltern dann auch häufiger, was sie an Ihnen schätzen…
Eine "Seite über mich" für ältere Menschen
Die "Seite über mich" ist auch eine gute Möglichkeit für ältere Menschen, die zu Hause Unterstützung benötigen oder in ein Seniorenheim wechseln. Gerade, wenn eine Person Demenz hat oder das Unterstützungspersonal häufig wechselt, ist dies eine gute Hilfe.
In der Rechten Spalte finden Sie als Beispiel eine "Seite über mich" von einem älteren Menschen.
Tipps zum Erstellen einer „Seite über mich“
Abschließend noch ein paar Tipps von Helen Sanderson und Maye Taylor zum Erstellen einer "Seite über mich" für kleine Kinder:
- Schreiben Sie genug Details hinein, sodass im Notfall ein Blick auf die Seite reicht, damit sich jemand gut um das Kind kümmern kann. Es kann sein, dass Sie ausfallen und keine Zeit mehr haben, der anderen Person alles zu erklären. Die Seite sollte alle Informationen beinhalten, damit eine andere Person gut für Sie einspringen kann.
- Damit gut für das Kind gesorgt werden kann, ist es wichtig, dass Sie Antworten auf die Fragen Was?, Wo?, Wer?, Wie? und Wann? aufschreiben.
- Benutzen Sie farbige Markierungen für Details, aber schreiben Sie keine Romane. Wenn Sie an die 20 Seiten brauchen, ist es zu lang.
- Wenn Sie wollen, bringen Sie auch Fotos oder Bilder mit hinein.
- Formulieren Sie konkret: Schreiben Sie statt "Lieblingsspielzeug", welches Spielzeug es ist. Statt "Freunde" zu schreiben, listen Sie die Namen der Freundinnen und Freunde auf.
- Sortieren Sie die Themen und Überschriften. Das macht es anderen Menschen leichter, einen Überblick zu bekommen. Versuchen Sie aber nicht, alles einzusortieren - das Leben ist nicht so gradlinig. Es dürfen auch Dinge allein stehen.
Vertiefende Links und Literatur zum Thema
(in Englisch)
Auf der Internetseite von Helen Sanderson Associates gibt es viele Materialien zum Personenzentrierten Denken und zu One Page Profiles
Website “Helen Sanderson Associates”
Susan Camps (2010): Celebrating families. Toolbox. Stockport: HSA Press. Bestellung und weiteres Material: Website „Celebrating Families“
Lorraine Erwin & Helen Sanderson (2010): One page profiles with children and young people. Stockport. Verfügbar unter: Website “Helen Sanderson Associates”
Helen Sanderson & Maye Taylor (2008): Celebrating families. Simple, practical ways to enhance family life. Stockport: HSA Press. Bestellung und weiteres Material: Website „Celebrating Families“
Zukunftsplanung: Fähigkeiten erkunden und Lernen dokumentieren
Fähigkeiten erkunden und Lernen dokumentieren – Ich kann etwas und lerne…
von Stefan Doose
„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken.“
Galileo Galilei
Fähigkeiten erkunden
Die eigenen Fähigkeiten und Gaben zu erkunden und zu entwickeln, braucht Gelegenheiten und Anregungen. Bildungsprozesse, so wissen wir heute, sind überwiegend Selbstbildungsprozesse. Welche Möglichkeiten werden mir gegeben, Dinge, die mich interessieren, zu verfolgen und auszuprobieren? Was wird mir zugetraut?
„Niemand weiß, was er kann, bevor er's versucht.“
Publilius Syrus
Inklusive Bildung hat den Anspruch, dass alle Menschen anspruchsvolle Lernumgebungen und Aufgaben erhalten, individuell beim Lernen begleitet werden und dass Barrieren, die Lernen und Teilhabe stören oder vehindern, beseitigt werden. Mehr zum Thema Inklusion und zum Recht auf inklusive Bildung durch das neue Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen erfahren Sie unter Inklusion als Menschenrecht.
Jedes Kind hat ein Recht darauf, dass seine Fähigkeiten und sein Lernen gesehen und für sich gewürdigt werden, ohne mit anderen verglichen zu werden. Jedes Kind hat andere Fähigkeiten und Gaben. Personenzentriertes Denken und Persönliche Zukunftsplanung basieren auf einem stärkenorientierten Ansatz. Es geht darum zu wissen, was die Stärken und Fähigkeiten einer Person sind, was sie kann, bei alledem was sie vielleicht noch nicht kann. Im Zusammenhang mit Persönlicher Zukunftsplanung wird oft von den Gaben eines Kindes oder Erwachsenen gesprochen, zum Beispiel von John O‘Brien und Jack Pearpoint:
„Gaben sind Stärken und Fähigkeiten, die uns gegeben sind, damit wir sie anderen geben können. Sie haben eine soziale Komponente und sind unsere Möglichkeit etwas beizutragen und teilzuhaben. Dabei kommt es nicht darauf an, der Beste in der großen weiten Welt zu sein. Manche Gaben machen einen Unterschied für einen kleinen Kreis von Leuten: die Familie, die Kindergartengruppe. Manche Gaben erreichen viele Menschen, zum Beispiel im Stadtteil oder im ganzen Land. Gaben verkümmern, wenn sie nicht gesehen, vernachlässigt oder nicht empfangen werden. Gaben verlangen manchmal Mut, sie einzusetzen und Disziplin, sie weiterzuentwickeln.“
Die eigenen Stärken und Fähigkeiten - also seine Gaben - benennen zu können, Beispiele des Gelingens festzuhalten, Lernerfahrungen beschreiben zu können, sind wichtige Grundlagen eines guten Selbst-Bewusstseins. Deshalb ist es wichtig, sie zu dokumentieren. Dies kann zum Beispiel im Rahmen eines Portfolios oder ICH-Buchs geschehen. Die Dokumentation der Stärken, Fähigkeiten und Interessen ist auch Ausgangspunkt einer Persönlichen Zukunftsplanung.
Im Folgenden lernen Sie Methoden kennen, um Fähigkeiten und Lernprozesse von Kindern mit den Kindern zu erkunden und festzuhalten, zum Beispiel auf „Ich kann“-Seiten, durch „Hutkarten“ oder das Konzept der Lerngeschichten.
„Ich-kann“-Seiten
Eine „Ich-kann“-Seite, auf der die Stärken und Fähigkeiten einer Person zusammengetragen werden, ist ein wichtiges Dokument. Diese Seite kann mit Zeichnungen, Fotos, Karten aus entsprechenden Kartensets oder Worten gestaltet und nach und nach ergänzt werden. Solche Seiten oder Plakate können leicht erstellt werden.
Es gibt aber auch Vorlagen, wie das Arbeitsblatt "Meine Stärken und Fähigkeiten". Die „Ich-kann“-Seiten sind ein guter Beitrag für die „Ich-Seiten“ in einem Portfolio.
Meine Lernziele
Auf einer anderen Seite können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre persönlichen Lernziele in verschiedenen Bereichen für die nächste Zeit aufschreiben. Was möchte ich lernen? Diese Seite kann auch gut für ein Portfolio genutzt oder als Plakat gestaltet werden.
Geschafft – gelernt
Eine andere Möglichkeit sind die „Geschafft - gelernt“-Seiten, wie sie Antje Borstelmann für das Portfolio vorschlägt. Auf dieser Seite wird per Foto oder Text festgehalten, wenn ein Kind eine neue Fertigkeit erlernt hat, wenn es sich zum Beispiel zum ersten Mal alleine anzieht, die Schnürsenkel bindet oder Fahrrad fährt.
Kartensets: „Ich-kann“-Karten, „Hutkarten“, „Skill-Cards“
Die Hutkarten dienen dazu, über die eigenen Fähigkeiten ins Gespräch zu kommen. Wie in einem Hutgeschäft überlegt man, ob einem der Hut passt („Ein Gartenmensch bin ich“), man etwas gerne ausprobieren möchte („Sänger wäre auch nicht schlecht“) oder der Hut gar nicht passt („Bedenkenträgerin will ich nicht sein“). In der Rechten Spalte finden Sie eine Auswahl an Karten, die auch mit Kindern genutzt werden können.
Welcher Hut passt zu mir?
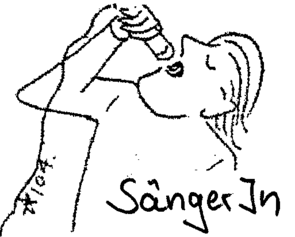



Die „Ich-kann“-Karten wurden von der Hamburger Arbeitsassistenz für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten zur beruflichen Orientierung entwickelt und sind auf der DVD in der Broschüre „Talente“ zu finden. Einige der Karten können auch schon mit Kindern verwendet werden.

Für Erwachsene gibt es die Skill-Cards, Bilderkarten, mit denen verschiedene Kompetenzen abgebildet werden. Sie können zur Beschreibung des eigenen Kompetenz-Profils genutzt werden.
„Was andere an mir schätzen und mögen“ – Rückmeldung von anderen bekommen
Es ist wichtig, von anderen Menschen wertschätzende Rückmeldung zu bekommen. Unter „Wertschätzung ausdrücken – was andere an mir schätzen und mögen“ erhalten Sie viele methodische Ideen, wie dies passieren kann.
Ein Plakat „Was andere an mir schätzen und mögen“, auf dem mehrere Leute, zum Beispiel ein Unterstützungskreis, auflisten, was sie an einem schätzen und mögen, ist immer eine gute Stärkung.
„Am Schönsten fand ich, als alle gesagt haben, was sie an mir mögen“
Aussage eines Planenden
Dieses Plakat wird zum Beispiel am Anfang einer Persönlichen Lagebesprechung genutzt. Im MAPS-Prozess werden die Gaben der planenden Person im Unterstützungskreis zusammengetragen, um dann zu erkunden, was notwendig ist, damit diese Gaben eingesetzt werden können und zur Geltung kommen.
„3 gute Dinge über mich“
Eine nette Idee von Helen Sanderson Associates, einem britischen Beratungsteam im Bereich „Personenzentrierte Methoden“, um positive Rückmeldungen von anderen Personen einzuholen, ist eine Postkarte mit „3 guten Dingen über mich“. Sie kann an mir wichtige Menschen, wie Mitschülerinnen und Mitschüler, Familienangehörige, Freundinnen und Freunde, Erzieherinnen und Erzieher, Kolleginnen und Kollegen mit der Bitte um Rückmeldung verteilt werden. So können in einen Persönlichen Zukunftsplanungsprozess auch gut Rückmeldungen von Personen eingebaut werden, die weiter weg wohnen und nicht zu einem Unterstützungskreis-Treffen kommen können. In der Rechten Spalte finden Sie eine Kopiervorlage der Postkarte „Diese 3 Dinge mag und schätze ich an dir“ die von Inken Kramp gestaltet wurde.
Körperumriss – persönliches Profilbild
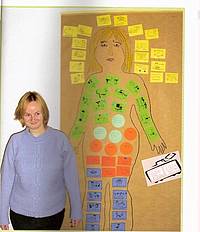
Ein Körperumriss auf einer großen Papierrolle kann gut für ein Persönliches Profilbild genutzt werden. In den Körperumriss können die Stärken und Fähigkeiten, Wünsche und Träume gemalt und geschrieben werden. In Kombination mit den Kartensets können passende Karten mit Fähigkeiten, wichtigen Dingen im Leben oder Wünschen und Träumen in das Profilbild geklebt werden. So wird deutlich, was alles in der Person steckt. Das Beispiel auf dem Foto stammt aus der beruflichen Orientierung mit Jugendlichen aus dem Buch „Talente“ der Hamburger Arbeitsassistenz.
Bildungs- und Lerngeschichten
Eine Bildungs- und Lerngeschichte ist eine kleine Geschichte oder Erzählung, in der das Lernen des Kindes in einer bestimmten zuvor beobachteten Situation beschrieben wird. Eine Erzieherin beschreibt zum Beispiel, was sie beobachtet hat, als sich ein Kind ganz intensiv mit allen Dingen, die sich drehen, auseinandergesetzt hat. Bildungs- und Lerngeschichten erzählen in einer dem Kind verständlichen Form von dessen Lernanstrengungen und -erfolgen. Sie sind ein stärkenorientiertes Gegenmodell gegen Beobachtungen mit dem klassischen Defizitblick, der erfassen will, wo Entwicklungsverzögerungen vorliegen.
Der Ansatz der Bildungs- und Lerngeschichten wurde von Margaret Carr Ende der 90er-Jahre in Neuseeland entwickelt und durch das Deutsche Jugendinstitut im Rahmen eines Projektes nach Deutschland gebracht. Ziel ist es, die Lernprozesse jedes Kindes besser zu verstehen und es beim Lernen zu unterstützen.
- Einen ersten Überblick über Bildungs- und Lerngeschichten erhalten Sie auf der Website des DJI.
- Eine gute Einführung mit Filmen bietet das Buch von Hans Rudolf Leu und anderen: Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen.
- Beispiele finden Sie in der Broschüre der Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) „Sieh, was ich kann! Bildungs- und Lerngeschichten in Kitas“ (PDF, 2,74 MB, nicht barrierefrei)
Bildungs- und Lerngeschichten können gut Teil eines Portfolios sein.
Portfolio – ICH-Buch
Das Portfolio – auch ICH-Buch genannt – ist eine tolle personenzentrierte Methode, um das Kind zu sehen und seine Entwicklung aufzuzeigen. Ein pädagogisches Portfolio orientiert sich stets an den Stärken, den Interessen und Vorlieben des Kindes. Es stellt somit die Kompetenzen des Kindes in den Vordergrund und dokumentiert anschaulich seine Lernschritte und Lernerfolge. Es eignet sich gut zur Vorbereitung einer Persönlichen Zukunftsplanung und von dieser kann wiederum im Portfolio berichtet werden. Unter Portfolio (link) erfahren Sie mehr darüber.
Eine gute Methode, um personenzentrierte Informationen zusammenzustellen, ist auch die „Eine Seite über mich“.
Beim MAPS-Prozess geht es darum, im Unterstützungskreis die Geschichte einer Person, ihre Träume und Albträume sowie ihre Gaben zu erkunden, um dann zu sehen, was sie benötigt, um ihre Gaben in die Gemeinschaft einbringen zu können. Die Aktivitäten aus diesem Abschnitt können eine gute Vorbereitung dafür sein.
Vertiefende Literatur zum Thema
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2007): Sieh, was ich kann! Bildungs- und Lerngeschichten in Kitas – Erfahrungen aus dem Projekt „Kind & Ko“. Gütersloh. „Sieh, was ich kann! Bildungs- und Lerngeschichten in Kitas“ (PDF, 2,74 MB, nicht barrierefrei).
Antje Borstelmann (Hrsg.) (2007): Das Portfolio-Konzept für Kita und Kindergarten. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
Stefan Doose: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen. Broschüre mit Materialienteil. 9. überarbeitete Auflage Kassel: Mensch zuerst, 2011. Verfügbar über die Website „Persönliche Zukunfstplanung“.
Stefan Doose, CarolinEmrich, Susanne Göbel (2004): Käpt’n Life und seine Crew. Ein Planungsbuch zur Persönlichen Zukunftsplanung. Zeichnungen von Tanay Oral. Kassel: Netzwerk People First Deutschland.
Hamburger Arbeitsassistenz (2008): talente. Ein Angebot zur Förderung von Frauen mit Lernschwierigkeiten im Prozess beruflicher Orientierung und Qualifizierung. Theoretische Grundlagen, Projektbeschreibung, Methoden, Materialien, Filme, Begleit-DVD. Hamburg: Hamburger Arbeitsassistenz.
Hans Rudolf Leu, Katja Flämig, Yvonne Frankenstein, Sandra Koch, Irene Pack, Kornelia Schneider, Martina Schweiger (2007): Bildungs- und Lerngeschichten. Bildungsprozesse in früher Kindheit beobachten, dokumentieren und unterstützen. Weimar/Berlin: verlag das netz.
John O’Brien, Jack Pearpoint, & Lynda Kahn (2010): The PATH & MAPS Handbook. Person-Centred Ways to Build Community. Toronto: Inclusion Press.
Zukunftsplanung: Portfolio
Das Portfolio bzw. das ICH-Buch des Kindes, eine stärkenorientierte Entwicklungsdokumentation
von Britta Dehn
Waren Sie auch im Kindergarten und haben am Ende Ihrer Kindergartenzeit eine Sammelmappe mit Ihren „Kunstwerken“ als Erinnerung mit nach Hause bekommen? Können Sie sich noch daran erinnern, wie diese Bilder entstanden sind oder haben Sie sonst noch Erinnerungen an diese prägende Zeit? Heutzutage wandeln sich die Sammelmappen von damals immer mehr zu Portfolios, die vom Kind über seine eigene Entwicklung geführt werden.
Woher kommt der Begriff „Portfolio“ und wo findet er Anwendung?
Das Wort Portfolio kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus den Begriffen portare = tragen und folium = Blatt zusammen. Das Portfolio findet überall dort Anwendung, wo Menschen etwas zu einem bestimmten Thema sammeln und in einem Buch, einem Ordner oder einer Mappe bündeln. Bekannt ist das Portfolio unter anderem bei Banken und Börsen, bei Künstlerinnen und Künstlern, im Management und im pädagogischen Bereich.

Das Portfolio im pädagogischen Bereich

Im pädagogischen Bereich wird häufig vom „Buch des Kindes“, dem „ICH-Buch“ oder dem „Ordner des Kindes“ gesprochen. Gerade der Begriff ICH-Buch stärkt das Selbstverständnis des Kindes und macht deutlich, über wen das Portfolio geführt wird. Im fachlichen Austausch und in der Elternarbeit empfiehlt es sich, den Bezug zu dem Begriff Portfolio herzustellen, um es deutlich von der „guten alten“ Sammelmappe zu unterscheiden.
Das Portfolio findet Anwendung in Kindertageseinrichtungen und Schulen und zeigt durch verschiedene Dokumente die Entwicklung eines Kindes auf.
Welche Dokumente kommen in das Portfolio?

Im Portfolio wird im Prinzip all das zusammen getragen, was die Entwicklung und die Lebenswelt des Kindes veranschaulicht. Dies können sein:
- Fotos vom Kind in unterschiedlichen Situationen,
- Kommentare des Kindes zu den Fotos,
- Selbstporträts,
- Kunstwerke des Kindes,
- Seiten über MICH („Das bin ICH“; „So gefällt es mir im Kindergarten“; „So verkleide ich mich bei Fasching“; „Das hat mir in den Ferien gefallen“),
- Seiten über Projekte der Einrichtung,
- Seiten, die von der Familie des Kindes gestaltet werden,
- Briefe an das Kind - geschrieben von den Eltern zu Beginn der Kindergartenzeit oder zwischendurch, geschrieben von den pädagogischen Fachkräften bei Übergängen (Wechsel in eine andere Gruppe, Abschied von der Einrichtung) oder bei schönen Begebenheiten,
- Kinderinterviews,
- gesammelte Objekte wie Eintrittskarten, Postkarten, Prospekte, Mitbringsel aus dem Urlaub etc.,
- Lerngeschichten.
Durch Fotos werden Portfolios anschaulich!

Vergessen geht automatisch, für das Erinnern braucht der Mensch Anlässe. Daher sind Fotos für das Portfolio unerlässlich. Fotos bringen Kinder ab ca. einem Jahr dazu, sich selbst wiederzuerkennen und vertraute Personen und Gegenstände zu entdecken. Mit ca. zwei Jahren können Kinder Anlässe auf den Fotos erkennen und erinnern sich an Begebenheiten, zum Beispiel Geburtstage, Ausflüge, Urlaube. Fotos eignen sich in besonderer Weise, um sich über gemeinsam Erlebtes auszutauschen oder eine Geschichte zu erzählen. Fotos verbinden Menschen.
Wer führt das Portfolio?

Das Kind ist die Autorin bzw. der Autor seines Portfolios – pädagogische Fachkräfte, Familienangehörige sowie Freundinnen und Freunde sind die Co-Autorinnen bzw. -Autoren. Die Co-Autorinnen bzw. -Autoren machen Fotos, schreiben Briefe an das Kind, unterstützen es beim Sammeln von Dokumenten, halten Aussagen des Kindes zu den Fotos fest oder schreiben Lerngeschichten.
Vor allem treten sie in den Dialog mit dem Autorinnen– bzw. Autoren-Kind. Sie besprechen mit dem Kind: Was soll in das Portfolio aufgenommen werden? Warum wird das ausgewählt und was ist am dem ausgewählten Dokument wichtig?
Die Autorinnen und Autoren benötigen von ihren Co-Autorinnen und -Autoren unterschiedlich viel Unterstützung. Diese ist abhängig vom Alter und der Entwicklung des Kindes. Natürlich kann ein Baby oder Kleinkind noch nicht selbst Fotos machen oder Lieblingssachen sammeln oder etwas aufschreiben. Jüngere Kinder sind darauf angewiesen, dass andere ihre Entwicklungsschritte wahrnehmen und in Text und Bild festhalten. Ein Schulkind hingegen kann fotografieren, Dinge sammeln und Texte schreiben. Es kann wesentlich eigenständiger an seinem Portfolio arbeiten und benötigt die Unterstützung seiner Co-Autorinnen und -Autoren nur gelegentlich.
In trauter Zweisamkeit

Für die Arbeit mit dem Portfolio braucht es die richtige Umgebung – vor allem eine ruhige. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem vollen Bus und versuchen Ihrem Gegenüber eine tolle Geschichte zu erzählen. Ständig werden Sie durch ein- und aussteigende Personen gestört und am Ende der Geschichte fragt Ihr Gegenüber: „Was hast Du gesagt?“ Wie frustrierend. Genauso geht es Kindern, wenn ihr Portfolio so nebenbei im Gruppenalltag der Kindertageseinrichtung oder Schule geführt wird. Kinder merken sofort, wenn Erwachsene abgelenkt sind und ihre Aufmerksamkeit überall ist, bloß nicht bei ihnen. Oft fühlen Kinder sich dadurch gekränkt und der Lern-Misserfolg ist: „Ich bin unwichtig.“ Die Auswahl der Dokumente für das Portfolio und das Gespräch darüber sollten daher in ruhiger Umgebung zu zweit stattfinden. Es ist durchaus nicht immer ganz leicht, dies in der Realität umzusetzen, aber sehr lohnenswert.
Portfolio und die Zeit

Ein Portfolio entsteht nicht mal eben so an einem Tag, sondern es wird in einem ständigen Prozess geführt. Da es eine Entwicklungsdokumentation ist, sollte das Portfolio auch parallel zu der Entwicklung des Kindes entstehen. Einen festen Tag in der Woche für die Arbeit mit dem Portfolio einzuplanen, hat sich sehr bewährt. So können die gesammelten Papiere zeitnah in das Portfolio einsortiert werden und das Kind hat den aktuellen Bezug zu den Fotos, seinen Kunstwerken und anderen Portfolio-Dokumenten. [Fotos vom Portfoliotag KEFI]
Das Portfolio ist eine sehr geeignete Grundlage für Gespräche, die pädagogische Fachkräfte und Eltern über die Entwicklung des Kindes führen. Das Kind wird an diesen Gesprächen beteiligt, indem es sein Portfolio den anwesenden Erwachsenen präsentiert und anhand seines Portfolios über seine Entwicklung berichtet.
Das Portfolio gehört dem Kind!

Von Anfang an gehört das Portfolio dem Kind, egal wie viele andere daran mitarbeiten. Durch diese Einstellung ist es selbstverständlich, dass das Kind aktiv an der Gestaltung seines Portfolios beteiligt wird und jederzeit selbstständig das Buch holen, anschauen und gestalten kann. Hierdurch entwickelt das Kind das Bewusstsein, wertgeschätzt und geachtet zu werden. Andere müssen das Kind als Besitzerin oder Besitzer des Portfolios natürlich vorher fragen, ob sie das Buch anschauen dürfen. Und die Entscheidung des Kindes ist zu respektieren.
Weitere schöne Ideen

Neben dem Portfolio gibt es weitere wunderbare Ideen, die auf einfühlsame Weise die pädagogische Arbeit mit dem Kind bereichern. Einige davon sind:
- Die Seite über UNS – neue Familien in der Einrichtung stellen sich vor,
- die Familienmappen,
- "Okeydokeys",
- die "Eine Seite über mich",
- Berichte, Fotos von einer Persönlichen Zukunftsplanung.
Wurzeln & Flügel

Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen, Wurzeln zu fassen.
Sind sie aber groß geworden, müssen wir ihnen Flügel schenken.Indisches Sprichwort
Dieses indische Sprichwort trifft sehr gut auf das Portfolio des Kindes zu. Das Portfolio macht die Stärken und die Lernkompetenzen des Kindes sichtbar. Das Kind erfährt durch den intensiven Kontakt zu seinen Co-Autorinnen und -Autoren Aufmerksamkeit und Zuwendung. Dadurch kann es starke „Wurzeln“ bilden, die tragfähige Beziehungen und Kompetenzen ermöglichen. Zusätzlich helfen die Erfahrungen mit dem Portfolio dem Kind, sich den Anforderungen der großen weiten Welt zu stellen.
Weitere Literatur zum Thema
Berger, Lasse und Marianne (Hrsg. und Übersetzer der deutschen Ausgabe). Portfolio in Vorschule und Schule. Bremen; 2007. Bestellbar unter der E-Mail-Adresse: berger_LM@web.de
Bostelmann, Antje (Hrsg.): Das Portfolio-Konzept für Kita und Kindergarten. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr; 2007
Bostelmann, Antje (Hrsg.): Das Portfolio-Konzept für die Krippe. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr; 2008
Fthenakis, Wassilios E. (Hrsg.): Portfolios im Elementarbereich. Natur-Wissen schaffen. Troisdorf: Bildungsverlag EINS; 2009
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.): Bildung sichtbar machen. Von der Dokumentation zum Bildungsbuch. Weimar/Berlin: verlag das netz; 2004
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.): Das Bildungsbuch im Dialog. Weimar/Berlin: verlag das netz; 2004
Groot-Wilken: Portfolioarbeit leicht gemacht. Leitfaden zur systematischen Dokumentation von Bildungsverläufen in Tageseinrichtungen. Berlin: Cornelsen Verlag Sciptor; 2008
Jacobs, Dorothee: Kreative Dokumentation. Dokumentationsmodelle für Kindertageseinrichtungen. Berlin: Cornelsen Verlag Sciptor; 2007
Kazemi-Veisari, Erika: Kinder verstehen lernen. Wie Beobachten zur Achtung führt. Seelze: Kallmeyer Verlag; 2004
Krok, Göran und Lindewald, Maria: Portfolios im Kindergarten. Das schwedische Modell. Lernschritte dokumentieren, reflektieren, präsentieren. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr; deutsche Ausgabe 2007
Der PARITÄTISCHE Gesamtverband (Hrsg.): Beobachtung und Dokumentation. Arbeitshilfe für Kitas im Paritätischen. Berlin; 2008. Erhältlich auf der Website „Der Paritätische Gesamtverband“ ( www.der-paritaetische.de)
Ministerium für Bildung, Familie. Frauen und Kultur des Saarlandes (Hrsg.): Das Portfolio im Kindergarten. Ein Entwicklungstagebuch, geführt vom Kind und seinen Bildungsbegleitern. Autorin u. a. Donata Elschenbroich. Mit DVD. Weimar/Berlin: verlag das netz; 2008
Die Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales(Hrsg.): Bremer Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation (PDF, 7,2 MB, nicht barrierefrei) Freie Hansestadt Bremen; 2. Auflage 2010.
Zukunftsplanung: Unterstützungskreis
Unterstützungskreise – ich bin nicht alleine…
von Stefan Doose
Was ist ein Unterstützungskreis?
Ein Unterstützungskreis besteht aus Menschen, die eine Person bei ihrer Zukunftsplanung unterstützen wollen. Dies können Familienmitglieder, Freundinnen, Freunde, Bekannte, Erzieherinnen und Erzieher, Fachleute, aber auch andere Kinder sein
Wie finde ich die passenden Personen für den Unterstützungskreis?
“Willst du schnell gehen, geh allein.
Willst du weit kommen, geh gemeinsam mit anderen.”
Sprichwort aus Kenia
Viele haben zunächst Hemmungen, andere Menschen um Unterstützung zu fragen. Aber viele Menschen empfinden es als Ehre, dabei zu sein und ihren Beitrag leisten zu können. Also trauen Sie sich ruhig, alle Menschen anzusprechen, von denen Sie denken, dass sie hilfreich sein könnten.
Dabei können Menschen auf ganz verschiedene Arten und Weisen hilfreich sein: Einige haben viele Ideen und großes Fachwissen. Andere sind uns emotional nahe und unterstützen uns in schwierigen Situationen moralisch. Wieder andere können gut anpacken, wenn es darauf ankommt, oder kennen andere Menschen in der Region. Es kommt also auf die richtige Mischung an. Ergebnisse aus der Netzwerkforschung zeigen übrigens, dass wir neue Ideen und Verbindungen über Leute bekommen, die wir oft nur locker kennen. Der Unterstützungskreis muss sich also nicht auf die engsten Vertrauten beschränken, sondern lebt davon, andere offene, ideenreiche und engagierte Menschen einzubeziehen.
Mitunter können oder wollen nicht immer alle zum Unterstützungskreis eingeladenen Personen kommen. Seien Sie nicht traurig über die, die nicht da sind, sondern freuen Sie sich über die, die kommen. Manche Unterstützungskreise bestehen aus 16 Personen und mehr, manche aus einer Handvoll Leuten. Die Anzahl ist nicht das entscheidende Kriterium. Manchmal bildet sich im Laufe der Zeit eine Kerngruppe heraus, die immer kommt. Daneben gibt es Personen, die zu bestimmten Treffen und Themen hinzustoßen. Egal wie groß der Kreis ist - von einem echten Unterstützungskreis kann eine große Kraft ausgehen.
Die Methoden Kreise wichtiger Menschen oder Meine Verbindungen
in der rechten Spalte können Ihnen helfen, mit der planenden Person Unterstützerinnen und Unterstützer für den Unterstützungskreis zu identifizieren.
Welche Aufgaben kann ein Unterstützungskreis haben?
Planende Person stärken, ermutigen und unterstützen
Der Unterstützungskreis hat die Aufgabe, die planende Person und ihre Familie bei der Zukunftsplanung zu stärken, zu ermutigen und zu unterstützten – sowohl beim Sammeln von Ideen, beim Schmieden eines Plans als auch bei der konkreten Realisierung von Vorhaben.
Lebendiges Bild von der planenden Person mit ihren Stärken und Möglichkeiten bekommen
Eine der ersten Aufgaben ist es, ein gutes Bild von der planenden Person und ihrer Situation zu bekommen und zusammenzutragen, wer die planende Person ist, was sie ausmacht, was ihr wichtig ist und was sie benötigt, damit es ihr gut geht.
Vision von einer guten Zukunft der Hauptperson entwerfen
Eine weitere Aufgabe ist es, ein lebendiges Bild von einer guten Zukunft zu entwerfen: Wie können wir beispielsweise eine gute Situation im Kindergarten, in der Schule, im Freizeitbereich oder in der Familie schaffen? Diese Vision sollte sich auf einen nicht allzu fernen Zeitpunkt, beispielsweise ein bis fünf Jahre, beziehen und mit möglichst vielen wichtigen Details versehen sein. Unsere Seele denkt in Bildern und diese Zukunftsbilder entwickeln oft eine erstaunliche Sogwirkung für positive Veränderungen, auch wenn es dann im Detail anders kommen darf.
„Vision als eine Art, zu sehen was geht, zu sehen was sein könnte.“
Anonymus
Konkrete Ziele der planenden Person für die nächste Zeit herausfinden
Eine wichtige Aufgabe des Unterstützungskreises ist es, konkrete Ziele für die nächste Zeit zu identifizieren. Dabei geht es um Ziele, die für die planende Person bedeutsam sind, die sie begeistern und sie zur Teilhabe in der Gemeinschaft führen. Jede Person sollte, soweit es ihr in ihrer Entwicklung schon oder noch möglich ist, die Ziele selbst mitbestimmen können.
„Erfolgreich zu sein, setzt zwei Dinge voraus:
klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen.“
Johann Wolfgang von Goethe
Die Umsetzung der Ziele mit einem Aktionsplan planen
Eine zentrale Aufgabe des Unterstützungskreises ist es nun, zu überlegen, was konkret von wem getan werden muss, um diese Ziele zu erreichen. Hieran können sich alle Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligen, indem sie konkrete Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten übernehmen.
Umsetzung der Zukunftsplanung reflektieren, Probleme lösen
Im weiteren Verlauf muss die Umsetzung der Zukunftsplanung reflektiert werden, bei Bedarf müssen auftretende Probleme gelöst und vor allem erreichte Ziele gemeinsam gefeiert werden!
„Gemeinsam Knoten lösen, um neue Verknüpfungen zu finden.“
Ulrike Lotz-Lange
Zur Reflexion eignet sich die Methode 4 + 1 Frage gut.
Welche Rollen gibt es im Unterstützungskreis?
Hauptperson bzw. planende Person
Die wichtigste Rolle spielt natürlich die Hauptperson. Sie überlegt sich, wer eingeladen wird und welche Themen behandelt werden. Sie lädt ein und bereitet sich auf die Themen vor. Sie ist Gastgeberin, legt den Ort und den Rahmen fest (zum Beispiel: Soll es Getränke und Snacks geben?) und bittet andere - wenn nötig - um Unterstützung bei der Vorbereitung.
Bei Kindern muss natürlich vorher überlegt werden, wie sie einbezogen werden können. Kindergartenkinder können teilweise an der Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wie auch bei der Vorbereitung der Snacks und Getränke mithelfen. Sie können vielleicht etwas für die Einladung malen oder gestalten.
Schon vor dem ersten Treffen können Aktivitäten der Zukunftsplanung durchgeführt werden, deren Ergebnisse beim Treffen präsentiert werden. Das Kind kann beispielsweise zu bestimmten Fragen interviewt werden. Schulkinder können schon mehr mitbestimmen und häufig auch schon schreiben. Manchmal sind aber auch Familien die eigentlich Planenden, weil sie Unterstützung in der Gestaltung der Zukunft ihres Kindes brauchen. Auch das ist in Ordnung, solange die Mitwirkungsmöglichkeiten des Kindes ausreichend berücksichtig werden.
„Meine Zukunftsplanung war wie ein Motor. Alle, die mitgemacht haben, haben dadurch ganz viel Energie bekommen.“
Aussage einer Planenden
Eine Person, die moderiert
Eine gute, möglichst außenstehende Moderation ist wichtig für einen Unterstützungskreis. Die Person sollte erfahren in der Moderation von Gruppen sein. Sie übernimmt die Gesprächsführung des Kreises und sorgt dafür, dass alle zu Wort kommen. Sie legt mit der Gruppe vorher Gesprächsregeln fest und sorgt für eine wertschätzende Atmosphäre. Sie achtet darauf, dass die Hauptperson nicht aus dem Blick gerät und sich in einer ihrer Entwicklung gemäßen Form beteiligen kann.
In der Rechten Spalte finden Sie Texte und Literaturtipps zur Moderation von Unterstützungskreisen.
Eine Person, die zeichnet und schreibt
Ein Unterstützungskreis sollte am besten zu zweit moderiert werden. Die Person, die zeichnet und schreibt, sorgt dafür, dass die Ergebnisse in Bildern und Worten auf großen Papieren an der Wand oder am Boden festgehalten werden. Unsere Seele denkt in Bildern! Nicht nur für Kinder und Personen, die nicht lesen können, sind Bilder hilfreich, sondern für alle Menschen. Die Aufgabe der zeichnenden und schreibenden Person ist es, mit der Hauptperson und dem Unterstützungskreis die passenden Bilder zu finden. Es kommt nicht auf die Perfektion an, obwohl sich immer wieder Menschen mit wunderbaren Fähigkeiten zum Zeichnen und Schreiben finden lassen.
In der Rechten Spalte finden Sie einen Text und Literaturtipps zur grafischen Gestaltung in Unterstützungskreisen.
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“
Agent und Agentin
Der Agent oder die Agentin unterstützt die Hauptperson bei der Umsetzung der Pläne. Gemeinsam halten sie den roten Faden in der Hand. Der Agent oder die Agentin fragt bei den Unterstützerinnen und Unterstützern nach, was aus ihren zugesagten Aktivitäten geworden ist. Nicht das Treffen und der Plan sind schließlich entscheidend, sondern die Umsetzung. Erfahrungsgemäß braucht es mitunter Erinnerung oder anderweitige Unterstützung, damit die Vorhaben nicht im Sande verlaufen. Eine Agentin oder ein Agent ist selbst Teil des Unterstützungskreises und kann zum Beispiel am Ende des ersten gemeinsamen Treffens benannt werden. Meist wählt die Hauptperson selbst aus, wen sie sich als Agentin oder Agenten wünscht. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, zwei Agenten zu bestimmen: einen Agenten des Herzens, der die Hauptperson emotional unterstützen kann, und einen professionellen Agenten, der sich im Hilfesystem auskennt.
Unterstützerinnen und Unterstützer
Die Unterstützerinnen und Unterstützer bringen ihre guten Ideen bei der Planung und Umsetzung ein. Sie bieten moralische oder konkrete Unterstützung bei der Umsetzung der Zukunftspläne und übernehmen Aufgaben. Unterstützerinnen und Unterstützer sollten freiwillig im Unterstützungskreis sein. Sie sollten eine wertschätzende Grundhaltung mitbringen und von der Hauptperson als unterstützend und stärkend erlebt werden. Ist dies nicht der Fall, kann ihre Teilnahme kontraproduktiv sein.
„Wir haben aufgehört zu fragen, was schief gelaufen ist
und wie wir es reparieren können. Stattdessen fragen wir:
Welche Möglichkeiten gibt es hier und wer kümmert sich.“
Martin Weisbord
Wie lange dauert ein Treffen des Unterstützungskreises und wie häufig trifft er sich?
Die Dauer der Treffen unterscheidet sich nach Anlass, Möglichkeiten, gewählten Methoden und dem Durchhaltevermögen der planenden Person und des Unterstützungskreises. Manche Treffen dauern anderthalb bis zwei Stunden, andere drei bis vier Stunden mit Pausen am Vormittag, Nachmittag oder Abend, wieder andere wie zum Beispiel Ines Boban veranstalten Zukunftsfeste, die einen ganzen Tag dauern. Dies kann Sinn machen, wenn man die Methoden MAPS und PATH an einem Tag machen möchte und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unterstützungskreises einen langen Anfahrtsweg haben. Wichtig ist natürlich, dass es zwischendurch ausreichend Pausen und Stärkung für die Teilnehmenden gibt.
Auch die Häufigkeit der Treffen des Unterstützungskreises hängt von der Situation der planenden Person und den Möglichkeiten der Beteiligten ab. Manchmal trifft sich ein großer Kreis zu einem Planungstreffen einmal und die Hauptperson kümmert sich gemeinsam mit den Agenten oder den Agentinnen um die Umsetzung des Planes. Der Unterstützungskreis trifft sich dann erst nach einem Jahr in großer Runde wieder. Häufig treffen sich die Unterstützungskreise regelmäßig, zum Beispiel viermal im Jahr; in schwierigen Phasen kann ein Treffen aber auch alle vier bis sechs Wochen notwendig sein.
Wie kann ein Unterstützungskreis gut vorbereitet werden?
Die Treffen des Unterstützungskreises sollten gut vorbereitet sein.
Die Hauptperson sollte soweit es ihr möglich ist an der Vorbereitung der Themen und der Einladung beteiligt sein. Vielleicht kann sie etwas vorbereiten, das für das Treffen und das Thema bedeutsam ist: Sie kann beispielsweise Dinge, die sie mag, mitbringen oder ein Profilplakat mit Dingen erstellen, die sie gerne macht (zum Beispiel in Form eines Körperumrisses).
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten persönlich eingeladen werden und bereits mit der Einladung erfahren, worum es geht und was einen guten Unterstützungskreis ausmacht.
Das Treffen sollte an einem angenehmen, einladenden Ort stattfinden, an dem sich die Hauptperson wohl fühlt, der genügend Raum bietet und an dem man nicht gestört wird. Platz an den Wänden für Plakate oder Stellwände ist hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.
Ausdrucksstarke Fotos aus dem Leben der planenden Person können beispielsweise aufgehängt oder in der Mitte des Stuhlkreises um eine Kerze gelegt werden. Auch selbst gemalte Bilder oder andere Dinge zeigen, was sie erlebt hat, was ihr wichtig ist und sie ausmacht. Einem Fußballfan ist anderes wichtig als einer Fee oder einem Tierfreund.
Es kann Getränke und einen kleinen Imbiss geben. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Unterstützungskreises bringen bestimmt gerne etwas mit.
Ein Lied, das die Person gerne mag und vielleicht in einer Beziehung zur Zukunftsplanung steht, zu Beginn kann eine gute und offene Atmosphäre schaffen. Wichtig ist, dass das Treffen zum „Heimspiel“ für die Hauptperson wird. Alle Beteiligten sollen sich wohlfühlen und Spaß an der Sache haben, auch und gerade wenn es in der Zukunftsplanung um ernste Dinge geht.
„Wer schaffen will, muss fröhlich sein“
Theodor Fontane
Welche Methoden oder Planungsformate kann ein Unterstützungskreis nutzen?
Es gibt viele Methoden, das Treffen mit einem Unterstützungskreis zu gestalten. Die bekanntesten sind: die Persönliche Lagebesprechung, MAPS und PATH.
Die Persönliche Lagebesprechung wurde von Helen Sanderson als personenzentrierte Alternative zu einer Hilfeplanung entwickelt. Mit ihr kann man sich einen Überblick über die aktuelle Situation verschaffen, wichtige Themen herausfiltern und erste Schritte planen. Die Lagebesprechung kann abgewandelt auch für Gruppen, beispielsweise Klassen, Teams oder Familien, genutzt werden. Mehr über diese Methode erfahren Sie unter Persönliche Lagebesprechung.
MAPS wurde von Marscha Forrest und Jack Pearpoint entwickelt. MAPS stand zunächst als Abkürzung für „Making Action Plans“ – „Aktionspläne machen“, wird aber heute von Forrest und Pearpoint nur noch in der Kurzform benutzt. Das englische Wort „map“ bedeutet auch Landkarte, die zur Orientierung genutzt werden kann. Bei MAPS geht es darum, die Geschichten der Person, ihre Träume und Albträume sowie ihre Gaben wahrzunehmen und zu erkunden. Anschließend wird gemeinsam erarbeitet, wie sich die Person in die Gemeinschaft einbringen kann und welche Schritte jetzt für sie wichtig sind. Mehr über diese Methode erfahren Sie unter MAPS.
PATH wurde von Jack Pearpoint, John O‘Brien und Marscha Forrest Anfang der 90er-Jahre entwickelt. PATH stand zunächst als Abkürzung für „Planning Alternatives Tomorrows with Hope“ – frei übersetzt „ein anderes Morgen mit Hoffnung planen“, wird aber heute von Pearpoint, O‘Brien und Forrest nur noch in der Kurzform benutzt. Das englische Wort „path“ bedeutet auch Weg. PATH eignet sich für Personen, die eine Vorstellung davon haben, wie die Situation in Zukunft sein soll, aber den Weg dorthin noch klären müssen. Der PATH-Prozess setzt an den gemeinsamen Werten und Visionen der planenden Person und ihres Unterstützungskreises an, zeichnet eine wünschenswerte Zukunft. Er beschreibt die gegenwärtige Situation, sucht dann Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Stärkungsmöglichkeiten für den Weg, beschreibt wichtige Zwischenschritte und endet mit einem konkreten Aktionsplan für den nächsten Monat. Der PATH-Prozess kann sowohl für einzelne Personen, Familien und Projekte als auch für Organisationen genutzt werden. Mehr über diese Methode erfahren Sie unter PATH.
Weitere Informationen und Materialien
zum Thema Persönliche Zukunftsplanung (www.persoenliche-zukunftsplanung.de).
Vertiefende Literatur zum Thema Unterstützungskreise
Ines Boban: Moderation Persönlicher Zukunftsplanung in einem Unterstützungskreis - "You have to dance with the group!", auf der Website bidok.
Stefan Doose (2008): Moderation. Wie können Zukunftsplanungstreffen und Unterstützungskreise moderiert werden? In: Orientierung, H.1, 31-35.
Susanne Göbel (2010): „Punkt, Punkt, Komma, Strich – Ein Bild wird es sicherlich!“ Graphische Darstellung als wichtiges Element der Persönlichen Zukunftsplanung. Mainz.
John O’Brien, Jack Pearpoint & Lynda Kahn (2010) : The PATH & MAPS Handbook. Person-Centred Ways to Build Community. Toronto: Inclusion Press.
Zukunftsplanung: Persönliche Lagebesprechung
Persönliche Lagebesprechung – was läuft gut, was nicht?
von Stefan Doose
Was ist eine Persönliche Lagebesprechung?
Die Persönliche Lagebesprechung ist ein personenzentriertes Planungsformat. Sie eignet sich gut dazu, einen schnellen Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen, wichtige Themen herauszufiltern und erste Schritte zu planen. Die Stärke dieser Methode besteht darin, dass mit ihrer Hilfe die Situation aus verschiedenen Perspektiven erfasst wird, beispielsweise aus der des Kindes, der Familie oder der von Fachkräften.
Die Persönliche Lagebesprechung wurde von Helen Sanderson als personenzentrierte Alternative zu einer Hilfeplanung entwickelt. Sie kann mit der planenden Person in einem Unterstützungskreis oder mit einer Gruppe von Personen durchgeführt werden. Die Lagebesprechung kann abgewandelt auch für Klassen, Teams oder als Familienlagebesprechung genutzt werden.
Der Prozess wird von einer Person moderiert. Gut ist eine zweite Person, die schreibt und gegebenenfalls kleine Zeichnungen hinzufügt.
Wie ist eine Persönliche Lagebesprechung aufgebaut?
Die Persönliche Lagebesprechung besteht aus neun Elementen, die auf neun Plakaten zusammengetragen werden. Diese Plakate werden im Raum aufgehängt. Die Lagebesprechung dauert mindestens anderthalb bis zwei Stunden.
Steht diese Zeit nicht zur Verfügung, kann man auch die kürzere Version mit nur sechs Fragen wählen. Mit dieser Version kann man herausfinden, was zurzeit gut läuft und was nicht, und anschließend die verschiedenen Perspektiven aufzeigen. Sie dauert mindestens eine Stunde.
Der Prozess gliedert sich in drei Phasen (nach Sanderson/Mathiesen):
- Ankommen und orientieren,
- Ideen zusammentragen,
- Aktionsplan erstellen.
Phase 1: Ankommen und Orientieren
Der Moderator oder die Moderatorin begrüßt gemeinsam mit der Hauptperson die Teilnehmenden des Unterstützungskreises und erläutert die Ziele sowie den Ablauf der Persönlichen Lagebesprechung. Im Raum hängen die vorbereiteten Plakate:
Plakat 1: "Wer ist da?"
Am Anfang stellen sich alle vor und sagen, in welcher Beziehung sie zur planenden Person stehen (Mutter, Lehrerin, Freund,…). Alle tragen sich auf dem Willkommensplakat "Wer ist da?" ein.
Plakat 2: "Gesprächsregeln"
Jetzt bespricht die Moderation mit der planenden Person und der Gruppe die Gesprächsregeln für das Treffen. Sie werden gut sichtbar auf dem Plakat "Gesprächsregeln" aufgeschrieben.
Dies können Dinge sein wie:
- zuhören und ausreden lassen,
- wertschätzend miteinander umgehen,
- Vertraulichkeit des Gesagten,
- Leichte Sprache,
- Rechtschreibfehler sind in Ordnung,
- jede und jeder sorgt dafür, dass die Dinge, die sie oder ihn beschäftigen, eingebracht werden,
- alle Beiträge sind wertvoll,
- es gibt keine dummen Fragen,
- Handys aus- oder stummschalten.
Plakat 3: "Was wir an… (Name) schätzen und mögen"
Die Moderation bittet die Teilnehmenden des Unterstützungskreises, zu sagen, was sie an der planenden Person schätzen und mögen. Welche Gaben, Stärken und Fähigkeiten hat die Person? Was bringt sie positiv in die Welt, was sonst nicht da wäre? Die Aussagen werden auf einem Plakat festgehalten und können durch kleine Zeichnungen ergänzt werden.
Phase 2: Ideen zusammentragen
Die Moderation erläutert die noch ausstehenden Plakate (Plakat 4 bis 8) mit ihren Überschriften. Danach nehmen sich alle einen Stift in der Farbe ihrer Wahl und schreiben oder malen zu jedem Thema das, was ihnen einfällt und wichtig ist. Diese Phase dauert etwa 20 Minuten. Wenn die Hauptperson dies möchte, kann im Hintergrund leise Musik ihrer Wahl gespielt werden. Etwas beschwingte, anregende Musik eignet sich dafür gut.
Es muss sichergestellt werden, dass Personen, die nicht schreiben können, jemanden haben, der ihnen die Punkte vorliest und etwas für sie aufschreibt. Sie können natürlich auch malen.
Die Moderation geht während dieser Phase im Raum umher, ermuntert alle und klärt Fragen. Sie verschafft sich einen ersten Überblick über die Plakate.
Plakat 4: "Was läuft gut? Was läuft nicht gut?"
Dieses Plakat ist zentral für die Persönliche Lagebesprechung. Hier schreiben die Teilnehmenden aus ihren unterschiedlichen Perspektiven auf, was ihrer Meinung nach im Leben der Hauptperson gut und was nicht gut läuft.
Dazu wird entweder ein großes Plakat in verschiedene Abschnitte unterteilt (Sichtweise der Hautperson, Sichtweise der Familie, der Fachleute etc.) oder für jede Sichtweise ein eigenes Plakat verwendet.
Plakat 5: "Offene Fragen – Probleme, die gelöst werden müssen"
Auf dieses Plakat können noch offene Fragen geschrieben werden.
Das können Fragen sein,
- zu denen noch weitere Informationen gesammelt werden müssen,
- zu denen es unterschiedliche Einschätzungen gibt,
- bei deren Beantwortung andere Personen einbezogen werden müssen.
Diese Fragen werden anschließend bei der Aktionsplanung aufgegriffen.
Unterschied zwischen den Planungsvarianten
Wenn Sie die Kurzversion der Persönlichen Lagebesprechung gewählt haben, kommen Sie nun zur Phase der Aktionsplanung.
In der ausführlichen Version folgen noch drei Plakate. Sie bauen auf anderen Methoden personenzentrierten Denkens von Helen Sanderson auf. Hier wird beispielsweise zwischen Dingen, die einer Person wichtig sind, und Dingen, die für sie wichtig sind um gesund und sicher zu sein, unterschieden. Zudem werden die Zukunftsträume thematisiert.
Plakat 6: "Was ist… (Name) jetzt wichtig?"
Auf diesem Plakat werden Dinge zusammengetragen, die der Hauptperson zurzeit im Leben wichtig sind. Was soll in ihrem Leben unbedingt vorkommen, was vermieden werden? Es kann dabei um die Beziehungen zu anderen Menschen, um den Tages- und Wochenablauf oder um positive Routinen gehen.
Soweit möglich, sollten die Äußerungen der Hauptperson auf dieses Plakat geschrieben werden; wenn nötig wird sie von anderen, die für sie schreiben oder malen, unterstützt. Ist dies nicht möglich, kann man Äußerungen oder Verhaltensweisen der Person aufschreiben.
Die Sichtweise der Hauptperson soll auf dem Plakat notiert werden, nicht die der Unterstützerinnen und Unterstützer!
Plakat 7: "Was ist… (Name) in Zukunft wichtig?"
Dieses Plakat fängt die Wünsche, Zukunftsträume und Ziele der Hauptperson ein. Was wünscht sie sich? Wie soll ihr Leben in Zukunft aussehen?
Auch dieses Plakat sollte - soweit möglich - die Perspektive der Hauptperson widerspiegeln. Die Plakate können schon vor dem Treffen vorbereitet werden, sodass die Hauptperson etwas mitbringen und aufhängen kann, beispielsweise selbst gezeichnete Bilder, Fotos, Collagen.
Sollte die Person entwicklungsgemäß noch keinen Begriff von Zukunft haben, können auch die Wünsche und Träume der engsten Vertrauten für die Zukunft des Kindes notiert werden.
Plakat 8: "Was braucht… (Name), um gesund und sicher zu sein?"
Auf diesem Plakat können die Anwesenden Dinge eintragen, die für die Gesundheit und Sicherheit der Hauptperson wichtig sind. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit sie die Dinge tun kann, die ihr wichtig sind? Wer muss um diese Voraussetzungen wissen, damit er oder sie die Hauptperson angemessen unterstützen kann? Dies ist besonders bei Menschen mit chronischen Erkrankungen oder einer Behinderung wichtig.
Phase 3: Aktionsplanung
Die Moderation bittet die Teilnehmenden nach etwa 20 Minuten, wieder Platz zu nehmen. Jetzt werden die Ergebnisse zusammen gesichtet. Dabei wird mit dem Plakat "Was läuft gut und was läuft nicht gut" und den offenen Fragen begonnen, anschließend werden die anderen Plakate besprochen und Verständnisfragen gemeinsam geklärt.
Dann sollten sich die Anwesenden schnell einigen, welche Punkte beim Erstellen des Aktionsplans berücksichtigt werden sollen. Gibt es viele Themen, können die Teilnehmenden mit drei Klebepunkten die wichtigsten markieren. Die Klebepunkte der Hauptperson können eine andere Farbe haben, um sicherzustellen, dass ihre Themen auf jeden Fall Beachtung finden.
Plakat 9: "Aktionsplan"
Auf dem letzten Plakat wird festgehalten, wer was bis wann tut. Hier geht es darum, mit der Hauptperson und dem Unterstützungskreis die nächsten Schritte konkret festzuhalten.
Dies können zum einen Schritte sein, die verbessern, was zurzeit nicht gut läuft, oder die offene Fragen klären. Es können aber auch Schritte sein, die dazu beitragen, dass das, was gut läuft, weiterhin gut läuft. Dabei müssen die Punkte der Hauptperson berücksichtigt werden, es geht schließlich um die Verbesserung ihres Lebens. Die Schritte sollten konkret formuliert sein, alle Beteiligten müssen wissen, was zu tun ist.
Gemeinsam wird eine Person gesucht, die die Persönliche Lagebesprechung dokumentiert und den Aktionsplan an alle Beteiligten schickt. Manchmal müssen auch noch weitere Personen informiert werden.
Außerdem sollte mindestens eine Person festgelegt werden, die für die Umsetzung des Aktionsplans verantwortlich ist. Im Unterstützungskreis wird diese Rolle auch als Agent oder Agentin bezeichnet. Die Hauptperson sollte - soweit möglich und sinnvoll - in die Umsetzung des Aktionsplans einbezogen werden und diesen unterstützen.
Aus der Persönlichen Lagebesprechung kann sich auch der Bedarf einer umfassenderen Aktionsplanung ergeben, die zum Beispiel mit einem PATH-Prozess gestaltet werden kann.
Abschluss des Treffens
Am Ende der Persönlichen Lagebesprechung bittet die Moderation die Teilnehmenden, folgende Fragen zu beantworten: Was ist an dem Prozess gut gelaufen, was nicht? Was könnte das nächste Mal besser gemacht werden?
Was benötigt man für eine Persönliche Lagebesprechung?
- Der Prozess sollte mindestens von einer Moderatorin oder einem Moderator begleitet werden. Wünschenswert ist eine zweite Person, die schreibt und kleine Zeichnungen hinzufügt.
- Man benötigt ein bis zwei Stunden Zeit.
- Der Raum sollte groß genug für die Gruppe sein und Platz für die Plakate (z. B. Flipchart-Papiere) an Wänden oder Stellwänden bieten. Die Teilnehmenden sitzen möglichst im Halbkreis oder im doppelten Halbkreis.
- Papier und Stifte in verschiedenen Farben, die nicht durch das Papier drücken, sollten in ausreichender Menge vorhanden sein.
- Einen CD-Player, um von der Person ausgewählte Musik oder anregende Hintergrundmusik zu spielen, sowie
- Getränke und kleine Snacks nach Wahl sind ebenfalls sinnvoll.
Weitere Informationen und Materialien zum Thema
Persönliche Lagebesprechung (in Englisch)
Sanderson, Helen & Mathiesen, Ruth: Person Centred Reviews (PDF, 357 KB, nicht barrierefrei) Stockport: HSA Press.
Eine Variation ist die Familienlagebesprechung, deren Fragen sie in der Rechten Spalte finden.
Diese und weitere Methoden personenzentrierten Denkens finden Sie in
Helen Sanderson & Gill Goodwin (Hrsg.) (2010): Minibuch Personenzentriertes Denken. Deutsche Übersetzung Stefan Doose, Susanne Göbel, Oliver Koenig. HSA The Learning Community: Stockport: Personen-zentriertes Denken (PDF, 339 KB, nicht barrierefrei)
Dieses Heft kann auf der Website "Persönliche Zukunftsplanung" bestellt werden.
Zukunftsplanung: MAPS
MAPS
von Stefan Doose
Was ist MAPS?
MAPS ist ein Planungsprozess mit einem Unterstützungskreis für Personen, bei denen sich eine Veränderung ankündigt, wie zum Beispiel das Verlassen des Kindergartens, der Beginn an einer neuen Schule oder der Schulabschluss bei Kindern und Jugendlichen.
Bei MAPS geht es darum, die Geschichte der Person, ihre Träume und Albträume sowie ihre Gaben zu erkunden, um dann zu sehen, was sie benötigt, um ihre Gaben in die Gemeinschaft einbringen zu können. Die planende Person und die Menschen, die sich ihr verbunden fühlen, vergewissern sich der Gaben der Person und dessen, was in ihrem Leben wirklich wichtig ist. Erst danach geht es an die konkrete Handlungsplanung.
Bei Kindern sind es oft die Familien, die einen MAPS-Prozess für das Kind machen. Das Kind ist die Person, die im Blickpunkt steht, aber die Eltern bzw. die Familie planen. Das Kind und seine Sichtweise sollten soweit wie möglich einbezogen werden.
MAPS wurde von Marscha Forrest und Jack Pearpoint in den 80er-Jahren in den USA entwickelt. MAPS stand zunächst als Abkürzung für „Making Action Plans“ – „Aktionspläne machen“ -, wird aber heute von Forrest und Pearpoint nur noch in der Kurzform benutzt. Das englische Wort „map“ bedeutet auch Landkarte, die zur Orientierung genutzt werden kann. MAPS umfasst sechs Schritte, die auf einem großen Plakat grafisch festgehalten werden können (nach O’Brien, Pearpoint, Kahn 2010):
Dieses Überblicksplakat erhalten Sie als DIN-A-4-Übersicht in der Rechten Spalte.
Was sind die Schritte bei MAPS?
Begrüßung und Vorstellung
Jede Person im Unterstützungskreis stellt sich vor und beantwortet die Frage „Warum ist es mir wichtig, heute hier zu sein?“. Die Moderatorin oder der Moderator und die Person, die zeichnet, malt und schreibt, stellen sich vor und erläutern ihre Rolle und den Ablauf des Prozesses sowie die Gesprächsregeln.
1 Die Geschichte
Es werden drei Geschichten aus dem Leben der im Mittelpunkt stehenden Person erzählt, die etwas mit den aktuellen Veränderungen zu tun haben. Zwei Geschichten sollen aus der Vergangenheit kommen, eine aus der Gegenwart. In der Regel erzählt die Person die Geschichten selbst, bei kleinen Kindern erzählen die Eltern oder Vertraute die Geschichten. Die anderen Personen hören genau zu. Die Person, die zeichnet und malt, macht sich derweil Notizen und erste Skizzen. Nachdem die Geschichten erzählt wurden, fasst sie anhand ihrer Notizen jede Geschichte zusammen und fragt die planende Person, wie das Bild auf dem Plakat gezeichnet werden soll. Sie zeichnet es entsprechend den Vorgaben.
2 Der Traum
Die planende Person wird aufgefordert, zu schildern, wie ihr Traum aussieht.
„Was ist mein Traum? Was möchte ich wirklich im Leben?“
Die zeichnende Person entwickelt mit der planenden Person ein passendes Bild für ihren Traum. Dabei fragt sie gegebenenfalls nach, wie der Traum genau aussieht oder was das Wichtigste daran ist. Bei kleineren Kindern kann neben dem Traum des Kindes (wenn er zu erkunden ist), auch der Traum der Eltern für ihr Kind im Vordergrund stehen, da die Eltern die eigentlich planenden Personen sind. Sie sind wie eine Fee oder ein Zauberer, die gute Wünsche für das Kind haben. Am Ende fragt die Moderatorin oder der Moderator die planende Person, welche Gaben, Stärken und Fähigkeiten von ihr in dem Traum deutlich werden. Alle anderen hören weiterhin aufmerksam zu.
3 Der Albtraum
Der Albtraum steht für die schlimmste Möglichkeit, die für die planende Person eintreten könnte. Er drückt das aus, was zutiefst unerwünscht ist. Der Albtraum soll genannt, aber nicht im Gespräch vertieft werden. Die zeichnende Person sucht mit der planenden Person ein einfaches Bild für den Albtraum mit wenigen Worten.
4 Die Gaben
Gaben sind Stärken und Fähigkeiten, die uns gegeben sind, damit wir anderen etwas geben können. Der Unterstützungskreis ist nun an der Reihe, über die Gaben der Person nachzudenken. Dann werden mithilfe des Unterstützungskreises die Schlüsselbegriffe aus der Sammlung herausgesucht und in den Pfeil um den Kreis herum eingetragen (siehe Bild). Zum Schluss erstellt die zeichnende Person mit der planenden Person noch ein passendes Bild, das ihre Gaben symbolisiert. Dies kommt in den Kreis.
5 Was braucht es?
Jetzt geht es darum herauszufinden, welche Bedingungen notwendig sind, damit die planende Person ihre Gaben bestmöglich einbringen kann, zum Beispiel im Kindergarten oder einer neuen Schulklasse. Sie wird von der Moderatorin bzw. dem Moderator gefragt, was sie tun könnte, um ihre Gaben besser zur Geltung zu bringen.
Die zeichnende Person fängt Schlüsselbegriffe auf und malt schnelle Bilder dazu. Sie clustert diese, indem sie ähnliche Begriffe beieinander schreibt bzw. malt. Bei den besonders wichtig erscheinenden Bedingungen fragt die Zeichnerin die planende Person nach Details für das Bild.
6 Der Aktionsplan
Die Moderation bittet zum Abschluss die Teilnehmenden des Unterstützungskreises, an die notwenigen nächsten Handlungsschritte zu denken:
- Menschen, die informiert und einbezogen werden müssen,
- Möglichkeiten, nach denen gesucht werden soll,
- Veränderungen, die ausgehandelt werden müssen.
Die schreibende Person notiert die Ideen auf dem Skizzenblock. Die Moderatorin bzw. der Moderator fragt dann den Unterstützungskreis, welche zwei bis drei Aktionen ganz besonders wichtig für das weitere Vorankommen sind. Sie bzw. er fragt dann die planende Person, ob zu diesen Punkten konkrete Schritte geplant werden sollen. Dann wird in das Plakat eingetragen, wer was bis wann macht.
Abschluss
Zum Abschluss kann die planende Person den Unterstützungskreis einladen, das MAPS–Plakat zu unterzeichnen.
Die Moderatorin bzw. der Moderator schließt das Treffen damit, dass jede und jeder aus dem Unterstützungskreis eine Wertschätzung oder ein Gefühl zu dem MAPS-Treffen äußern kann.
Was erfordert MAPS?
MAPS ist ein intensives Planungsverfahren, das eine erfahrene Moderation und eine erfahrene Person, die zeichnet, malt und schreibt (graphic facilitator) erfordert. Die beiden sollten sich vorher ausführlich mit der Methode vertraut gemacht haben. Die Teilnehmenden des Unterstützungskreises sollten möglichst offen, wertschätzend und unterstützend sein.
MAPS dauert mindestens zweieinhalb Stunden bis einen halben Tag.
Unter Unterstützungskreise – ich bin nicht alleine… erfahren Sie mehr über die Organisation und Moderation eines Unterstützungskreises.
Quelle und vertiefende Literatur zum Thema MAPS
(in Englisch)
John O’Brien, Jack Pearpoint & Lynda Kahn (2010): The PATH & MAPS Handbook. Person-Centred Ways to Build Community. Toronto: Inclusion Press.
Weitere Literatur
Ines Boban (2008): Bürgerzentrierte Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen. Inklusiver Schlüssel zu Partizipation und Empowerment pur. In: Hinz, Andreas, Körner, Ingrid & Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Marburg: Lebenshilfe, S.230-247
Stefan Doose (2011): „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen. Broschüre mit Materialienteil. 9. überarbeitete Auflage Kassel: Mensch zuerst. Verfügbar auf der Website „Persönliche Zukunftsplanung“
Susanne Göbel (2010): „Punkt, Punkt, Komma, Strich – Ein Bild wird es sicherlich!“ Graphische Darstellung als wichtiges Element der Persönlichen Zukunftsplanung. Mainz.
Zukunftsplanung: PATH
PATH
von Stefan Doose
Was ist PATH?
PATH ist ein Planungsprozess mit einem Unterstützungskreis für Personen, die eine Vorstellung davon haben, wie ihre Situation in Zukunft sein soll, aber den Weg dorthin noch klären müssen. Der PATH-Prozess setzt an den gemeinsamen Werten und Visionen der planenden Person und ihres Unterstützungskreises an. Er zeichnet eine wünschenswerte Zukunft, beschreibt die gegenwärtige Situation und sucht dann Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Stärkungsmöglichkeiten für den Weg, beschreibt wichtige Zwischenschritte und endet mit einem konkreten Aktionsplan für den nächsten Monat. Der PATH-Prozess kann sowohl für einzelne Personen, Familien, Projekte als auch für Organisationen genutzt werden.
PATH wurde von Jack Pearpoint, John O‘Brien und Marscha Forrest Anfang der 90er-Jahre in den USA entwickelt. PATH stand zunächst als Abkürzung für „Planning Alternatives Tomorrows with Hope“ – frei übersetzt „Ein anderes Morgen mit Hoffnung planen“, wird aber heute von Pearpoint, O‘Brien und Forrest nur noch in der Kurzform benutzt. Das englische Wort „path“ bedeutet auch Weg. PATH umfasst acht Schritte, die auf einem großen Plakat grafisch festgehalten werden (nach O’Brien, Pearpoint, Kahn 2010):
Dieses Plakat erhalten Sie in DIN A4 in der Rechten Spalte.
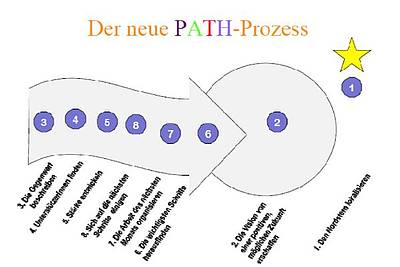
Was sind die Schritte bei PATH?
Begrüßung und Vorstellung
Die Hauptperson oder eine vertraute Person eröffnet das Treffen, indem sie die Teilnehmenden des Unterstützungskreises herzlich begrüßt und kurz den Anlass und die Zielsetzung des PATH-Prozesses erläutert.
Jede Person im Unterstützungskreis stellt sich vor und sagt, wieso es ihr wichtig ist, heute dabei zu sein. Die Moderatorin bzw. der Moderator und die Person, die zeichnet, malt und schreibt, stellen sich vor und erläutern ihre Rolle und den Ablauf sowie die PATH-Gesprächsregeln.
1 Den Nordstern lokalisieren
Der persönliche Nordstern umschreibt das, was die Hauptperson im Leben leitet, ihre Werte, Ziele und Ideale. Das Bild vom Nordstern beschreibt einen Punkt der Orientierung, wie ihn Seefahrende, Entdeckerinnen und Entdecker nutzten, um auf rauer See oder in unübersichtlichem Gelände weiter in die richtige Richtung zu reisen.
Dieser Schritt ermöglicht dem Unterstützungskreis, zu sehen und zu hören, was der planenden Person im Leben wichtig ist. Wenn sie mit ihrer Erzählung fertig ist, wird herausgefiltert, was der Kern, das Allerwichtigste für sie ist.
Die Zeichnerin bzw. der Zeichner entwickelt nun gemeinsam mit der Hauptperson auf dem Plakat ein Bild für den Nordstern. Zum Abschluss dieser Phase bittet die Moderatorin bzw. der Moderator den Unterstützungskreis um eine wertschätzende Rückmeldung.
2 Die Vision von einer positiven, möglichen Zukunft erschaffen
Es geht in diesem Schritt darum, ein lebendiges Bild von den Möglichkeiten zu entwerfen, die der Unterstützungskreis zusammen mit der planenden Person in den nächsten ein bis zwei Jahren schaffen kann. Dazu reisen die Beteiligten mit einer Zeitmaschine ein bis zwei Jahre in die Zukunft. Beginnend und endend bei der planenden Person beschreiben sie im Präsens, welche positiven Veränderungen dank der harten Arbeit der Person und des Unterstützungskreises möglich geworden sind, was die jetzige Situation so befriedigend macht und was die wichtigsten Erfolgsfaktoren und Schritte waren, um dorthin zu kommen.
Die Zeichnerin bzw. der Zeichner schreibt, malt und clustert zusammengehörige Schlüsselbegriffe und Bilder in den großen Kreis auf dem Plakat, der Platz in der Mitte bleibt frei. Nachdem verschiedene Möglichkeiten sichtbar geworden sind, bittet die Moderation die planende Person, zu sagen, welche Möglichkeiten ihr am lebendigsten erscheinen und am wichtigsten sind.
Die Zeichnerin bzw. der Zeichner und die Hauptperson arbeiten dann ein paar Minuten daran, ein passendes Bild zu erschaffen, welches den Kern der positiven Veränderungen widerspiegelt und in der Mitte des Kreises platziert wird.
3 Die Gegenwart beschreiben
Die Zeichnerin bzw. der Zeichner überschreibt die erste Spalte mit „Jetzt“ und dem Datum des Tages. Die Moderation fasst die Vision der gewünschten Zukunft kurz zusammen und fragt dann nach einer Skizzierung der Situation in der Gegenwart. Die planende Person beginnt, die anderen im Kreis helfen, weitere Details und wichtige Punkte hinzuzufügen. Es geht hier um eine schnelle Sammlung wichtiger Fakten. Die Zeichnerin bzw. der Zeichner malt jetzt keine detaillierten Bilder mehr, sondern listet einfach Punkte auf, die gegebenenfalls mit kleinen „Merkzeichnungen“ ergänzt werden.
Am Ende kann die planende Person gefragt werden, ob sie eine Metapher, ein Bild, für ihren jetzigen Zustand hat und die Spannung zwischen Gegenwart und gewünschter Zukunft spürt.
4 Unterstützer und Unterstützerinnen finden
Es kann keine Bewegung hin zu einer positiven Zukunft geben ohne das Engagement von Menschen. Nachdem der Unterstützungskreis den Nordstern der Person gesehen, die Vision einer positiven Zukunft erlebt und die Spannung zur jetzigen Situation gespürt hat, stellt sich nun die persönliche Frage, wer sich mit seinen Möglichkeiten aktiv am Erreichen der positiven Zukunft für die planende Person beteiligen will.
Nachdem die Hauptperson entschieden hat, ob sie den Plan verfolgen will und Mitglieder des Unterstützungskreises von der Moderation eingeladen wurden, an der Umsetzung mitzuwirken, tragen sich all diejenigen auf dem Plakat ein, die an der Verwirklichung des Zukunftsplanes teilhaben wollen. Außerdem werden weitere, nicht anwesende Personen identifiziert und aufgeschrieben, die zusätzlich eingeladen werden sollen, an diesem Prozess mitzuwirken. Ihre Mitwirkung sollte positiv sein und möglich erscheinen.
5 Stärke entwickeln
Der Weg zur Verwirklichung der positiven Zukunftsvision wird Kraft erfordern. Die planende Person und der Unterstützungskreis überlegen deshalb in diesem Schritt, wie sie sich stärken können. Über welche Kompetenzen, Ressourcen und Verbindungen verfügen sie bereits, welche müssen sie noch entwickeln? Dazu macht der Unterstützungskreis mithilfe des Plakats „Stärker werden“ (Link zu der Datei) ein kurzes Brainstorming, welche Kompetenzen und Ressourcen bereits vorhanden sind und was zusätzlich gebraucht wird. Es geht dabei um die Bereiche:
- Menschen und Beziehungen: Wen kennen wir?
- Organisationen, Vereine und Gruppen: Wo gehören wir dazu? Wo sind wir Mitglied?
- Know-how: Welche Informationen, Kenntnisse und Fertigkeiten haben wir?
- Systeme: Was können die vorhandenen Systeme für uns tun? Welche Rechtsansprüche haben wir?
- Persönliche Energie und Gesundheit: Was können wir persönlich tun, um fit zu bleiben und uns zu stärken?
Dies wird in Stichworten aufgeschrieben. Nach dem Brainstorming werden die zentralen Punkte ausgewählt und auf dem Plakat in der Spalte „Stärke entwickeln“ eingetragen.
6 Die wichtigsten Schritte herausfinden
Ziel dieses Schrittes ist es, zu überlegen, was nach etwa der Hälfte der Gesamtzeit erreicht sein sollte, um die Zukunftsvision zu verwirklichen. Dabei sollen die zwei oder drei großen Schritte identifiziert werden, die für den Erfolg entscheidend sind. Sie werden um jeweils zwei bis drei Unterpunkte ergänzt.
7 Die Arbeit des nächsten Monats organisieren
Der Monat nach dem ersten Treffen ist ein kritischer Zeitraum für die planende Person und den Unterstützungskreis. Es geht darum, erste detaillierte Absprachen unter den Beteiligten zu treffen, andere Personen mit einzubeziehen und Informationen einzuholen.
Beginnend mit der planenden Person, identifizieren die Anwesenden Ziele für den ersten Monat. Wenn einige Ziele herausgearbeitet sind, fragt die Moderation die planende Person, an welchem Ziel sie arbeiten möchte. Dann fragt sie, wer die Hauptperson dabei unterstützen kann. Die Zeichnerin bzw. der Zeichner schreibt das Ziel und daneben die Namen auf. Dann werden die Mitglieder des Unterstützungskreises gefragt, ob sie der Hauptperson anbieten können, an anderen Zielen mitzuarbeiten und ob sie dies mit jemand zusammen tun wollen. Angebote, die die Hauptperson angenommen hat, werden notiert. Es wird vereinbart, wie die Hauptperson über die Ergebnisse der Aktivitäten der Unterstützerinnen und Unterstützer informiert wird. Es kommt nicht auf die Menge der Ziele an. Zwei bis drei Ziele reichen gewöhnlich. Es sei denn, es gibt einen großen, aktiven Unterstützungskreis.
8 Sich auf die nächsten Schritte einigen
Ziel des letzten Schrittes ist es, Vereinbarungen zu treffen, damit die planende Person und der Unterstützungskreis sofort mit der Umsetzung des Zukunftsplanes starten können und beginnen, zusammenzuarbeiten.
Die Moderatorin bzw. der Moderator bittet nun alle im Unterstützungskreis, darüber nachzudenken, was sie in den nächsten 24 bis 72 Stunden tun können, um der Zukunftsvision einen kleinen Schritt näher zu kommen. Das kann etwas kleines Einfaches sein, zum Beispiel jemanden über das Planungstreffen informieren oder einen Kontakt herstellen. Die planende Person beginnt und sagt, was sie als nächstes tun möchte. Dann machen die anderen im Kreis ihre Angebote und die Person entscheidet, ob sie diese annehmen möchte. Die Aktionen werden auf dem Plakat in einer Tabelle „Was macht wer bis wann“ unter „Nächste Schritte“ notiert.
Abschluss
Die Moderatorin bzw. der Moderator bittet nun alle, sich den PATH noch einmal anzusehen und fragt nach einem Titel. Wenn ein passender Vorschlag kommt, der der Hauptperson gefällt, wird er von der Zeichnerin bzw. dem Zeichner über den PATH geschrieben.
Die Moderation bittet zum Abschluss alle Teilnehmenden des Unterstützungskreises, eine kurze wertschätzende Rückmeldung oder ein Gefühl zu dem PATH-Treffen zu äußern. Die Zeichnerin bzw. der Zeichner notiert diese Begriffe am unteren Rand des Plakates. Die Hauptperson hat ein kurzes Schlusswort.
Was erfordert PATH?
PATH ist ein intensives Planungsverfahren, das eine erfahrene Moderation und eine erfahrene Person, die zeichnet, malt und schreibt (graphic facilitator) erfordert. Die beiden sollten sich vorher ausführlich mit der Methode vertraut gemacht haben. Die Teilnehmenden des Unterstützungskreises sollten möglichst offen, wertschätzend und unterstützend sein.
PATH dauert mindestens zweieinhalb Stunden bis einen halben Tag.
Quelle und vertiefende Literatur zum Thema PATH
(in Englisch)
John O’Brien, Jack Pearpoint & Lynda Kahn (2010): The PATH & MAPS Handbook. Person-Centred Ways to Build Community. Toronto: Inclusion Press.
Weitere Literatur zum Thema
Ines Boban (2008): Bürgerzentrierte Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen. Inklusiver Schlüssel zu Partizipation und Empowerment pur. In: Hinz, Andreas, Körner, Ingrid & Niehoff, Ulrich (Hrsg.): Von der Integration zur Inklusion. Grundlagen – Perspektiven – Praxis. Marburg: Lebenshilfe, S.230-247
Stefan Doose (2011): „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen. Broschüre mit Materialienteil. 9. überarbeitete Auflage Kassel: Mensch zuerst. Verfügbar auf der Website „Persönliche Zukunftsplanung“.
Susanne Göbel (2010): „Punkt, Punkt, Komma, Strich – Ein Bild wird es sicherlich!“ Graphische Darstellung als wichtiges Element der Persönlichen Zukunftsplanung. Mainz.
Zukunftsplanung: Denkanstöße zur Persönlichen Zukunftsplanung
Denkanstöße zur Persönlichen Zukunftsplanung
- Alle Menschen haben ein Recht auf ein "normales" Leben.
- Jeder Mensch hat das Recht zu wählen, wo sie oder er leben und arbeiten möchte.
- Ressourcen in der Gemeinschaft sind für alle verfügbar.
- Alle Menschen haben Gaben, Fähigkeiten, Talente und können etwas zur Gemeinschaft beitragen.
- Entwicklung geschieht lebenslang.
- Wachstum ist begleitet von Risiko: Wer nicht wagt, gewinnt nicht.
- Jede Person sollte, soweit wie möglich, ihr Leben selbst bestimmen und ihre eigenen Entscheidungen treffen können.
- Menschen sind die besten Profis für ihre eigenen Bedürfnisse.
- Jede und jeder profitiert von ganzheitlichen und qualitativ guten Unterstützungsangeboten, die flexibel genug sind, sich der Lebenssituation der Menschen und ihren sich wandelnden Bedürfnissen anzupassen.
- Die effektivsten Unterstützungspersonen sehen sich selbst als Mentorinnen bzw. Mentoren oder Moderatorinnen bzw. Moderatoren.
- Direkte, selbstbestimmte Kommunikation ist ein guter Weg für Menschen, sich selbst auszudrücken und Kontrolle über ihr Leben zu haben.
- Selbstständigkeit heißt nicht, Dinge alleine zu tun. Leben bedeutet wechselseitige Abhängigkeit, Gemeinschaft, Beziehungen und Verbundenheit.
- Jede Person verdient jemanden, der an sie glaubt, ihre Träume ernst nimmt und sich für sie einsetzt.
- Informierte Eltern sind oft die stärksten Anwältinnen und Anwälte ihrer Kinder.
- Trennung und gehen lassen sind schwierige Themen und es ist wichtig, dass Eltern darüber reflektieren können.
- Die Macht und die Möglichkeiten einer oder eines Einzelnen werden gestärkt durch ein gut geplantes Unterstützungssystem.
(Diese Liste ist angelehnt an die “New Hats Philosophie” im Materialienband „It´s my life - Preference Based Planning for Self-Directed Goal Meetings. Facilitators Guide“ von New Hats. Übersetzung ins Deutsche: Stefan Doose, aus: Doose, Stefan: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer individuellen Hilfeplanung mit Menschen mit Behinderungen. Broschüre mit Materialienteil. 8. überarbeitete Auflage Kassel: Mensch zuerst, 2011)
Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive auf der Suche nach Barrieren
Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive auf der Suche nach Barrieren
Ziel des Spiels:
Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive suchen in ihrer Schule, ihrem Haus, ihrem Treffpunkt, ihrem Stadtteil oder Dorf nach Hindernissen, die Menschen mit Behinderungen den Zugang erschweren. Um solche Hindernisse, die hier "Barrieren" genannt werden, in eurem Umfeld zu finden oder auch festzustellen, dass euer Ort schon "barrierefrei" ist, zieht ihr als Detektivinnen und Detektive los und sucht sie.
Viele Städte und Gemeinden haben eine Checkliste erstellt, um zu überprüfen, welche Barrieren bei ihnen noch bestehen und welche schon beseitigt sind. Mit den Checklisten können sie besser planen und noch vorhandene Hindernisse beseitigen. Auch haben viele Gemeinden und Städte einen sogenannten "Gemeindeplan", eine ganz genaue Landkarte, die man von ihren Websites herunterladen kann.
Ziel des Spiels ist herauszufinden, wie viele Hindernisse in eurer Umgebung schon beseitigt oder noch vorhanden sind. Um diese Frage zu klären, ist es wichtig, die Checklisten zur Hilfe zu nehmen. Wichtig ist darüber hinaus aber auch, Informationen darüber zu sammeln, was Menschen mit Behinderungen selbst als behindernd erleben. Dazu könnt ihr im Internet recherchieren und euch mit Menschen unterhalten, die Erfahrungen mit Hindernissen und Behinderungen gemacht haben. Überlegt, wer das in eurem Umfeld sein könnte, wo ihr Expertinnen und Experten für Barrieren und Barrierefreiheit treffen könnt - am besten Menschen, die selbst eine Behinderung haben .
Eure Aufgabe als Gemeinde-Detektivinnen und -Detektive:
Als Detektivinnen und Detektive im Auftrag von Menschen mit Behinderungen könnt ihr mit Hilfe der Checklisten (siehe Rechte Spalte) eure Umgebung erforschen und eine Bewertung abgeben. Ihr könnt dazu zwischen vier Checklisten auswählen, den Checklisten "Barrierefrei Hören", "Barrierefrei Orientieren", "Barrierefrei Bewegen" und einer zusamenfassenden und "leichten" Checkliste.
Was macht eine Gemeinde-Detektivin oder ein Gemeinde-Detektiv genau?
Als Gemeinde-Detektivin oder -Detektiv hast du sozusagen eine Lupe vor deinen Augen. Du siehst alles ganz genau und passt genau auf. Spüre alles auf, was dir verdächtig erscheint und sei neugierig!
Als Detektivin oder Detektiv musst du genau beobachten, also schau dich gut um, wenn du in deiner Gemeinde oder Stadt unterwegs bist. Dazu kannst du dir einige Plätze oder einzelne Gebäude ganz genau ansehen. Du kannst dich auch länger an einem Ort aufhalten und beobachten, was die Leute dort machen und womit sie nicht so gut klar kommen. Das notierst du dir am besten.
Versuch dir vorzustellen, du wärst neu im Ort und hättest entweder selbst eine Behinderung oder eine Familienangehörige oder ein Familienangehöriger hätte eine Behinderung. Das könnte zum Beispiel eine Gehbehinderung, eine Sehbehinderung oder auch eine Hörbehinderung sein. Auf was müsstest du achten, um dich zurechtzufinden? Welche Schulen, Ämter, Arztpraxen, Apotheken, Supermärkte, Bankautomaten, Cafés, Bäcker, Parks, Sportplätze, Verkehrsmittel etc. wären für dich (nicht) erreichbar? Nimm deine Checkliste zu Hilfe, um Barrieren aufzuspüren!
Auf den Checklisten wird erklärt, wie sie auszufüllen sind. Manchmal muss die Breite oder Höhe von etwas gemessen werden, nehmt daher auch einen Zollstock oder ein Messband mit.
Ihr könnt zusätzlich auch einen Fotoapparat oder ein Handy mitnehmen, um Fotos zu machen. So könnt ihr euch später besser erinnern und anderen besser erklären, welche Hindernisse es in eurem Ort gibt.
Wichtig:
Wenn ihr in Gebäuden recherchiert, erklärt den Mitarbeitenden höflich, worum es geht. Sie könnten sich sonst wundern, wenn ihr dort Fahrstühle oder Umkleidekabinen vermesst, wie es die Checklisten vorsehen! Erklärt ihnen, dass es sich um ein Spiel handelt!
Einige Informationen für die Checkliste könnt ihr vermutlich ohnehin nur von den Mitarbeitenden erfahren, zum Beispiel wie viele Parkplätze zu einem Gebäude gehören oder ob es im Supermarkt eine Kasse mit Induktionsschleife gibt.
Falls ihr in Gebäuden fotografieren möchtet, müsst ihr die Mitarbeitenden unbedingt um Erlaubnis fragen!
Du kannst auch Anwohnerinnen und Anwohner auf der Straße zum Thema Barrieren befragen. Sei dabei sehr höflich, erzähle um was es geht, und hör aufmerksam zu. Du kannst dir Notizen machen, wie Detektivinnen und Detektive es tun, um dich später besser an die Aussagen zu erinnern. Bedanke dich für die Auskunft.
Du kannst natürlich auch mit einer Detektiv-Kollegin oder einem -Kollegen zusammenarbeiten. Dann könnt ihr zum Beispiel darüber diskutieren, ob ein Gebäude oder Platz barrierefrei ist oder nicht. Falls ihr Anwohnerinnen und Anwohner befragt, kann eine bzw. einer von euch fragen und die oder der andere kann sich Notizen zu den Antworten machen.
Für eure Untersuchungen gibt es keine Zeitvorgabe. Ihr könnt eine Stunde dafür verwenden oder euch einen Monat lang immer wieder Notizen zu Orten machen. Besprecht mit eurer Gruppe, wie lange das Spiel dauern soll!
Klärt auch, in welcher Form ihr euch nach der Untersuchung über die Ergebnisse austauschen und was ihr weiter damit machen wollt:
- Wollt ihr den anderen Detektivinnen und Detektiven von euren Recherchen berichten?
- Wollt ihr zusätzlich Fotos der untersuchten Plätze und Gebäude zeigen?
- Wollt ihr gemeinsam das beste barrierefreie Gebäude in eurem Ort küren?
- Wollt ihr eure Recherche-Ergebnisse an die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister schicken?
- Wollt ihr das am schlechtesten bewertete öffentliche Gebäude der Lokalzeitung melden?
- Wollt ihr eure Recherche-Ergebnisse Behindertenselbsthilfe-Organisationen zur Verfügung stellen?
- Wollt ihr das Spiel in einem Jahr wiederholen, um zu prüfen, was sich verändert hat?
Diese Materialien brauchst du für deine Untersuchung:
- Kopien der Checklisten,
- Papier und Stift,
- einen Zollstock zum Messen,
- gegebenenfalls einen Fotoapparat.
Anleitung:
Wähle eine (oder mehrere) der drei Checklisten aus und lies dir diese in Ruhe durch.
Frage andere Leute, wenn du Begriffe oder Anweisungen auf der Checkliste nicht verstehst.
Besprecht in der Gruppe, wer welche Gebäude oder Plätze untersucht.
Klärt in der Gruppe, wie lange die Recherche dauern soll.
Klärt in der Gruppe, in welcher Form ihr euch später über die Ergebnisse austauschen und was ihr weiter damit machen wollt.
Pack dein Equipment ein.
Los geht’s!
Checkliste Barrierefrei Bewegen
Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit körperlichen und motorischen Einschränkungen
Gebäude allgemein
| <b>Zugang</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Man kann das Gebäude ohne Stufen betreten oder verlassen. | ja | nein |
| Falls es Stufen gibt, gibt es auch eine Rampe oder einen Aufzug. | ja | nein |
| <b>PKW-Stellplätze</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Es gibt mindestens einen Parkplatz für Personen, die einen Rollstuhl nutzen, in direkter Nähe zum Eingang. | ja | nein |
| Dieser Parkplatz ist größer als normale Parkplätze (mindestens 350 cm breit und 500 cm tief). | ja | nein |
| Es gibt ein Schild, das auf den Parkplatz hinweist. | ja | nein |
| <b>Türen und Durchgänge</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Alle Türen und Durchgänge sind mindestens 90cm breit. | ja | nein |
| Falls die Eingangstür des Gebäudes eine Drehtür ist, gibt es noch eine zusätzliche Eingangstür, die während der Öffnungszeiten benutzt werden kann. | ja | nein |
| <b>Aufzüge</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Falls die Eingangstür des Gebäudes eine Drehtür ist, gibt es noch eine zusätzliche Eingangstür, die während der Öffnungszeiten benutzt werden kann. | ja | nein |
| Die Breite der Aufzugstür beträgt mindestens 90cm. | ja | nein |
| Die Aufzugkabine ist mindestens 140cm tief und 110cm breit. | ja | nein |
| Die Elemente zur Bedienung des Aufzugs sind nicht höher als 120cm über dem Boden angebracht. | ja | nein |
| <b>Toiletten</b> Es gibt mindestens eine Toilette, die rollstuhlgeeignet ist. Eine solche Toilette erkennt man an folgenden Kriterien: | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Vor Waschbecken und Toilette gibt es eine Fläche von mindestens 150x150cm. | ja | nein |
| Man kann von beiden Seiten an die Toilette heranfahren. Dafür steht eine Fläche von 90cm (Breite) x 70cm (Tiefe) auf beiden Seiten zur Verfügung. | ja | nein |
| Die Toilettentür geht nach außen auf. Geht die Tür nach innen auf, dürfen die vorgegebenen Flächen der letzten beiden Punkte nicht verkleinert werden. | ja | nein |
| Auf beiden Seiten der Toilette ist ein hochklappbarer Stützgriff montiert, der über die Vorderkante der Toilette herausragt. | ja | nein |
| Man kann mit dem Rollstuhl unter das Waschbecken fahren. Dafür muss die Unterkante des Waschbeckens mindestens 85cm hoch sein. | ja | nein |
| Es gibt eine Notrufanlage in der Toilette. | ja | nein |
Geschäfte, Supermärkte, Kaufhäuser
| <b>Drehkreuze</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Drehkreuze sind leicht zu öffnen und wegklappbar. Sie dürfen nicht festgeschraubt oder durch Regale / Waren verstellt sein. | ja | nein |
| <b>Bewegungsflächen</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Ein Durchgang von mindestens 90cm muss zwischen Warenauslagen immer frei bleiben. | ja | nein |
| Der Mindestabstand zwischen den Regalen beträgt mindestens 120cm. | ja | nein |
| <b>Umkleidekabinen</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Mindestens eine Umkleide muss eine Größe von mindestens 150x150cm haben. | ja | nein |
| <b>Kasse</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Mindestens ein Kassendurchgang muss eine Breite von 90cm haben. Diese Kasse muss als rollstuhl- und kinderwagengerechte Kasse deutlich gekennzeichnet sein. | ja | nein |
| <b>Personal</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Fachkundiges Personal muss Menschen mit körperlichen oder motorischen Einschränkungen unterstützen. | ja | nein |
Gastronomiebetriebe
| <b>Tische</b> Es gibt mindestens einen Tisch, der rollstuhlgeeignet ist. Man erkennt den Tisch an folgenden Kriterien: | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Der Tisch ist stufenlos erreichbar. | ja | nein |
| Man kann mit dem Rollstuhl unter den Tisch fahren. Dafür muss der Tisch mindestens 85 cm hoch sein. | ja | nein |
Checkliste Barrierefrei Hören
Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit einer Hörschädigung
Gebäude allgemein
| <b>Aufzüge</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Es gibt im Aufzug eine optische Anzeige, in welcher Etage man sich gerade befindet. | ja | nein |
Geschäfte, Supermärkte, Kaufhäuser
| <b>Kasse</b> Es gibt mindestens eine Kasse, die für Menschen mit Hörschädigungen geeignet ist. Man erkennt diese Kasse an folgenden Kriterien: | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die Kasse ist mit einer Induktionsschleife ausgestattet. Das ist eine Technik zur Unterstützung von Menschen mit Hörschädigungen. | ja | nein |
| Die Kasse ist durch ein gut sichtbares Hinweisschild gekennzeichnet. | ja | nein |
| <b>Beratungsplatz</b> Es gibt mindestens einen Beratungsplatz, der sich für Menschen mit Hörschädigung geeignet ist. Man erkennt diesen Arbeitsplatz an folgenden Kriterien: | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Es gibt ein Induktionsschleifensystem. | ja | nein |
| Es gibt nur geringe Umgebungsgeräusche. | ja | nein |
| Die Beleuchtung ist hell, blendet aber nicht. | ja | nein |
| Der Beratungsplatz ist mit einem gut sichtbaren Hinweisschild gekennzeichnet. | ja | nein |
Gastronomiebetriebe
| <b>Gastraum</b> Es gibt mindestens einen Tisch, der für Menschen mit Hörschädigung geeignet ist. Man erkennt diesen Tisch an folgenden Kriterien: | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die Beleuchtung ist hell, blendet aber nicht. | ja | nein |
| Der gegenseitige Blickkontakt wird nicht durch Gegenstände gestört. | ja | nein |
| Es gibt nur geringe Umgebungsgeräusche. Falls sich in der Nähe des Tischs ein Lautsprecher für Musik befindet, kann dieser abgeschaltet werden. | ja | nein |
| Der Tisch ist durch ein gut sichtbares Hinweisschild ausgeschildert. | ja | nein |
| <b>Reservierung</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Man kann den Tisch für Menschen mit Hörschädigung per Internet, Fax oder E-Mail reservieren. | ja | nein |
Checkliste Barrierefrei Orientieren
Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit Einschränkungen des Sehens
Gebäude allgemein
| <b>Gebäudeeingang</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Falls die Eingangstür des Gebäudes eine Drehtür ist, gibt es noch eine zusätzliche Eingangstür, die während der Öffnungszeiten benutzt werden kann. | ja | nein |
| Auf dem Boden vor Schiebetüren ist ein Bereich gekennzeichnet, der auf die Tür hinweist. Das kann z.B. ein starker optischer Kontrast sein oder auch ein besonderer Untergrund, der mit einem Taststock zu tasten ist. | ja | nein |
| <b>Gefahrenstellen</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Vor Gefahrenstellen (Glasflächen, Treppenunterkanten) wird durch starke optische Kontraste oder durch einen besonderen Untergrund, der mit dem Taststock zu tasten ist, gewarnt. | ja | nein |
| Möbel und andere Gegenstände stehen nicht in den Durchgangswegen. | ja | nein |
| <b>Persönliche Auskunft</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Es ist für Menschen mit Einschränkungen des Sehens möglich, persönliche Auskunft und Unterstützung durch geschultes Personal zu erhalten. | ja | nein |
| <b>Beschilderung</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die Schilder sind gut sichtbar angebracht. Die Schriftfarbe unterscheidet sich deutlich vom Hintergrund und ist leicht zu erkennen. | ja | nein |
| <b>Eingänge, Durchgänge, Türen</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Eingänge, Durchgänge und Türen sind farblich deutlich von der Umgebung abgesetzt. | ja | nein |
| <b>Beleuchtung</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die Beleuchtung ist hell, darf aber nicht blenden. | ja | nein |
| <b>Nutzung von Technik</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Griffe, Aufzugstasten und sonstige notwendige Bedienelemente unterscheiden sich farblich vom Untergrund. | ja | nein |
| Man kann die Bedienelemente nicht nur sehen, sondern auch tasten. Es werden keine "Touchscreens" verwendet. | ja | nein |
| Tasten sind mit tastbaren Symbolen oder Beschriftungen versehen. | ja | nein |
| <b>Treppen</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die erste und die letzte Stufenkante sind kontrastreich gestaltet | ja | nein |
| Es gibt einen optischen Kontrast zwischen Stufenkante und senkrechter Stufenfläche. | ja | nein |
| Der Bereich vor der Treppe ist durch einen tastbaren Bodenbelag gekennzeichnet. | ja | nein |
| Es gibt farblich auffällig gestaltete Handläufe. An mindestens einer der Treppenseiten ist der Handlauf ohne Unterbrechungen. | ja | nein |
| <b>Aufzüge</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Es wird angesagt, in welchem Stockwerk man sich gerade befindet. | ja | nein |
| Die Tasten mit den Stockwerken sind mit tastbaren Beschriftungen versehen. | ja | nein |
| Die Tasten unterscheiden sich deutlich von der Umgebungsfarbe. | ja | nein |
| <b>Toiletten</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die Toiletten sind leicht zu finden und gut ausgeschildert. | ja | nein |
| Toilette und Waschbecken unterscheiden sich farblich deutlich von der Umgebung. | ja | nein |
| <b>Blindenhunde</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Das Mitführen und die Anwesenheit von Blindenführhunden ist überall erlaubt. | ja | nein |
Geschäfte, Supermärkte, Kaufhäuser
| <b>Blindenleitsystem</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die wichtigen Wegstrecken im Gebäude sind durch einen tastbaren Untergrund und deutliche Hinweisschilder gekennzeichnet. | ja | nein |
| Die Hinweisschilder und Beschriftungen sind auch zu tasten. | ja | nein |
| <b>Waren</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Infoschilder, wie z.B. Preisschilder oder Bekleidungsgrößen, sind in großer und kontrastreicher Schrift geschrieben. | ja | nein |
| Die Beschriftungen sind auch in Punktschrift (Brailleschrift) geschrieben, die ertastet werden kann. | ja | nein |
| Die Regale sind hell beleuchtet, aber das Licht blendet nicht. | ja | nein |
| <b>Personal</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Bei Bedarf erhalten Menschen mit Einschränkungen des Sehens Unterstützung des Personals. | ja | nein |
Gastronomie
| <b>Beleuchtung</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die Tische sind hell beleuchtet, aber das Licht blendet nicht. | ja | nein |
| <b>Speisekarte</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Die Speise- und Getränkekarte sind in großer, gut lesbarer Schrift geschrieben. Die Schriftfarbe hebt sich deutlich vom Untergrund ab. | ja | nein |
| Die Speise- und Getränkekarte ist auch in Brailleschrift geschrieben. | ja | nein |
Wo gibt es Hindernisse für Menschen mit Behinderungen?
Bewegen
| <b>Orte und Gebäude sollen barriere-frei sein, also keine Hindernisse haben. Stufen und Treppen sind ein Hindernis für viele Menschen.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Gibt es eine Rampe? | ja | nein |
| Gibt es einen Aufzug? | ja | nein |
| <b>Menschen, die einen Rollstuhl benutzen, brauchen viel Platz beim Ein- und Aussteigen aus dem Auto. Deshalb gibt es für sie spezielle Parkplätze. Diese Parkplätze sind größer als normale Parkplätze. Diese Parkplätze sind oft mit einem Schild gekennzeichnet.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Gibt es einen Parkplatz für Menschen, die einen Rollstuhl benutzen? | ja | nein |
| <b>Um einen Rollstuhl gut benutzen zu können, braucht man ausreichend Platz. Durchgänge müssen deswegen mindestens 90 cm breit sein. | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Ist die Tür mindestens 90 cm breit? | ja | nein |
| Ist die Aufzugtür mindestens 90 cm breit? | ja | nein |
| Ist der Gang mindestens 90 cm breit? | ja | nein |
Hören
| <b>Eine Induktionsschleife ist eine spezielle Technik. Diese Technik unterstützt Menschen, die nicht so gut oder gar nicht hören können. Orte, an denen es Induktionsschleifen gibt, sind oft mit einem Schild gekennzeichnet. | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Gibt es eine Induktionsschleife? | ja | nein |
| <b>Menschen, die nicht so gut hören können, fällt das Hören ganz besonders schwer, wenn es zu viele Geräusche um sie herum gibt. Geräusche können zum Beispiel Musik, Autos oder Straßenbahnen verursachen.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Ist es in der Umgebung ruhig? | ja | nein |
| <b>Manche Menschen, die gar nicht oder nicht gut hören können, beobachten ganz genau wie andere Menschen ihre Lippen bewegen. Sie können daran erkennen, was die anderen Menschen sagen. Das nennt man "Lippenlesen". Dafür müssen sie die anderen Menschen gut sehen können.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Ist der Raum hell genug, um andere Menschen gut sehen zu können? | ja | nein |
Sehen
| <b>Es gibt eine Schrift für Menschen, die gar nicht oder nicht gut sehen können. Diese Schrift besteht aus Punkten und kann man mit den Fingern ertasten. Diese Schrift heißt in schwerer Sprache Brailleschrift.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Sind die Schilder, z.B. im Aufzug, in Brailleschrift geschrieben? | ja | nein |
| <b>Für Menschen, die nicht so gut sehen können, ist es wichtig, dass Texte in großer Schrift und in deutlichen Farben geschrieben sind.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Ist die Schrift, z.B. auf Schildern oder in Speisekarten, groß geschrieben? | ja | nein |
| Hebt sich die Schriftfarbe deutlich vom Untergrund ab? | ja | nein |
| <b>Manche Menschen benutzen einen Taststock, um sich im Straßenverkehr zu orientieren. Mit diesem Taststock können sie unterschiedliche Oberflächen auf dem Bürgersteig ertasten. Zum Beispiel können ihnen solche unterschiedlichen Oberflächen den Weg weisen oder vor Gefahren warnen.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Gibt es ein solches Leitsystem? | ja | nein |
| <b>Manche Menschen, die nicht so gut oder nicht sehen können, haben speziell ausgebildete Hunde, die sie unterstützen. Solche Hunde heißen Blinden-Führhunde. Es muss erlaubt sein solche Blindenführhunde überall mit hinzunehmen. Auch dorthin, wo andere Hunde nicht erlaubt sind.</b> | <b>ja?</b> | <b>nein?</b> |
| Sind Blinden-Führhunde und Assistenz-Hunde überall erlaubt? | ja | nein |
Denkmalstreit
Debatte über das Denkmal für Präsident Franklin D. Roosevelt ("Denkmalstreit")
Am 2. Mai 1997 wurde in Washington (USA) die Gedenkstätte für Franklin D. Roosevelt feierlich eingeweiht. Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) war von 1933 bis zu seinem Tod 1945 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen. Er hatte sich unter anderem für die Freiheit und die Menschenrechte eingesetzt. Mit 39 Jahren war Roosevelt an Kinderlähmung erkrankt, wodurch seine Beine, seine Arme und sein Rücken gelähmt wurden. Er konnte mit Krücken und Stahlschienen stehen, aber nur mühsam gehen und brauchte einen Rollstuhl.
Bevor das Denkmal errichtet wurde, hatte es Diskussionen darüber gegeben, wie Roosevelt dargestellt werden soll. Am heftigsten hatten die Beteiligten darüber diskutiert, ob er mit oder ohne Rollstuhl gezeigt werden soll. Die Verantwortlichen in der Denkmalskommission entschieden, Roosevelt nicht im Rollstuhl zu zeigen. Sie einigten sich darauf, ihn auf einem Stuhl mit Rollen sitzend darzustellen. Dieser Stuhl wird von einem Umhang verdeckt. Behindertenverbände protestierten gegen diese Entscheidung. Sie sammelten vier Jahre lang Geld, um ein zweites Denkmal zu erstellen, mit einer Skulptur von Roosevelt im Rollstuhl. Dieses Denkmal wurde 2001 errichtet.
Roosevelt selbst wollte, dass ein Denkmal für ihn aus einem schlichten Steinblock besteht, ohne figürliche Darstellung.
Was ist ein Planspiel?
In einem Planspiel stellen die Mitspielenden eine komplizierte Situation mit verteilten Rollen nach, um sich in Konflikte und mögliche Lösungen hinein zu denken und um sich Lösungen spielerisch anzunähern.
Spieldauer:
60-90 Minuten
Materialien:
- 3 Positionskarten,
- biografischer Text über F. D. Roosevelt,
- Fotos der beiden Denkmäler (diese werden nach der Diskussion gezeigt).
Mitwirkende:
- Eine Moderatorin oder ein Moderator,
- drei Gruppen mit Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die jeweils eine der drei Positionen gemeinsam erarbeiten und vertreten.
Anleitung:
Die Moderation bittet die Teilnehmenden, sich in drei ungefähr gleich große Gruppen aufzuteilen:
Gruppe 1: Behindertenverband
Gruppe 2: Experten und Expertinnen aus dem öffentlichen Leben, die die Denkmalskommission bilden.
Gruppe 3: Angehörige, Freundinnen und Freunde, die Roosevelts eigene Position vertreten.
Jede Gruppe erhält ihre Positionskarte sowie den Text über Roosevelt. Die Gruppe macht sich ca. 15 Minuten mit der Biografie und vor allem mit ihrer Position vertraut. Diskutiert in diesen 15 Minuten über die Position, schmückt sie aus, ergänzt sie und passt sie so an, dass alle Gruppenmitglieder sie gut vertreten können. Wichtig ist, dass der Kern der Forderung dabei erhalten bleibt.
Die Moderation behält die Zeit im Auge.
Jede Gruppe wählt einen Sprecher oder eine Sprecherin. Die anderen Gruppenmitglieder haben die Funktion, ihren Sprecher oder ihre Sprecherin bei der Präsentation zu unterstützen.
Die Moderation bittet die Sprecher und Sprecherinnen aufzustehen und fragt sie nacheinander nach ihrer Position. Die anderen Gruppenmitglieder dürfen diese jeweils begründen und ergänzen (insgesamt ca. 5 Minuten pro Gruppe).
Falls die drei Gruppen dies noch nicht erläutert haben, fragt die Moderation nach:
Wie hätte Roosevelt aus Sicht jeder Gruppe im Denkmal dargestellt werden sollen?
Dann eröffnet die Moderation die Diskussion für alle. Sie bittet darum, sich am Ende auf eine Darstellung Roosevelts zu einigen.
Die Moderation behält dabei wieder die Zeit im Auge (z. B. 20 Minuten) und greift ein, falls die Diskutierenden einander nicht ausreden lassen oder die Debatte auf der Stelle tritt.
Anschließend zeigt die Moderation die Bilder der beiden Denkmäler von 1997 und 2001.
Überlegt nun gemeinsam, wie ein Roosevelt-Denkmal noch ganz anders gestaltet werden könnte – wie man zum Beispiel seine Ideen der Freiheit und Menschenrechte darstellen könnte. Denkt dabei auch über andere künstlerische Formen nach, wie Fotografie, Video, Körperskulptur, Arbeit mit Ton oder anderen Materialien.
Variante:
- Ihr könnt euch mehr Zeit für das Spiel nehmen und im Internet oder in Bibliotheken zum Beispiel zu Roosevelts Leben, den Menschenrechtsdokumenten oder auch zu Denkmalgestaltung recherchieren.
Zur Weiterarbeit:
- Ihr könnt diese Diskussion mit der Übung "Wo stehst du?" aus den "Unterrichtsmaterialien für die Menschenrechtsbildung an Schulen", Seite 22, kombinieren.
- Ihr könnt selbst, allein oder in der Gruppe, ein Denkmal bauen – für Roosevelt oder eine andere Person mit oder ohne Behinderung.
- Ihr könnt euch darüber austauschen, wie ihr selbst in einem Denkmal dargestellt werden möchtet. Welche Eigenschaften oder Ideen von euch sollten gezeigt werden? Wollt ihr allein oder mit anderen dargestellt werden? Figürlich oder abstrakt? Aus welchem Material sollte das Denkmal sein?
Tipp:
Thematische Bausteine mit methodischen Vorschlägen und Quellen zur künstlerischen und theaterpädagogischen Anregung findet ihr beispielsweise in den Heften der Reihe "Konfrontationen. Bausteine zur pädagogischen Annäherung an Geschichte und Wirkung des Holocaust", einem Fortbildungs- und Beratungsangebot des Fritz Bauer Instituts.
Quellen:
1: wapedia.mobi/de/Franklin_Delano_Roosevelt_Memorial vom 16.09.2010
Position 1: Für eine Darstellung Roosevelts im Rollstuhl
Position 1: Für eine Darstellung Roosevelts im Rollstuhl
Behindertenverband: Nationale Organisation für Menschen mit Behinderungen
Die Argumente des Behindertenverbandes:
"Roosevelt wäre ohne seine Lähmung niemals der disziplinierte und brillante Präsident geworden, als den wir ihn heute feiern." (1)
"Die Behinderung hat die Willensstärke Roosevelts gefestigt." (2)
Präsident Bill Clinton schlug 1997 vor, das Denkmal von Franklin D. Roosevelt um eine Statue im Rollstuhl zu ergänzen. In diesem Zusammenhang sagte Clinton:
"Ich bin glücklich, diese Maßnahme vorzuschlagen, damit Generationen von Amerikanern wissen, dass dieser große Präsident groß war mit seiner Behinderung." (3)
"Wenn Franklin D. Roosevelt heute leben würde, würde er darauf bestehen, im Rollstuhl dargestellt zu werden." (4)
Quellen:
1: (Quelle: Michael DeLand in Wirth Fritz (1997): Streit über Roosevelts Rollstuhl. Denkmal für den gelähmten Präsidenten löst in USA Diskussionen aus. Website von Welt Online, 08.04.1997, abgerufen am 16.09.2010). (http://www.welt.de/print-welt/article635936/Streit_ueber_Roosevelts_Rollstuhl.html)
2: (Quelle: Kornelius, Stefan (1997): Geschiebe um Präsidenten-Rollstuhl. Neues Roosevelt-Denkmal löst in den USA Kontroverse aus. Kommentar in: Süddeutsche Zeitung, 02.05.1997).
3: "I'm pleased to offer this legislation so that generations of Americans will know that this great President was great with his disability." (Quelle: Bill Clinton in Stout, David (1997): Clinton Calls for Sculpture of Roosevelt in Wheelchair. Website der New York Times, 23.04.1997, abgerufen am 16.09.2010). (http://www.nytimes.com/1997/04/24/us/clinton-calls-for-sculpture-of-roosevelt-in-wheelchair.html?pagewanted=print
4: (Quelle: Bill Clinton in Weber (1997): Bill Clinton. Website von Spiegel Online, 05.05.1997, abgerufen am 16.09.2010). (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8707519.html)
Position 2: Gegen eine Darstellung Roosevelts im Rollstuhl
Position 2: Gegen eine Darstellung Roosevelts im Rollstuhl
Experten und Expertinnen der Denkmalskommission
Die Argumente der Expertinnen und Experten:
"Warum sollen wir zeigen, was Franklin D. Roosevelt selbst zwölf Jahre lang der Nation zu verbergen suchte?" (1)
"Denkmäler müssen nicht wirklichkeitsgetreu sein. Wären sie es, dürften wir kein Denkmal mehr bauen, das George Washington noch mit Zähnen zeigt. Denn er besaß keine mehr in seiner Präsidentenzeit." (2)
"Roosevelt hatte alles getan, um seine Behinderung vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Er hatte gelernt, mit Stöcken zu laufen und ließ sich bei öffentlichen Auftritten von Helfern auf die Bühne tragen, wo er dann wie ein Nicht-Behinderter im Sessel saß." (3)
Eine Enkelin weist darauf hin, dass Roosevelt den Rollstuhl, wo immer möglich, verlassen habe. Er benutzte diesen nur, um von einem Sessel in den nächsten zu kommen. Lange Zeit konnte er auch mithilfe von Stahlschienen an den Beinen stehen. Sprach er in der Öffentlichkeit, dann wurde häufig ein Vorhang vor die Bühne gezogen, bis der Präsident am Rednerpult stand. Roosevelt war sehr bedacht auf sein Bild in der Öffentlichkeit, sodass ihn nur zwei Fotos im Rollstuhl zeigen. (4)
Quellen:
1: (Quelle: Jay Carter (Kunstarchitekt) in Wirth Fritz (1997): Streit über Roosevelts Rollstuhl. Denkmal für den gelähmten Präsidenten löst in USA Diskussionen aus. Website von Welt Online, 08.04.1997,abgerufen am 16.09.2010). (http://www.welt.de/print-welt/article635936/Streit_ueber_Roosevelts_Rollstuhl.html)
2: (Quelle: Jay Carter (Kunstarchitekt) in Wirth Fritz (1997): Streit über Roosevelts Rollstuhl. Denkmal für den gelähmten Präsidenten löst in USA Diskussionen aus. Website von Welt Online, 08.04.1997, abgerufen am 16.09.2010). (http://www.welt.de/print-welt/article635936/Streit_ueber_Roosevelts_Rollstuhl.html
3: (Quelle: AFP (1997): Denkmal-Streit um Roosevelts Behinderung. Website der Berliner Zeitung, 25.04.1997, abgerufen am 16.09.2009). (http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/1997/0425/nachrichten/0122/index.html)
4: (Quelle: Kornelius, Stefan (1997): Geschiebe um Präsidenten-Rollstuhl. Neues Roosevelt-Denkmal löst in den USA Kontroverse aus. Kommentar in: Süddeutsche Zeitung, 02.05.1997).
Position 3: Roosevelt über seine Vorstellungen von seinem Denkmal
Position 3: Roosevelt über seine Vorstellungen von seinem Denkmal
Angehörige, Freunde und Freundinnen von Roosevelt
Roosevelt: "Wenn je ein Denkmal für mich errichtet werden sollte, weiß ich ganz genau wie es sein sollte. Es sollte aus einem Block ungefähr dieser Größe bestehen (zeigt mit den Händen auf seinen Schreibtisch) und in der Mitte der Grünfläche vor dem Archives-Gebäude stehen. Es kümmert mich nicht, aus was es gemacht ist, aus Kalkstein oder Granit oder sonst etwas. Aber ich möchte es schlicht, ohne irgendwelche Schnörkel, mit der einfachen Gravur 'In Gedenken an…'." (1)
Quellen:
1: Roosevelt: "If any memorial should be erected to me, I know exactly what I should like it to be. I should like it consist of a block about the size of this (putting his hand on his desk) and placed in the center of that green plot in front of the Archives Building. I don't care what it is made of, whether limestone or granite or whatnot. But I want it plain, without any ornamentation, with the simple carving "in memory of ...." The Memorial that FDR actually wanted
(Quelle: The Memorial that FDR actually wanted., abgerufen am 16.09.2010). (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:The_Memorial_that_FDR_actually_wanted.JPG&filetimestamp=20080428015705)
Denkmalstreit: Fotos des Denkmals
Debatte über das Denkmal für Präsident Franklin D. Roosevelt ("Denkmalstreit")
Die Roosevelt-Denkmale in Washington von 1997 und von 2001:


Biografien
Pablo Pineda
Pablo Pineda (geb. 1975)
Pablo Pineda, geboren 1975, ist ein spanischer Schauspieler. Er erhielt 2009 den Silver Shell Award für seine schauspielerische Leistung in dem Film "Yo Tambien" (auf Deutsch unter dem Titel "Me too" im Kino). Pablo Pineda lebt in der Stadt Malaga in Spanien. Er arbeitet dort für die Stadtverwaltung. Er hat ein Diplom in Sonderpädagogik und einen Abschluss in Psychopädagogik. Seit 2001 ist Pablo Pineda Ehrenbürger der Stadt Calpe, der Heimatstadt seiner Großeltern.
Pablo Pineda ist der bisher einzige Europäer mit Down-Syndrom und Universitätsabschluss. Als Down-Syndrom bezeichnet man eine spezielle Genom-Mutation beim Menschen, bei der das gesamte 21. Chromosom oder Teile davon dreifach vorhanden sind. Neben für das Syndrom als typisch geltenden körperlichen Merkmalen sind in der Regel die kognitiven Fähigkeiten des betroffenen Menschen beeinträchtigt. Pablo Pineda schlug trotz seiner Behinderung einen normalen Bildungsweg ein und schloss ihn ohne Assistenz erfolgreich ab. Seine Familie unterstützt ihn bis heute.
Pablo Pineda sagt über Menschen mit Down-Syndrom, sie seien genauso wie alle anderen Menschen auch. Im Leben und in der Schule lernten die einen eben schneller und die anderen langsamer. Einige lernen seiner Meinung nach bestimmte Dinge auch nie.
Pablo Pinedas Eltern sind sehr stolz auf ihren Sohn: "Wir haben immer an Pablo geglaubt und ihn von klein auf wie ein ganz normales Kind behandelt. Schon mit vier Jahren brachte ihm mein Mann lesen bei. Als er eingeschult wurde, konnte er schon einfache Texte lesen." (1)
Obwohl Pablo Pineda von seinen Eltern schon früh gefördert wurde, ist er der Meinung, dass es manche Eltern mit ihrer Fürsorge übertreiben. Zu viel Fürsorge führe dazu, dass die Menschen mit Down-Syndrom wie Kinder behandelt würden und sich selbst irgendwann nichts mehr zutrauten. Diese übergroße Fürsorge werde ihm oft von Mitmenschen entgegengebracht. Beispielsweise wenn diese ihn an der Ampel ungefragt an die Hand nehmen und auf die andere Straßenseite bringen. In solchen Momenten fehlen Pablo Pineda oft die Worte. Er möchte genauso behandelt werden wie andere Menschen auch. Und die werden ja auch nicht ungefragt über die Straße gezogen.
Quellen:
Website Disability World: "Down Syndrome is not a Disease, but Another Personal Characteristic" (abgerufen am 22.09.2010)
1: Andrea Beckmann (2001): Pablo Pineda. Trotz Downsyndrom an die Uni – In Calpe zum Ehrenbürger ernannt. In: Costa Brava Nachrichten Nr. 931, 19.10.2001
Gesetze
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK), Artikel 24 in Leichter Sprache
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK), Artikel 24 in Leichter Sprache
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(in Leichter Sprache)
Artikel 24: Recht auf Bildung
Schule
Alle Kinder sollen in die gleichen Schulen gehen.
Behinderte Kinder und nicht behinderte Kinder sollen gemeinsam lernen.
Es soll keine Sonder-Schulen geben.
Die Lehrer und Lehrerinnen müssen für alle Kinder da sein.
Sie müssen für jedes Kind die richtige Hilfe kennen.
Dafür brauchen auch die Lehrer und Lehrerinnen eine gute Ausbildung.
Manche Kinder brauchen viel Unterstützung.
Das geht auch in der Schule für alle.
Die Unterstützungs-Person kommt dann mit in die Klasse.
Auch nach der Schule geht das weiter.
Auch in der Ausbildung lernen alle zusammen.
Und an der Universität.
www.behindertenbeauftragter.de
www.ich-kenne-meine-rechte.de/index.php
Behinderung als Menschenrechtsthema
Behinderung als Menschenrechtsthema
Ein weiblicher Blick auf die UN-Behindertenrechtskonvention
von Sigrid Arnade
Frauen mit Behinderungen sind nicht nur gegenüber Frauen ohne Behinderungen benachteiligt, sondern auch gegenüber Männern mit Behinderungen. Das wusste ich lange bevor ich erstmals von der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) hörte. Behinderte Frauen bilden das Schlusslicht auf dem Arbeitsmarkt und haben demzufolge häufig nur ein sehr geringes Einkommen. Wenn sie Kinder bekommen, erhalten sie nicht die notwendigen Unterstützungen wie Zuschüsse zum Auto oder Wohnungsanpassungen, die für Erwerbstätige mit Behinderungen selbstverständlich sind. Außerdem sind Mädchen und Frauen etwa doppelt so häufig von sexueller Gewalt betroffen wie ihre nicht behinderten Schwestern.
Diese Fakten waren mir als Mitglied im Deutschen Behindertenrat (DBR) also bewusst, als ich im Frühjahr 2004 den ersten Entwurf zur BRK las. Als MS-Betroffene wusste ich außerdem, dass die Menschen mit MS mehrheitlich weiblich sind. Umso empörter war ich, als ich feststellen musste, dass Frauen in diesem Entwurf fast vollständig fehlten. Mehrere Versuche, diese fehlende Perspektive zu ergänzen, schlugen fehl.
Deshalb begründete ich gemeinsam mit Sabine Häfner, Juristin und seinerzeit Frauenreferentin beim Sozialverband Deutschland – SoVD e.V., die Kampagne „Behinderte Frauen in der UN-Konvention sichtbar machen!“. Wir arbeiteten mit einer drei-sprachigen Hompage (deutsch/englisch/spanisch), sammelten Unterschriften für unser Anliegen und erarbeiteten Ergänzungsvorschläge zur Konvention. Ideell und finanziell wurden wir dabei vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) unterstützt.
Nichts über uns ohne uns!
Als Vertreterinnen des Deutschen Behindertenrats fuhren wir dann auch nach New York zu den Verhandlungen zur BRK, Sabine Häfner zweimal, ich dreimal. Die Konvention wurde von einem sogenannten Ad-Hoc-Ausschuss verhandelt, der sich zweimal jährlich jeweils für zwei bis drei Wochen in New York traf. Insgesamt fanden acht Verhandlungsrunden statt.
Die gesamten Verhandlungen standen unter dem Motto „Nichts über uns ohne uns!“. Niemals zuvor wurde die Zivilgesellschaft bei den Verhandlungen zu einem Menschenrechtsübereinkommen so intensiv beteiligt. In jeder Verhandlungsrunde waren neben den Regierungsvertretungen auch etwa 400 Menschen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) anwesend. Dabei handelte es sich um Frauen und Männer mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen oder aber um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behindertenorganisationen.
Jeder Artikel der Konvention wurde einzeln diskutiert. Zunächst hatten die Regie-rungsdelegationen die Gelegenheit, sich zu Wort zu melden und ihre Vorschläge einzubringen. Abschließend wurde den NGOs ein Rederecht eingeräumt. Dabei übermittelte der Vorsitzende des Ausschusses, der Neuseeländer Don MacKay, eine eindeutige Botschaft an die NGOs: „Wir werden eure Vorschläge ernst nehmen, aber ihr müsst mit einer Stimme sprechen.“
Das war für uns als NGO-Vertretungen eine große Herausforderung, denn über alle sozialen, kulturellen, sprachlichen und sonstige Differenzen hinweg mussten wir uns auf eine Linie einigen. Das erforderte viel Kraft und Diskussionen, es ist aber letztlich immer gelungen. Wenn wir uns schließlich untereinander geeinigt hatten, fiel es vergleichsweise leicht, auch noch die Regierungsdelegationen zu überzeugen.
Der "twin-track-approach" und sein Siegeszug
Zur Verankerung der Rechte behinderter Frauen in der BRK gab es zwei grundsätzlich unterschiedliche Positionen:
- Frauenartikel: Die Regierungsdelegation von Südkorea brachte den Vorschlag ein, einen eigenen Frauenartikel in der Konvention zu verankern. Darin sollten alle speziellen Benachteiligungen von behinderten Frauen aufgelistet werden. Die Staaten sollen sich dazu verpflichten, Maßnahmen gegen diese Benachteiligungen zu ergreifen. Diese Position wurde vor allem von den NGO-Vertreterinnen aus Asien und Afrika unterstützt.
- Gender Mainstreaming: Dagegen favorisierten die Frauen aus Europa und anderen westlichen Staaten die Strategie des Gender Mainstreaming. Das bedeutet, dass in allen relevanten Artikeln die Situation von Frauen mit Behinderungen angesprochen werden sollte.
In dieser Situation lautete die Kompromissformel „twin-track-approach“, zu deutsch: zweigleisiges Vorgehen. Diese Strategie des „sowohl - als auch“ sollte die Konfrontation des „entweder - oder“ überwinden. Sabine Häfner und ich hatten diese Vorgehen bereits in einem unserer ersten Papiere im Frühjahr 2005 empfohlen. Im Laufe der Diskussionen konnten wir immer mehr Beteiligte vom „twin-track-approach“ überzeugen. So ist es letztlich gelungen, dass die Staaten in einem eigenen Frauenartikel (Artikel 6) die mehrfache Benachteiligung von behinderten Frauen anerkennen und sich zu entsprechenden Gegenmaßnahmen verpflichten. In Artikel 6 wird außerdem das „Empowerment“ von Frauen mit Behinderungen thematisiert. „Empowerment“ gehört sicherlich zu den Schlüsselbegriffen der Konvention. In weiteren Artikeln der Konvention, wie in den Artikeln zum Thema Gewalt oder Gesundheit, wird durch Frauen- oder Genderreferenzen die Situation von Frauen mit Behinderungen angesprochen.
Zur generellen Bedeutung der BRK
Die Tage in New York habe ich als sehr anstrengend und nervenaufreibend erlebt. Ich war immer froh, wenn ich wieder zu Hause war. Mit etwas Abstand habe ich dann aber auch Stolz empfunden, was durch das Zusammenwirken von ganz vielen engagierten Menschen aus den verschiedenen Staaten dieser Erde entstanden ist: Der starke Einfluss der Expertinnen und Experten in eigener Sache auf den Konventionstext ist unverkennbar, denn mit der BRK ist es gelungen, das erste internationale Dokument zu formulieren, das Behindertenpolitik konsequent aus einer Menschenrechtsperspektive betrachtet. In den meisten Staaten herrscht traditionell das medizinische Modell von Behinderung vor, demzufolge Behinderung unter einem medizinischen Blickwinkel als individuelles Defizit betrachtet wird. Im Gegensatz dazu entsteht Behinderung in der menschenrechtsorientierten Sichtweise „aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren“ (BRK Präambel, e). Nach diesem Verständnis geht es nicht mehr um Fürsorge oder Rehabilitation behinderter Menschen, sondern um ihre gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe.
Mit der BRK konnte dieser Perspektivenwechsel realisiert werden: Menschen mit Behinderungen werden nicht länger als Patientinnen und Patienten betrachtet, sondern als Bürgerinnen und Bürger. Sie gelten nicht länger als Problemfälle, sondern werden auf allen Ebenen als Trägerinnen und Träger unveräußerlicher Menschenrechte begriffen. So wird behindertes Leben als normaler Bestandteil menschlichen Lebens und der menschlichen Gesellschaft bejaht. Die Rede ist von dem „wertvollen Beitrag“, den Menschen mit Behinderungen zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten können (BRK Präambel, m). Gleichzeitig werden die Problemlagen behinderter Menschen nicht geleugnet, sondern benannt. Alle bestehenden Menschenrechte sind hinsichtlich der Lebenssituationen behinderter Frauen und Männer konkretisiert und auf diese zugeschnitten worden. So sind mit der BRK zwar keine neuen Rechte für Menschen mit Behinderungen geschaffen worden. Durch die BRK wird jedoch hervorgehoben, dass alle Menschenrechte für behinderte Menschen genauso gültig sind wie für alle anderen Menschen.
Für viele Menschen mit MS ist neben den aufgelisteten Aspekten auch der Artikel 25 zum Thema Gesundheit von Bedeutung. Darin erkennen die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an. Außerdem verpflichten sich die Staaten, behinderten Menschen gleichberechtigt mit anderen die Gesundheitsleistungen anzubieten, die speziell wegen der Behinderung benötigt werden, sowie solche, die weitere Behinderungen möglichst gering halten oder vermeiden helfen. Von diesen Vorgaben ist das deutsche Gesundheitswesen mit Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen noch ein Stück entfernt.
Resümee
Die BRK stärkt die Position von Menschen mit Behinderungen. Sie müssen nicht länger als BittstellerInnen auftreten, die dankbar zu sein haben. Behinderte Menschen haben das Recht, gleichberechtigt mit anderen in allen Bereichen am Leben in der Gemeinschaft teilzuhaben. Und sie haben das Recht, die dafür notwendige Unterstützung zu erhalten. Wenn ihnen dieses Recht vorenthalten wird, werden ihre Menschenrechte verletzt.
Die Situation von Frauen wurde bislang in keiner UN-Konvention (außer der Frauenrechtskonvention) so umfassend berücksichtigt wie in der BRK. In dem Frauenartikel haben sich die Staaten auch dazu verpflichtet, bei allen Planungen und Maßnahmen zur Umsetzung der BRK die Lebenswirklichkeit behinderter Frauen zu beachten. Das ist ein toller Erfolg für Frauen mit Behinderungen. Im Nachhinein bin ich froh und dankbar, dabei gewesen zu sein und meinen Teil zu diesem Ergebnis beigetragen zu haben!
Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmotor
Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmotor
Theresia Degener
1. Eine neue Menschenrechtskonvention in mehrerer Hinsicht
Mit der Verabschiedung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Dezember 2006 (1) haben die Vereinten Nationen völkerrechtlich und behindertenpolitisch einen bemerkenswerten Reformschritt vollzogen. Die Behindertenrechtskonvention (BRK) ist nicht nur die erste verbindliche Völkerrechtsquelle, die die Menschenrechte behinderter Personen zum Thema hat, sie ist zugleich der erste Menschenrechtspakt, der eine Reihe von Modernisierungen im internationalen Völkerrecht einläutet. So ermöglicht die BRK erstmalig regionalen Organisationen wie der EU den Beitritt (2). Dieser erste Menschenrechtsvertrag des neuen Millenniums ist zudem ein Völkerrechtspakt, an dem die nationalen Menschenrechtsinstitutionen als neue Akteure auf der globalen Menschenrechtsbühne(3) mitwirkten. Bei Erstauslegung am 30. März 2007 unterzeichneten bereits über achtzig Mitgliedsstaaten. Auch das ist ein Novum in der Völkerrechtsgeschichte. Die Kette der Novitäten lässt sich fortsetzen: Noch nie wurde ein vergleichbarer Völkerrechtspakt in der Rekordzeit von nur fünf Jahren entworfen und verhandelt. Noch kein anderer Menschenrechtspakt trat so schnell international in Kraft, am 3.Mai 2008 nach der Hinterlegung der 20. Ratifikationsurkunde. Mit 139 Signatarstaaten(4) belegt die BRK nach der UN-Kinderrechtskonvention Rang Zwei der Menschenrechtskonventionen mit den meisten Mitgliedsstaaten.
Behindertenpolitisch markiert die BRK den Paradigmenwechsel vom medizinischen zum menschenrechtlichen Modell von Behinderung auf internationaler Ebene. Während das medizinische bzw. individuelle Modell von Behinderung, die körperliche, psychische oder kognitive Schädigung des Einzelnen in den Blick nimmt, diesen mit Diagnose, Therapie und Förderung begegnet, ist das menschenrechtliche Modell von Behinderung auf die äußeren, gesellschaftlichen Bedingungen gerichtet, die behinderte Menschen aussondern und diskriminieren. Das menschenrechtliche Modell von Behinderung basiert auf der Erkenntnis, dass die weltweite desolate Lage behinderter Menschen weniger mit individuellen Beeinträchtigungen als vielmehr mit gesellschaftlich konstruierten Entrechtungen (gesundheitlich) beeinträchtigter Menschen zu erklären ist. Die wissenschaftliche Kritik am medizinischen/individuellen Modell von Behinderung führte zur Entstehung der disability studies, – zunächst in den USA und in Großbritannien – die sich an anderen kritisch-konstruktivistische Denkschulen, wie gender studies und critical race studies orientieren (5). Die Kritik am medizinischen Modell von Behinderung beeinflusste auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und spiegelt sich zunehmend in den WHO Konzepten wie dem ICDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980) oder dem ICF (International Classification of Functioning) wider (6). Während dem medizinischen Modell von Behinderung zunächst das soziale Modell von Behinderung entgegengesetzt wurde, gewann im internationalen rechtswissenschaftlichen Kontext bald das rechtsbasierende menschenrechtliche Modell von Behinderung an Bedeutung (7). Dieser rechtsbasierende Ansatz ist als Gegenpool zu einer an Bedürftigkeit orientierten Fürsorge- und Wohlfahrtspolitik zu verstehen, in der Behinderte als Objekte der Sozialpolitik, nicht aber als Bürgerrechtssubjekte gelten. Er entwickelte sich im Zuge der Entwicklung von Antidiskriminierungsgesetzen, die weltweit seit den 1990er Jahren auch die Kategorie der Behinderung einschlossen (8). Der rechtsbasierende Ansatz in der Behindertenpolitik gilt mittlerweile als der offizielle Ansatz für die Behindertenpolitik in der Europäischen Union (9) und in den Vereinten Nationen (10). Auch in Deutschland wurde dieser Ansatz spätestens mit der Reformierung des Rehabilitationsrechts durch Schaffung des SGB IX im Jahre 2001 und durch Verabschiedung des Behindertengleichstellungsgesetzes verfolgt und mit einer ausdrücklichen Antidiskriminierungskomponente verknüpft. Hier folgte Deutschland den Beispielen anderer Länder, die in den letzten Dekaden vermehrt Rechtvorschriften zum Schutz vor Behindertendiskriminierung erlassen hatten (11). Die BRK markiert auf internationaler Ebene den vorläufigen Höhepunkt dieser Entwicklung, den die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, in ihrer Rede vor dem Menschenrechtsrat im März 2009 als grundlegende Wende im Denken über Behinderte bezeichnete. Die Konvention, so Pillay „requires us to move away from charity-based or medical-based approaches to disability to a new perspective stemming from and firmly grounded in human rights (…) These traditional approaches and attitudes, no matter how well intentioned they might have been, regarded persons with disabilities either as passive recipients of good will or deeds, or as problems to be fixed, or both.”(12)
Innerhalb der Vereinten Nationen bedurfte es mehrerer Jahrzehnte, um den Weg für einen Paradigmenwechsel zu bereiten. In den ersten vier Dekaden waren behinderte Menschen im Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen nahezu unsichtbare Subjekte. Zuständig für Behindertenpolitik war überwiegend die WHO, die diese mit drei Themen füllte: Behindertendefinition, Prävention und Rehabilitation. Erst in den 1980er Jahren wurde mit dem Weltaktionsprogramm der Vereinten Nationen von 1982 (13) und den im Jahre 1993 verabschiedeten Rahmenrichtlinien zur Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte (14) das Gleichheitsthema auch für behinderte Personen entdeckt. Ebenfalls in dieser Zeit wurden die ersten zwei Menschenrechtsberichte zur Situation Behinderter in der Menschenrechtskommission und ihrer Unterkommission erstellt und diskutiert (15). Wenngleich in den 1990er Jahren einige der Vertragsorgane der damals sechs existierenden „Kernmenschenrechtsverträge“, sich des Themas annahmen, so blieb doch auch in dieser Zeit das medizinische Modell von Behinderung vorherrschend. Das war jedenfalls das Ergebnis einer Studie, die wir im Auftrag des Hohen Kommissariats für Menschenrechte 2001 durchführten und in der wir die Entwicklung des internationalen Menschenrechts im Hinblick auf behinderte, Menschen untersuchten. Auf Initiative von Mexiko verabschiedete die UN-Generalversammlung am 19. Dezember 2001 die entscheidende Resolution 56/168, mit der der Ad-Hoc-Ausschuss zur Erarbeitung der Behindertenrechtskonvention eingesetzt wurde. Die in den folgenden fünf Jahren währenden Verhandlungen zur BRK in New York, im Hauptquartier der Vereinten Nationen, waren wesentlich durch eine hohe Beteiligung behinderter Personen gekennzeichnet. Das aus der internationalen Behindertenbewegung stammende Motto Nothing about us without us wurde in einer historisch einmaligen Art und Weise umgesetzt. Neben den großen internationalen Behindertenverbänden (16) waren mehr als 400 Nichtregierungsorganisationen akkreditiert, die mehrheitlich durch behinderte Personen repräsentiert wurden. Aber auch etwa ein Drittel der Regierungsdelegationen hatten behinderte Experten und Expertinnen als Mitglieder (17), ebenso die Delegationen der Nationalen Menschenrechtsinstitute und die Delegationen der Organisationen der Vereinten Nationen (18) und ihrer Sonderorganisationen (19).
2. Die neue Konvention und ihr Fakultativprotokoll
Die BRK besteht aus zwei völkerrechtlichen Verträgen, dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (20) und einem Fakultativprotokoll (21), das besondere Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der BRK enthält. Staaten können wählen, ob sie nur das Übereinkommen, oder auch das Fakultativprotokoll unterzeichenen und ratifizieren.
2.1 Die Konvention
Vom Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Heiner Bielefeld, wurde die BRK als „Empowerment“–Konvention bezeichnet, die nicht nur eine Abkehr von der traditionellen, am Fürsorgeprinzip orientierten Behindertenpolitik signalisiere, sondern auch wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Menschenrechtstheorie gebe, indem sie deutlich mache, dass die Anerkennung von Behinderung als Bestandteil menschlichen Lebens zur Humanisierung der Gesellschaft insgesamt führe (22). Sie besteht neben der unverbindlichen Präambel aus 50 Artikeln. Die ersten neun Artikel könnte man den allgemeinen Teil der BRK nennen, der Bestimmungen enthält, die für alle weiteren Artikel des Abkommens bedeutsam sind, wie den Zweck der Konvention (Art. 1), Definitionen (Art. 2) und allgemeine Prinzipien (Art. 3) oder Bestimmungen zu behinderten Frauen (Art. 6) und zu behinderten Kindern (Art. 7). Weiterhin gibt es Bestimmungen zur Förderung des öffentlichen Bewusstseins über Behinderung (Art. 8) und zu Barrierefreiheit (Art. 9). Die anschließenden Normen (Art. 10–Art. 30) könnte man als den besonderen Teil der BRK charakterisieren, der den Katalog der einzelnen Menschenrechte enthält. Die darauf folgenden Artikel betreffen die Implementierung und Überwachung des Abkommens (Art. 31–40). Die Schlussbestimmungen (Art.41–50) enthalten die üblichen technischen Regelungen von Völkerrechtsverträgen, wie z.B. Ratifikationsbestimmungen.
2.1.1. Zweck und Anwendungsbereich
Artikel 1 bestimmt als Zweck der BRK: „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“ Anders als die Frauenrechtskonvention (23) oder die Antirassismuskonvention (24) verfolgt die BRK den Zweck des thematischen Menschenrechtsschutzes jedoch nicht allein durch Antidiskriminierungspflichten, sondern verfolgt, wie die Kinderrechtskonvention, einen ganzheitlichen Ansatz des Menschenrechtsschutzes mit staatlichen Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten. Daneben enthält die Konvention auch Ziel- und Förderpflichten sowie Empfehlungen für staatliche und internationale Behindertenpolitik. Wie alle Menschenrechtsverträge verpflichtet auch die BRK die Mitgliedsstaaten und hat somit zunächst öffentlich-rechtliche Wirkung. Darüber hinaus wirkt sie jedoch auch in den privatrechtlichen Bereich. Denn die Staaten sind gem. Art. 4 Abs. 1 (e) verpflichtet „alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen (…).“ Auch an anderer Stelle, wie bei der Frage der barrierefreien Umwelt und Kommunikation, werden private Rechtsträger durch die BRK direkt angesprochen (25). Da auch der gesamte Katalog der Menschenrechte, d.h. nicht nur die bürgerlichen und politischen, sondern auch die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechte, vom Schutzumfang der BRK erfasst wird, erstreckt sich ihr Anwendungsbereich umfassend auf alle denkbaren Lebensbereiche (26).
In personaler Hinsicht gilt die BRK für alle Personen mit Behinderung. Der Personenkreis wird nicht abschließend definiert, denn in der Präambel wird erkannt, „dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen und wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“ (27). Die Frage der Definition von Behinderung war eines der schwierigsten Konfliktthemen, die es während der Verhandlungen zu lösen galt. Bis zum Abend des letzten Verhandlungstages wurde um sie gerungen (28). Als Kompromiss wurde eine Formulierung gefunden, die nicht in den Definitionsartikel, sondern in Artikel 1, der den Zweck der Konvention regelt, eingefügt wurde. Zu behinderten Personen zählen danach „Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ Mit dieser Formulierung sollte sichergestellt werden, dass alle Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen unabhängig von ihren Ursachen und ihrer Anerkennung in der Gesellschaft in den Schutzbereich der BRK einbezogen werden. Zum anderen sollte eine Perpetuierung des medizinischen Modells von Behinderung und der damit verbundenen individualistischen Betrachtungsweise verhindert werden. Aus wissenschaftlicher Sicht kann der Erfolg bezweifelt werden, aber in politischer Hinsicht hat diese Formulierung die Konvention gerettet. (29)
2.1.2 Allgemeine Prinzipien und allgemeine Staatenpflichten
Der Geist der BRK ergibt sich neben ihrer Zweckbestimmung insbesondere aus den acht allgemeinen Prinzipien, die in Art 3 BRK enthalten sind. Zu ihnen gehören die „Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Unabhängigkeit.“(30) Heiner Bielefeld hat bereits darauf hingewiesen, dass die Betonung der Menschenwürde ein wesentliches Merkmal der BRK ist (31). Das war während der Verhandlungen angesichts der Negation der Menschenwürde behinderter Menschen im Nationalsozialismus aber auch im Hinblick auf die erneute Anzweiflung im Kontext moderner biomedizinischer Debatten auch so gewollt. Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart gab und gibt es einen inhaltlich Konsens in der verfassungsrechtlichen oder menschenrechtlichen Literatur über die unantastbare Menschenwürde behinderter Menschen (32). Autonomie, Unabhängigkeit und die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, werden allgemein als Bestandteile der Menschenwürde aufgefasst. Gerade im Hinblick auf Behinderte mit intellektuellen und/oder psychischen Beeinträchtigungen werden diese Fähigkeiten jedoch in Frage gestellt, weil der Maßstab der Menschenwürde üblicherweise der erwachsene männliche nicht behinderte Mensch ist. Die BRK setzt dagegen einen anderen Maßstab und gewährt auch jenen Autonomie, Unabhängigkeit und die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, die die herkömmlichen Anforderungen an Vernunft und Normalität nicht erfüllen und gegebenenfalls Unterstützung bei der Entscheidungsfindung benötigen. Das wird bekräftigt durch den Grundsatz der „Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit.“ (33)
Das allgemeine Prinzip der „Nichtdiskriminierung“(34) ist das Herzstück der Konvention. Die Gewährung der Menschenrechte ohne Diskriminierung wegen einer Behinderung zieht sich durch den gesamten Text des Vertrags. Das Prinzip der Nichtdiskriminierung wird ergänzt durch die Grundsätze der „Chancengleichheit“(35) und der „volle(n) und wirksame(n) Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“(36) sowie dem Prinzip der „Zugänglichkeit.“(37) Damit soll klargestellt werden, dass Gleichheit behinderter Menschen nicht durch formale Gleichstellung erreicht werden kann (38). Gleichheit ohne Chancengleichheit ignoriert die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, die behinderte Menschen oft haben. Gleichheit ohne Zugänglichkeit bedeutet die Tore für Behinderte zu öffnen, ohne die Barrieren zu beseitigen, die vor ihnen stehen. Und Gleichheit ohne Inklusion bedeutet Assimilation um den Preis der Unterdrückung oder der Vernachlässigung von Differenzen, die wichtig für die Identität oder die Entwicklung der einzelnen Menschen sind. Weil in der BRK das Prinzip der Nichtdiskriminierung begleitet wird von den Grundsätzen der Inklusion, Chancengleichheit und Barrierefreiheit, ist davon auszugehen, dass die BRK einem substantiellen Gleichheitskonzept folgt, das faktische und rechtliche Gleichheit, Gruppenidentität und Dominanzverhältnisse berücksichtigt. Dies ergibt sich auch aus der weiten Definition von Behindertendiskriminierung. Nach Art. 2 BRK bedeutet diese: „jede Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen, Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen oder jedem anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen der Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen“. Damit werden jegliche Formen von Diskriminierung erfasst, direkte und indirekte, aber auch das schlichte Nichtstun, wenn es eine Anpassungspflicht gibt. Letzteres ist mit dem Terminus „Versagung angemessener Vorkehrungen“ gemeint. Der aus dem angloamerikanischen Diskriminierungsrecht stammende Terminus „denial of reasonable accommodations“ wurde insbesondere im Kontext von Behindertengleichstellungsrecht entwickelt. Ihm liegt die Erkenntnis zugrunde, dass behinderte Menschen oft gleichermaßen qualifiziert sind wie Nichtbehinderte, eine Tätigkeit auszuüben, wenn die Bedingungen der Tätigkeit, ihr Kontext oder ihr Umfeld an die individuelle Beeinträchtigung der behinderten Person angepasst werden. Eine Anpassung (Vorkehrung) kann in dem Bau einer Rampe zur Überwindung von Eingangsstufen, in der Stellung eines Gebärdendolmetschers oder in der Gewährung von flexiblen Arbeitszeiten liegen. Sie darf nicht zu einer unzumutbaren Belastung des Verpflichteten führen. Erstmalig im US-amerikanischen Rehabilitation Act of 1973 (Sec. 504) verwandt, wurde es später in das weltweit beachtete Antidiskriminierungsgesetz American with Disabilities Act (1990) (ADA) übernommen, das für viele andere Länder ein Vorbild war (39). Insbesondere im US-amerikanischen Schulrecht und im Arbeitsrecht wurde das Konzept der Diskriminierung durch Verweigerung zumutbarer Anpassungen entwickelt (40). Es führte – wie auch die rechtswissenschaftlichen Diskussionen zur mittelbaren Diskriminierung – zur Ablösung des formalen Gleichheitskonzepts und zur Hinwendung zu einem substantiellen oder materiellen Gleichheitsverständnis. Die BRK definiert „angemessene Vorkehrungen“ als „notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können“(41). Auch in Art. 5 BRK, dem eigentlichen Diskriminierungsverbot wird auf die Anpassungspflicht der „angemessenen Vorkehrungen“ Bezug genommen (42).
Die beiden letzten Grundsätze „die Gleichberechtigung von Mann und Frau“(43) und „die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität“(44) unterstreichen die Bedeutung von geschlechter- und alterssensibler Behindertenpolitik. Weil behinderte Frauen und behinderte Kinder zu den besonders gefährdeten Gruppen gehören, die Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, wurde ihnen jeweils ein eigenständiger Artikel gewidmet. Artikel 6 handelt von behinderten Frauen. Darin wird die mehrdimensionale Diskriminierung behinderter Frauen und Mädchen anerkannt, und die Staaten verpflichten sich, Fördermaßnahmen zur Stärkung und Entwicklung behinderter Frauen zu ergreifen.
Artikel 7 benennt drei wichtige Staatenpflichten, die im Zusammenhang mit der Menschenrechtsverwirklichung von Kindern zu berücksichtigen sind: Erstens die Gleichberechtigung mit nicht behinderten Kindern (Art. 7 (1)), zweitens den Vorrang des Wohls des Kindes bei allen Maßahmen (Art. 7 (2)) und schließlich die Beteiligungsrechte des Kindes und die Gewährleistung seiner Meinungsfreiheit in allen es betreffenden Angelegenheiten (Art.7 (3)). Artikel 7 BRK stellt den Versuch dar, die Kinderrechtskonvention in ihrer Gesamtheit für behinderte Kinder anwendbar zu erklären (45).
Neben weiteren Verweisen auf Kinder und Frauen an verschiedenen Stellen der BRK (46) ist durch die systematische Stellung der Artikel 6 und 7 am Anfang der BRK auch deren horizontale Wirkung für alle in der BRK genannten Menschenrechte gesichert.
Artikel 4 BRK enthält die allgemeinen Pflichten, die die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung dieser Menschenrechtskonvention zu beachten haben, und ist daher als das „rechtliche Herz- stück“ für die Implementierung anzusehen (47). Er enthält eine ganze Reihe allgemeiner Staatenpflichten, die dem bekannten menschenrechtlichen Pflichtentrias der Mitgliedsstaaten, nämlich die Achtung, den Schutz und die Gewährleistung aller Menschenrechte für die BRK konkretisieren. Dazu gehört z.B. nicht nur die Abschaffung und Beseitigung aller konventionswidrigen Gesetze, sondern auch derartiger Praktiken. Die staatliche Pflicht zur Beseitigung von Diskriminierung erstreckt sich auch auf benachteiligendes Verhalten durch private Personen, Organisationen und Unternehmen (48). Für Menschenrechtsverträge neu ist die Pflicht, „den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in allen politischen Konzepten und allen Programmen [zu] berücksichtigen;“(49), was man als Konzept des Disability Mainstreaming interpretieren könnte, auch wenn der Begriff in der BRK ausdrücklich nur für den Bereich der nachhaltigen Entwicklung verwendet wurde (50).
Erstmals in einer Menschenrechtskonvention wurden Staaten zudem verpflichtet, Fachkräfte der Sozialberufe über das Übereinkommen zu schulen. Das Thema der Bewusstseinsbildung wird in Artikel 8 BRK noch einmal gesondert aufgeführt. Die Staaten sind aufgerufen, mit vielfältigen Maßnahmen, „Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen mit Behinderung“(51) zu bekämpfen und in der Gesellschaft allgemein positiv über Behinderung aufzuklären. Dabei haben die Medien eine wichtige Rolle zu spielen (52). Diese Obliegenheit, gehört wie die objektive Pflicht der Herstellung von Barrierefreiheit nach Art. 9 BRK zum Innovationspotenzial der BRK (53).
2.1.3 Die Menschenrechte der BRK
Die BRK enthält siebzehn subjektive Menschenrechte (54), die dem in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung von 1949 und in den beiden internationalen „Kernmenschenrechtspakten“ (Bürgerrechts- und Sozialrechtspakt von 1966) (55) enthaltenen Katalog der Menschenrechte weitgehend entspricht. Die Schaffung neuer oder gar besonderer Menschenrechte war nicht die Intention der Mütter und Väter der BRK (56). Es sollte der vorhandene universal anerkannte Menschenrechtskatalog auf den Kontext von Behinderung zugeschnitten werden, so wie es bei anderen thematischen Menschenrechtsverträgen, wie etwa bei der Frauenrechtskonvention von 1979 oder bei der Kinderrechtskonvention von 1989 vorexerziert worden war. Diese beiden Menschenrechtsverträge, wie auch die Allgemeine Menschenrechtserklärung und die o.g. Kernverträge standen dem Ad-Hoc-Ausschuss, der den Text der BRK ausarbeitete, Modell. Neben dem Recht auf Gleichheit finden sich hier daher auch die anderen klassischen Menschenrechte, wie etwa das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, das Recht auf Anerkennung als Rechtssubjekt und als geschäftsfähig, die Freiheit von Folter, Gewalt und Ausbeutung, das Recht auf Freizügigkeit und Nationalität, oder das Recht auf Meinungsfreiheit, das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Arbeit oder die Rechte auf kulturelle und politische Partizipation. Wie die Kinderrechtskonvention ist der Charakter der BRK weitergehend als eine reine Antidiskriminierungskonvention und umfasst den gesamten Katalog der Menschenrechte, wobei nicht strikt zwischen politischen und bürgerlichen Rechten auf der einen Seite sowie wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten auf der anderen Seite getrennt wird. Abgesehen davon, dass diese künstliche (und eher politisch motivierte) Trennung von Menschenrechten in zwei Gruppen spätestens seit der Wiener Menschenrechtskonferenz von 1992 überholt ist (57), wird gerade bei behinderten Personen deutlich, dass die Realisierung dieser Rechte nur unter Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und Untrennbarkeit realisieren lässt (58).
Als weitere Besonderheit der Behindertenrechtskonvention lässt sich ihre Entwicklungsdimension benennen. Sie ist der erste UN-Menschenrechtsvertrag der einen allein stehenden Artikel zur Internationalen Zusammenarbeit hat (59). Die Bedeutung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit für die nationale und internationale Behindertenpolitik wurde lange unterschätzt. So wurden behinderte Menschen in den acht UN-Milleniumsentwicklungszielen von 2000 (60) zur Bekämpfung von extremer Armut nicht berücksichtigt und waren bis vor einigen Jahren kaum ein Thema bei internationalen und nationalen Entwicklungsorganisationen. Dieser Zustand war angesichts der Tatsache, dass 80 % der über 650 Millionen Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern leben (61), unhaltbar. Die Erreichung der Milleniumsentwicklungsziele, insbesondere die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, ist nicht zu erreichen, wenn eine der größten Minderheiten, die von Armut betroffen ist, nicht ins Visier der Politik und der Programme genommen wird. Seit einigen Jahren macht sich ein Umdenken bei den Organisationen bemerkbar. Die Weltbank und mehrere Geberorganisationen haben sich des Themas verstärkt angenommen, Studien und Politikpapiere veröffentlicht (62) und auch z.B. das Netzwerk Global Partnership for Disability and Develpment (63) gegründet. Die BRK greift diese Entwicklung auf und setzt mit Artikel 32 BRK neue Akzente. Erste Auswirkungen sind bereits zu erkennen. So beschäftigte sich die Soziale Kommission für Entwicklung der Vereinten Nationen in ihrer 46. Sitzung im Februar 2008 mit neuen Ideen für eine behinderungssensible inklusive Entwicklungszusammenarbeit (64).
2.1.4 Umsetzung und Überwachung
Auch im Implementierungsteil enthält die BRK Regelungen mit hohem Innovationspotenzial.
Wie die anderen Menschenrechtspakte wird die BRK auf internationaler Ebene durch einen Vertragsausschuss, bestehend aus zwölf unabhängigen Experten und Expertinnen, überwacht. Die Hauptaufgabe des im November 2008 erstmalig gewählten Ausschusses (65) besteht in der Überprüfung und Bewertung der regelmäßig vorzulegenden Staatenberichte und in der Interpretation der BRK durch so genannte Allgemeine Kommentare (66). Dieses Berichtssystem, das sich in der Vergangenheit bewährt hat, aber auch deutliche Schwächen hinsichtlich seiner Durchführung aufweist (67), wurde für die BRK in einigen Details reformiert, indem Verbesserungsvorschläge, die seit Jahren auf dem Tisch liegen, aufgegriffen wurden (68).
Die Erfahrungen, die mit der Überwachung der BRK gesammelt werden, werden somit auch für das völkerrechtliche Menschenrechtssystem insgesamt von Bedeutung sein und Überlegungen zu dessen Reformierung beeinflussen.
Neben dem Vertragsausschuss wurde auf internationaler Ebene als weiteres neues Organ die Staatenkonferenz zur BRK geschaffen, die für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Durchführung der BRK zuständig ist (69). Sie wählt nicht nur die Ausschussmitglieder (70), sondern ist auch für zukünftige Änderungen der BRK – die gegebenenfalls im Rahmen des angestrebten Reformprozesses notwendig werden – zuständig (71).
Die nationalen Menschenrechtsinstitute erfahren durch die BRK eine besondere Aufwertung, weil die Überwachung der BRK zweigleisig international und national strukturiert ist. Dem internationalen Monitoring wird ein innerstaatliches Durchführungs- und Überwachungssystem zur Seite gestellt. Dieses besteht einerseits aus einem oder mehreren staatlichen Koordinierungsstelle(n) und andererseits aus einem unabhängigen Mechanismus zur „Förderung, den Schutz und die Überwachung der Durchführung dieses Übereinkommens“ (72). Die staatliche Koordinierungsstelle(n) soll(en) sicherstellen, dass die Durchführung der BRK auf allen staatlichen Ebenen erfolgt. Der unabhängige nationale Mechanismus flankiert das internationale Überwachungssystem. Zwar bleibt es den Mitgliedsstaaten vorbehalten zu entscheiden, welche – auch eventuell neu zu schaffende – Institution sie mit diesem nationalem Monitoring betrauen, der indirekte Bezug zu den Pariser Prinzipien von 1993 (73) macht jedoch deutlich, dass hier in erster Linie die nationalen Menschenrechtsinstitute gemeint sind. Damit soll der nationale Menschenrechtsschutz ausgebaut werden, um die Implementierung von Menschenrechtsstandards effektiver zu gestalten. Die Stärkung des nationalen Menschenrechtsschutzes als flankierende Maßnahme zum internationalen Monitoringsystem wurde seit der Wiener Menschenrechtskonvention von 1993 systematisch vorangetrieben. Mittlerweile gibt es nationale Menschenrechtsinstitute (NMRI) in über 100 Ländern, von denen mehr als 60 Institute einen Akkreditierungsstatus nach den Pariser Prinzipien innehaben (74). Sie haben sich zu einem Forum der Nationalen Menschenrechtsinstitute zusammengeschlossen (75) und die akkreditierten NMRIs wählen einen Internationale Koordinationsausschuss (76). Neben der Antifolterkonvention (77) ist die BRK die einzige Menschenrechtskonvention, die einen nationalen Mechanismus vorsieht. Auch in dieser Hinsicht wird es mit der Umsetzung der BRK zu einer Weiterntwicklung des Völkerrechts kommen.
Dem Motto der Entstehungsgeschichte der BRK entsprechend (Nothing about us without us) ist bei der Durchführung und Umsetzung (78) sowie bei der Überwachung (79) der BRK eine umfassende Beteiligung der Zivilgesellschaft, insbesondere der Behindertenverbände, vorgesehen.
2.2 Das Fakultativprotokoll
Das aus achtzehn Artikeln bestehende Fakultativprotokoll (FP) zur BRK sieht als weitere Überwachungsverfahren die Individualbeschwerde (80) und das Untersuchungsverfahren (81) vor. Bei der Individualbeschwerde können sich Individuen oder Personengruppen aus Mitgliedsstaaten an den Genfer Vertragsausschuss mit der Behauptung wenden, Opfer einer Verletzung der BRK zu sein. Dieses Verfahren ist im wesentlich den bereits existierenden Individualbeschwerdeverfahren im UN Menschenrechtssystem nachgebildet. Fünf der acht in Kraft getretenen „Kernmenschenrechtspakte“ enthalten solche Verfahren. Mit der einstimmigen Verabschiedung des Fakultativprotokolls zum internationalen Sozialpakt im Dezember 2008 durch die Generalversammlung der Vereinten Nation (82) wird nun hoffentlich auch bald der Streit um die Justiziabilität der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ein Ende haben (83). Das Individualbeschwerdeverfahren ist ein quasi-gerichtliches Verfahren, das eine gute Ergänzung zum Staatenberichtsverfahren darstellt. Es ermöglicht die Entwicklung einer auf den konkreten Einzelfall bezogenen Judikatur, die der Interpretation der BRK zu Gute kommt, zum anderen aber auch den Mitgliedsstaaten klare Vorgaben zur Umsetzung des Übereinkommens macht. Die wenigen Individualbeschwerdeverfahren, die bislang behinderte Personen betrafen (84), haben jeweils zu einer Weiterentwicklung des Menschenrechtsschutzes geführt.
Das Untersuchungsverfahren, dessen Vorbilder in der Frauenrechtskonvention (85) und in der Antifolterkommission (86) zu finden sind, ermöglicht es dem Vertragsausschuss der BRK schwerwiegende Verletzungen von Menschenrechten – gegebenenfalls vor Ort – vertraulich zu untersuchen. Auch dieses Verfahren gehört zu den Reforminstrumenten im internationalen Menschenrechtsschutz. Dagegen wurde auf die Aufnahme eines Staatenbeschwerdeverfahrens in die BRK verzichtet. Dieses Verfahren, dass die Beschwerde eines Mitgliedsstaats gegen einen anderen Mitgliedsstaat ermöglicht, und in einigen Kernkonventionen enthalten ist, wurde in der Geschichte des UN-Menschenrechtssystems noch nie benutzt. Die Tatsache, dass sie in der BRK nicht enthalten ist, ist ein weiterer Beleg für deren Beitrag zur Weiterentwicklung des internationalen Menschenrechtsschutzes.
3. Deutsche Ratifikation und Umsetzung
3.1 Unterzeichnung, Übersetzung und Ratifikation
Deutschland gehört zu den mehr als achtzig Mitgliedsstaaten, die die BRK und das FP bereits am ersten Tag der Auslegung zur Unterzeichnung, am 30. März 2007 unterzeichnet haben. Gem. Art. 59 Abs. 2 GG war für die Ratifikation die Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates erforderlich. Die Bundesregierung schaffte hierfür mit dem Ratifizierungsgesetzentwurf vom 8.11.2008 die rechtlichen Voraussetzungen (87). Die Veröffentlichung erfolgte am 21. Dezember 2008 (88). Die darin enthaltene deutsche Übersetzung der BRK und die Denkschrift wurden von Politikern, Verbänden und Wissenschaftlern in der Sachverständigenanhörung (89) erheblich kritisiert. Bezüglich der deutschen Übersetzung (90) wird moniert, dass so zentrale Begriffe wie z.B. „inclusion“ mit dem deutschen Wort „Integration“ übersetzt wurden. Diese Übersetzung reflektiert nicht den Paradigmenwechsel, der mit der BRK bezweckt ist und führt auch in der internationalen Kommunikation zu Irritationen. Inklusion wird im politischen und wissenschaftlichen Diskurs als Weiterentwicklung des die Bildungsstrukturen nicht tangierenden Integrationskonzepts gesehen. Die Veröffentlichung einer Schattenübersetzung als Alternative zur amtlichen deutschen Übersetzung ist daher zu begrüßen (91). Für die juristische Interpretation der BRK gilt nach Art. 50 BRK, dass die deutsche amtliche Übersetzung nicht maßgeblich ist, weil sie nicht zu den authentischen Fassungen der BRK gehört (92). Der englischen Fassung der BRK kommt besondere Bedeutung zu, weil sie die vorrangige Verhandlungssprache in den Situationen des Ad-Hoc-Ausschusses war, in denen ohne Simultandolmetscher verhandelt werden musste (93).
Bezüglich der Denkschrift ist zu beanstanden, dass die Bundesregierung darin erklärt, die Implementierung der BRK in die deutsche Rechtsordnung erfordere weder Gesetzesreformen, noch sei sie mit – über die Einrichtung des nationalen Monitoring hinausgehenden – besonderen Kosten verbunden. Aus den Verhandlungen des Ratifizierungsgesetzes geht jedoch hervor, dass hierüber keinesfalls Konsens in der Legislative bestand (94). Auch das wird für zukünftige juristische Interpretationen des Ratifikationsgesetzes relevant sein.
Die BRK ist international am 3. Mai 2008 (95) und in Deutschland am 26. März 2009 (96) in Kraft getreten. Begrüßenswert ist, dass sowohl das Übereinkommen als auch das Fakultativprotokoll von deutscher Seite vorbehaltlos und ohne Interpretationserklärung ratifiziert wurden, und damit die BRK uneingeschränkt im deutschen Rechtkreis wirksam wurde. Bedauerlich ist, dass es im Ratifikationsprozess nicht zu einer Nachbesserung der deutschen amtlichen Übersetzung kam. Dieses hatten nicht nur nahezu alle Sachverständigen in der Anhörung des Bundestages gefordert (97), sondern auch das Deutsche Institut für Menschenrechte in einer Sonderpublikation zur Ratifikationsdebatte empfohlen (98).
3.2 Erste Umsetzungsschritte
Die Bundesregierung hat dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Federführung für die BRK übertragen und zugleich die Koordinationsstelle gem. Art. 33 Abs.1 BRK dort angesiedelt. Sie hat weiterhin das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR) mit der Begleitung der Umsetzung des Übereinkommens beauftragt und bei ihm die unabhängige Monitoring-Stelle gem. Art. 33 Abs. 2 BRK eingerichtet. Insbesondere letztere Entscheidung ist zu begrüßen, denn die Ansiedlung der unabhängigen Monitoringstelle beim DIMR sichert die Einbindung der Behindertenfrage in das noch junge System (99) des deutschen Menschenrechtsschutzes. Wie in vielen anderen Staaten wurde auch in Deutschland die Behindertenpolitik lange Zeit nicht als Thema der Menschenrechtspolitik angesehen. Der spätestens mit der Reformierung des Rehabilitationsrechts (SGB XI von 2001) und dem Erlass des Behindertengleichstellungsgesetzes von 2002 einsetzende Wandel von der traditionellen Fürsorgepolitik zu einer Behindertenpolitik der Selbstbestimmung und Gleichberechtigung war der erste Schritt eines Paradigmenwechsels, der nun mit der BRK auch den Menschenrechtsansatz aufnimmt. Welche weiteren legislativen Maßnahmen zur Umsetzung der BRK in Deutschland erforderlich sind, wird eine wesentliche Frage des nun anstehenden Implementationsprozesses sein. Erste rechtliche Gutachten, die den Weg weisen könnten, liegen bereits vor (100).
4. Das Recht auf Bildung in der Behindertenrechtskonvention
4.1 Art. 24 BRK – Entstehungsgeschichte
Das Recht auf Bildung wird in der BRK insbesondere in Art. 24 geregelt, der folgenden Wortlaut hat:
Artikel 24 Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,
a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;
b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;
c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige
Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;
e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und
soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.
(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem
a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;
b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;
c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.
(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.
(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden.
Um das Recht auf Bildung für behinderte Kinder und Erwachsene wurde in dem Ad-Hoc-Ausschuss lange gestritten (101). Konfliktpunkt war insbesondere die Frage, ob das Recht auf Bildung ein Wahlrecht hinsichtlich der Bildungsinstitution enthalte. Einige Stimmen wollten Eltern und ihren behinderten Kindern ein Wahlrecht auf inklusive Beschulung geben und die Sonderbeschulung behinderter Kinder als Ausnahmemöglichkeit festschreiben. Andere Stimmen wollten ein Menschenrecht auf Sonderbeschulung bzw. auf sonderpädagogische Bildung als gleichberechtigtes Wahlrecht stipulieren. Dagegen votierten jene, die eine Abschaffung von Sonderschulen als Ziel der BRK festschreiben wollten. Die Vertreter und Vertreterinnen der Gehörlosen-, Blinden- und Taubblindenverbände forderten das Recht auf Unterricht in Gebärdensprache bzw. mit Braille oder mit anderen Mitteln der Kommunikation. Im ersten Entwurf der BRK, die von der Arbeitsgruppe des Ad-Hoc Ausschusses ausgearbeitet wurde, war noch ein Wahlrecht auf inklusive Bildung enthalten (102). Die Diskussionen im Ad-Hoc-Ausschuss führten letztendlich dazu, von der Formulierung eines Wahlrechts Abstand zu nehmen und ein Menschenrecht auf inklusive Bildung für alle behinderte Menschen – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Sinnesbehinderungen – anzuerkennen (103).
Eine weitere Frage, die diskutiert wurde, war die Frage, welche Terminologie „integration“ oder „inclusion“ für das Ziel der gemeinsamen Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern verwendet werden soll. Diesbezüglich einigte man sich unter Bezugnahme u.a. auf die UNESCO Salamanca Erklärung von 1994 (104) auf den letzteren Begriff. Vorbilder für die endgültige Fassung des Artikels 24 BRK waren insbesondere die Kinderrechtskonvention und das Recht auf Bildung im Internationalen Sozialpakt.
4.2 Recht auf Bildung als Menschenrecht
Das Recht auf Bildung ist seit langem im Völkerrecht als Menschenrecht anerkannt. Es ist in allen Kernmenschenrechtskonventionen enthalten (105). Katarina Tomasevsky, die von 1998–2004 die erste Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für das Recht auf Bildung war, charakterisierte einmal die vier historischen Abschnitte der graduellen Verwirklichung des Rechtes auf Bildung als Menschenrecht in den meisten Staaten der Vereinten Nationen. Die erste Phase kennzeichne sich durch die Anerkennung eines Rechts auf Bildung, von dem allerdings einige Menschen – wie Immigranten oder Dienstboten – ausgeschlossen würden. Daran an schließe sich eine Phase der Realisierung des Rechts auf Bildung durch Separation. Mädchen, behinderten Kindern oder Migrantenkindern werde zwar ein Recht auf Bildung zugestanden, jedoch nur in gesonderten Schulen. In der dritten Phase sei das Ziel die Integration, die jedoch durch Assimilation erlangt werde. Nur denjenigen werde Zugang zum allgemeinen Schulsystem gewährt, die sich der Norm anpassen könnten, etwa auf der sprachlichen Ebene (Migrantenkinder), oder hinsichtlich funktioneller Voraussetzungen (behinderte Kinder). Erst in der vierten Phase werde inklusive Bildung durch Anpassung und Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen angestrebt (106). Diese vier historischen Phasen der Anerkennung eines Rechts auf Bildung spiegeln sich in den verschiedenen Menschenrechtsinstrumenten der Vereinten Nationen wider. Wegweisend für die Abkehr vom separierenden Bildungssystem war insbesondere die UNESCO-Konvention gegen Diskriminierung im Unterrichtswesen von 1960. Sie verbietet die Errichtung oder den Erhalt
getrennter Bildungssysteme für bestimmte Individuen oder Gruppen, sowie die Bildung unter unwürdigen Bedingungen als Formen der Bildungsdiskriminierung (107). Getrennte Bildungsinstitutionen sind lediglich aufgrund von Geschlecht, Religion oder Sprache bzw. als private Institutionen erlaubt. Sie dürfen nicht zu einem niedrigeren Bildungsstandard für diese Gruppen führen und müssen Wahlfreiheit zwischen allgemeiner oder Sonderschule erlauben (108).
Was positiv unter diskriminierungsfreier Bildung zu verstehen ist, hat der Ausschuss für Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte, der der Überwachungsausschuss des Internationalen Sozialpakts ist, mit seinem 1999 verabschiedeten Allgemeinen Kommentar Nr. 13 konturiert. Diskriminierungsfreie und den Menschenrechtsstandards entsprechende Bildung muss danach vier Vorgaben erfüllen, die im internationalen Diskurs als „4-A-Scheme“ bezeichnet wird: Sie muss für alle Menschen ausnahmslos verfügbar sein (Availability), sie muss für alle zugänglich sein (Accessibility), sie muss drittens annehmbar sein (Acceptability) und sie muss für verschiedene Menschen in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten adaptierbar und flexibel (Adaptability) sein (109).
Das Recht auf Bildung für behinderte Kinder wurde in den 1980er Jahre durch die UNESCO verstärkt aufgegriffen (110). Dabei wurde zunächst festgestellt, dass in vielen Ländern, behinderte Kinder gesetzlich oder faktisch von der Schulpflicht ausgeschlossen wurden. Die weltweite Anerkennung eines Rechts auf Bildung für behinderte Kinder (in Sonderschulen) war das zentrale Anliegen der Vereinten Nationen in dieser Zeit. Ein Anspruch auf integrative Bildung wurde erstmals am Ende der UN-Behindertendekade (1983–1992) in den UN-Rahmenbestimmungen von 1993 festgeschrieben (111) und durch den Allgemeinen Kommentar No 5 des Ausschusses für Wirtschaftliche und Soziale Rechte auf den Internationalen Sozialpakt übertragen (112).
Mit der UNESCO-Deklaration von Salamanca wurde 1994 das Recht auf inklusive Bildung auch für behinderte Kinder angewandt. Der Kinderrechtsausschuss der Kinderrechtskonvention nahm diesen Begriff zuerst auf und beschrieb den Wandel von der Integrations- zur Inklusionspolitik für behinderte Kinder als Wandel von der Assimilierung zur individuellen und an Gleichberechtigung orientierten Bildungspolitik (113). Diese Auffassung wird in seinem 2006 verabschiedeten Allgemeinen Kommentar Nr. 9 zu den Rechten behinderter Kinder in der Kinderrechtskonvention bekräftigt. Dort wird dem Unterschied zwischen integrativer und inklusiver Bildungspolitik ein ganzer Abschnitt gewidmet (114). Auch der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, Vernor Muñoz, hat in seiner Studie zum Recht auf Bildung für behinderte Kinder das Recht auf inklusive Bildung zum zentralen Wesensgehalt des Menschenrechts auf Bildung für behinderte Personen erklärt und konkrete inhaltliche Vorgaben zur Umsetzung dieses Menschenrechts gemacht (115).
Artikel 24 BRK stellt den vorläufigen Abschluss der schrittweisen Anerkennung des Rechts auf inklusive Bildung für Menschen mit Behinderung dar. Sonderschulen werden durch Art. 24 BRK zwar nicht kategorisch verboten, die systematische Aussonderung behinderter Personen aus dem allgemeinen Bildungssystem stellt allerdings eine Vertragsverletzung dar.
4.3 Bedeutung für Deutschland
Das deutsche Bildungssystem wurde in jüngerer Zeit mehrfach als diskriminierend kritisiert. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich in Deutschland eine Elternbewegung formiert, die beharrlich und in einigen Bundesländern gemeinsame Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder durchsetzen konnte (116). Moniert wurde die Aussonderung behinderter Kinder aus dem allgemeinen deutschen Bildungssystem auch vom Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf Bildung Vernor Muñoz bei seinem Besuch in Deutschland im Februar 2007. In seinem Bericht klagt Muñoz insbesondere die deutsche Integrationspolitik als eine Politik der Segregation zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern an. Hier empfiehlt er eine Umorientierung hin zu einer Politik der Inklusion und der Stärkung des rechtsbasierenden Ansatzes in der Bildungspolitik (117).
Das Inkrafttreten der BRK in Deutschland löst Vertragspflichten für die Bundesregierung, aber insbesondere für die Landesgesetzgeber aus, da das Bildungsrecht der Gesetzgebungskompetenz der Länder unterliegt. Die Länder sind nach dem Lindauer Abkommen und nach dem Grundsatz der Bundestreue verpflichtet, ihre Schulgesetze gegebenenfalls entsprechend Art. 24 BRK zu reformieren (118). Die Konferenz der Kultusminister hat bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland entsprechend fortschreiben wird (119).
Daneben erlangt das Recht auf inklusive Bildung aus Art. 24 BRK aber auch unmittelbare Geltung insoweit, als es ein Verbot der Diskriminierung behinderter Menschen im Bildungsbereich enthält. Völkerrechtliche Diskriminierungsverbote haben individualschützende und unmittelbare Wirkung, selbst wenn es sich bei dem zu realisierenden Recht um ein wirtschaftliches, soziales oder kulturelles Menschenrecht handelt (120). Damit sind Schulbehörden und deutsche Gerichte bereits jetzt angehalten, behinderte Schüler inklusiv zu beschulen. Wie weit dabei auch Kosten entstehen dürfen, die bei der Beschulung eines nicht behinderten Kindes nicht entstehen, muss im Einzelfall entschieden werden. Bereits in der Sonderschulentscheidung von 1997 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es eine Verletzung des verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbots aus Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG darstellt, wenn „die Sonderschulüberweisung erfolgt, obgleich der Besuch der allgemeinen Schule durch einen vertretbaren Einsatz von sonderpädagogischer Förderung ermöglicht werden könnte.“(121) Diese Rechtsprechung muss nun im Lichte des Art. 24 iVm Art. 5 (Diskriminierungsverbot) BRK weiterentwickelt werden. Sie ist insofern überholt, als das Gericht dem Landesgesetzgeber einen hohen Einschätzungsspielraum zubilligte, welche Form der integrativen Beschulung für das jeweilige Land bereitgehalten werden muss. Hier setzt das in Art. 24 BRK kodifizierte Menschenrecht auf inklusive Bildung neue Maßstäbe, die zur Zeit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht bekannt waren. Auch der in der Entscheidung entwickelte allgemeine Vorbehalt vorhandener pädagogischer, organisatorischer, personeller und finanzieller Mittel (122) als Schranke für das Grundrecht auf diskriminierungsfreie Bildung für behinderte Kinder ist seit dem Inkrafttreten der BRK in Deutschland so nicht mehr aufrecht zu erhalten. Die BRK enthält nämlich einen Diskriminierungsbegriff, der in der deutschen Rechtsordnung bislang kaum bekannt ist (123). Art. 5 BRK verbietet jede Form der Diskriminierung und verpflichtet zur Gewährleistung angemessener Vorkehrungen, die in Art. 2 BRK definiert werden (124). Der individualrechtliche Anspruch auf angemessene Vorkehrungen wurde ausdrücklich auch im Recht auf inklusive Bildung der BRK aufgenommen (Art. 24 Abs. 2 lit. c) und ist daher im Schulrecht anzuwenden. Der Anspruch auf angemessene Vorkehrung (englisch: reasonable accommodation) als Bestandteil des Antidiskriminierungsrechts stellt eine Weiterentwicklung
des deutschen Rechts dar. Er wurde zwar durch die EU-Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichberechtigung in Beschäftigung und Beruf vom 27. November 2000 auch für den deutschen Rechtsraum verbindlich (125), und das Schwerbehindertenrecht kennt auch einen subjektiven Anspruch auf behindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes (§ 81 SGB XI). Er wurde aber bislang nicht eindeutig in das deutsche Behindertengleichstellungsrecht übernommen. So ist er weder im Behindertengleichstellungsgesetz von 2002 noch im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz von 2006 enthalten (126). Eine völkerrechtskonforme Auslegung des verfassungsrechtlichen Benachteiligungsverbotes für Behinderte in Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG müsste daher über das Sonderschulurteil des Bundesverfassungsgerichts hinausgehen und den neuen Diskriminierungsbegriff der BRK berücksichtigen. Was im Einzelfall als angemessene Vorkehrung zur inklusiven Beschulung verlangt werden kann, dafür gibt es Anhalte in der europäischen und transatlantischen Rechtsprechung zum Begriff des reasonable accommodation im Behindertengleichstellungsrecht (127). Die extrem hohe deutsche Exklusionsquote von über 80 % der behinderten Schüler und Schülerinnen (128) aus dem Regelschulsystem stellt jedenfalls ein deutliches Indiz für eine mittelbare Diskriminierung Behinderter im deutschen Bildungssystem dar. In der europäischen Menschenrechtssprechung gelten derartige statistische Befunde bereits seit einigen Jahren als Beweis für Diskriminierung. So entschied der Europäische Menschengerichtshof im Fall D.H. & Others v. the Czech Republik (129) dass das Recht von Roma Kindern auf diskriminierungsfreie Bildung aus Art. 14 EMRK, Art. 2 ZP EMRK verletzt ist, weil sie überproportional in Schulen für Lernbehinderte beschult werden. Der Europäische Ausschuss für Soziale Rechte hat in zwei jüngeren Entscheidungen eine Verletzung des Rechts auf diskriminierungsfreie Bildung nach der Europäischen Sozialcharta (130) in Frankreich und in Bulgarien wegen mangelnder inklusiver Bildungsangebote für (geistig) behinderte Kinder festgestellt (131).
5. Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die BRK behindertenpolitische wie völkerrechtliche Vorgaben für eine Weiterentwicklung des Rechts und der Praxis hin zu einem modernen Menschenrechtsschutz enthält. Sie manifestiert behindertenpolitisch den Paradigmenwechsel vom medizinischen zum menschenrechtlichen Modell von Behinderung. Völkerrechtlich wird mit ihr der innerstaatliche Menschenrechtsschutz gestärkt und der internationale Überwachungsmechanismus reformiert.
Die BRK orientiert sich an den anderen „Kernmenschenrechtsverträgen“ und interpretiert den allgemein anerkannten Katalog der Menschenrechte im Hinblick auf behinderte Menschen. Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung das Übereinkommen und sein Fakultativprotokoll vorbehaltlos ratifiziert hat. Damit ist der Inhalt der Konvention im vollen Umfang im deutschen Rechtskreis wirksam geworden. Das Recht auf Bildung wurde durch die BRK für behinderte Menschen als Recht auf inklusive Bildung ausgestaltet, das eine Weiterentwicklung des Rechts auf integrative Bildung darstellt. Die Landesgesetzgeber sind nun verpflichtet, die Schulgesetze (wie auch die Hochschulgesetze und Kindertagesstättengesetze) – soweit sie den neuen Anforderungen nicht entsprechen – zu ändern. Darüber hinaus hat Art. 24 BRK auch unmittelbare individualrechtliche Wirkung, da es ein Diskriminierungsverbot enthält. Seit dem 26. März 2009 dürfen Schulbehörden und Gerichte nicht mehr behinderte Schüler und Schülerinnen diskriminieren, indem sie sie zwangsweise in Sonderschulen beschulen, selbst wenn ihre inklusive Beschulung mit Kosten und anderen Maßnahmen verbunden ist. Mit der BRK wurde ein neuer Diskriminierungsbegriff in die deutsche Rechtsordnung eingeführt, der die bisherige deutsche Schulpolitik, die über 80 % der behinderten Schüler und Schülerinnen aussondert, als mittelbare Diskriminierung charakterisieren lässt.
Verf.: Prof. Dr. Theresia Degener, LL.M., Evangelische Fachhochschule Rheinland Westfalen- Lippe, Bochum, und University of the Western Cape, Kapstadt, Immanuel-Kant Str. 18–20, 44803 Bochum, E-Mail: degener@efh-bochum.de
Anmerkungen:
1. UN GA Res. 61/106 of 13 December 2006.
2. Artikel 42 und 44 BRK und Art. 12 des dazu gehörenden Fakultativprotokolls. Die Europäischen Gemeinschaften unterzeichneten die BRK am 30. März 2007.
3. Müller, A./Seidensticker, F., Handbook: The Role of National Human Rights Institutions in the United Nations Treaty Body Process, German Institute for Human Rights, Berlin 2007.
4. Status am 25. April 2009.
5. Vgl. Arbeitsgemeinschaft Disability Studies in Deutschland: Woher kommen die Disability Studies? www.disabilitystudies.de/studies.html (30.03.2009); Oliver, M., Understanding Disability: From Theory to Practice, New York 1996; Snyder, S., Disability Studies, in: Albrecht, G. (Hrsg.) Encyclopedia of Disability, Thousand Oaks, London 2006, Bd. 1, S. 478–489.
6. Bickenbach, J.E. et. al., Models of disablement, universalism and the international classification of impairments, disabilities and handicaps, in: Social Science and Medicine, 1999, 48, S. 1173–1187; Hirschberg, M., Die Klassifikationen von Behinderung der WHO, IMEW Expertise 1, Berlin 2003.
7. Degener, T./Koster-Dreese, Y. (Hrsg.), Human rights and disabled persons: Essays and relevant human rights instruments, International Studies in Human Rights 40, Dordrecht 1995; Degener, T./Quinn, G., A Survey of International, Comparative and Regional Disability Law Reform, in: Breslin, M.L./Yee, S. (Hrsg.) Disability Rights Law and Policy: International and National Perspectives, New York 2002, S. 3–128; Quinn G./Degener T., et. al., Human rights and disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability, OHCHR, United Nations, New York/Geneva 2002.
8. Degener, T., Antidiskriminierungsrechte für Behinderte: Ein globaler Überblick, in: ZaöRV 65, 2005, S. 887–935.
9. Waddington, L., From Rome to Nice in a Wheelchair. The Development of a European Disability Policy 2006.
10. Degener, T./Quinn, G., United Nations Disability Convention, in: Albrecht G. (Hrsg.) Encyclopedia of Disability, Bd. 4, Thousand Oaks, London 2006, S. 1580–1584.
11. Degener, T., vgl. Anm. 8.
12. http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/D4D11908028E486EC1257571005A73EE?opendocument (Zugriff am 05. April 09).
13. World Programme of Action Concerning Disabled Persons Res. A/37/52 of 3 December 1982.
14. Standard Rules on the Equalizations of Opportunities for Persons with Disabilties, Res. A/48/96 of 20 December 1993.
15. Degener, T./Koster-Dreese, Y., Anm. 7, S. 9 ff.; Degener, T., Eine UN-Menschenrechtskonvention für Behinderte als Beitrag zur ethischen Globalisierung, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte“, Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ B 8/2003 vom 17.02.2003, S. 37–45.
16. Z.B. Disabled Peoples’ International, Rehabilitation International, Inclusion International, World Federation of the Deaf, World Federation of the Deafblind, World Blind Union, World Network of Users and Survivors of Psychiatry, vgl. www.internationaldisabilityalliance.org (05.05.2009).
17. Die Verfasserin war als Beraterin der Bundesregierung Mitglied der deutschen Regierungsdelegation. Einige Staaten, wie etwa Südafrika und Uganda entsandten Delegationen mit ausschließlich behinderten Mitgliedern.
18. Federführend waren das Hohe Kommissariat für Menschenrechte und die Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten und die UN Sonderberichterstatterin für Behinderte.
19. Aktiv waren insbesondere die Internationale Arbeitsorganisation, WHO, UNICEF, UNESCO und die Weltbank.
20. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
21. Optional Protocol (OP).
22. Bielefeld, H., Zum Innovationspotenzial der Behindertenrechtskonvention, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2006, S. 6.
23. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau von 1979.
24. Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung von 1965.
25. Vgl. Art. 9 Abs. 2 lit.b) BRK den barrierefreien Zugang zu für die Allgemeinheit bestimmten Einrichtungen und Dienstleistungen betreffend und Art. 21 lit.c) BRK hinsichtlich des Zugangs zu barrierefreier Information.
26. So auch Aichele, V., Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihr Fakultativprotokoll: Ein Beitrag zur Ratifikationsdebatte, Deutsches Institut für Menschenrechte: Berlin 2008, S. 5; Schmahl, S., Menschen mit Behinderungen im Spiegel des internationalen Menschenrechtsschutzes, in: ARV 45, 2007, S. 517–540 (529).
27. Präambel Abschnitt e).
28. Vgl. Degener, T., Menschenrechtsschutz für behinderte Menschen. Vom Entstehen einer neuen Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen. in: Vereinte Nationen 3, 2006, S. 104–110; Bernstorff, J., Menschenrechte und Betroffenenrepräsentation: Entstehung und Inhalt eines UN-Antidiskriminierungsübereinkommens über die Rechte von behinderten Menschen, ZaöRV 67, 2007, S.1041–1063 (1047).
29. Degener, T., Welche legislativen Herausforderungen bestehen in Bezug auf die nationale Implementierung der UNBehindertenrechtskonvention in Bund und Ländern? in: Behindertenrecht 02/2009, S. 34–52, sowie Kayess, R./ French, P., “Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities” in: Human Rights Law Review 8 (1), 2008, S. 1–34 (21).
30. Art. 3 a) BRK.
31. Bielefeld, Anm. 22.
32. Degener, T., “Menschenwürde und Behinderung“ (10. Jan. 09). Zum Begriff der Menschenwürde im Kontext von Behinderung vgl. auch Welti, F., Behinderung und Rehabilitation im sozialen Rechtsstaat, Tübingen 2009, S. 381 ff.
33. Art. 3 d) BRK.
34. Art. 3 b) BRK.
35. Art. 3 e) BRK.
36. Art. 3 c) BRK.
37. Art. 3 f) BRK.
38. Quinn, G./Degener, T. et. al., Human rights and disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability, OHCHR, United Nations, New York/Geneva, 2002.
39. Degener, T., Antidiskriminierungsrechte für Behinderte: Ein globaler Überblick, in: ZaöRV 65, 2005, 887–935.
40. Waddington, L., in: Schiek, D./Waddington, L./Bell, M., Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, 2007, S. 629 ff.
41. Art. 2 BRK.
42. Art. 5 Abs. 3 BRK: Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.“
43. Art. 3 g) BRK.
44. Art. 3 h) BRK.
45. Da behinderten Kindern mit Art. 23 der Kinderrechtskonvention (KRK) ein eigenständiger Artikel gewidmet ist, tendierten die Mitgliedsstaaten der KRK in der Vergangenheit dazu, nur diesen auf behinderte Kinder anzuwenden. Der Kinderrechtsausschuss stellt in seinem Allgemeinen Kommentar Nr. 9 aus dem Jahre 2006 klar, dass die gesamte KRK auf behinderte Kinder anwendbar ist. Vgl. Committee on the Rights of the Child, General Comment, No 9, 2006, The rights of children with disabilities, CRC/C/GC/9 of 27, February 2007.
46. Z.B. in dem für diese Gruppen so wichtigen Artikel 16 (Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch).
47. Aichele, V., Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihr Fakultativprotokoll: Ein Beitrag zur Ratifizierungsdebatte, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2008, S. 6.
48. Art. 4 Abs. 1 lit. e) BRK, dazu oben S. 10, sowie United Nations/Inter-Parliamentary Union (UN/IUP): From Exclusion to Equality: realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for Parliamentarians on the Convention on the rights of Persons with Disabilities, Geneva 2007, S. 18; Schmahl, S., Menschen mit Behinderungen im Spiegel des internationalen Menschenrechtsschutzes, in: ARV 45, 2007, S. 517–540 (529).
49. Art. 4 Abs. 1 lit. c) BRK.
50. Präambel lit. g) BRK; vgl. zum Begriff Grüber, K., Disability Mainstreaming, IMEW konkret Nr. 10, Dezember 2007, Online Version, www.imew.de/index.php (aufgerufen 10.05.2009).
51. Art. 8 Abs.1 lit. b) BRK.
52. Art. 8 Abs. 2 lit. c) BRK.
53. Zum Innovationspotenzial vgl. Bielefeld, H., 2006, vgl. Anm. 22; zu der Unterscheidung zwischen subjektiven Rechten und objektiven Pflichten und Prinzipien vgl. United Nations/Interparliamentary Union, 2007, a.a.O., Anm. 48, S. 14 ff.
54. UN/IUP (2007) a.a.O., Anm. 48, S. 15 f.
55. Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
56. Zur Entstehungsgeschichte vgl. Degener und Bernstorff a.a.O., vgl. Anm. 28.
57. Dazu Klein, E./Menke, C. (Hrsg.), Universalität – Schutzmechanismen – Diskriminierungsverbote: 15 Jahre Wiener Weltmenschenrechtskonferenz, Berlin 2008.
58. Quinn/Degener, a.a.O., Anm. 38, S. 12.
59. Art. 32 BRK.
60. UN A/Res/55/2 18 September 2000.
61. UN (2006): Enable Fact sheet www.unmillenium,project.org (Aufruf 17.03.2008).
62. Braithwaite, J./Mont, D., Disability and Poverty. A Survey of World Bank Poverty Assessments and Implications, SP Discussion Paper No 0805, The World Bank, February 2008; World Bank: Social Analysis and Disability: A Guidance Note. Incorporating Disability-Inclusive Development into Bank-Supported Projects. Social Development Department in Partnership with the Human Development Network`s Social Protection, Disability & Development Team, Washington, March 2007; European Commission: Guidance Note on Disability and Development, 2004 ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdf (Aufruf 15.3.2008); GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) Behinderung und Entwicklung. Ein Beitrag zur Stärkung der Belange von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, Politikpapier, Eschborn, 2006.
63. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:21036173~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282699,00.html (Aufruf 15.5. 2009).
64. United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) (2007): Commission for Social Development 46th Session, 6–15 February 2008. Mainstreaming disability in the development agenda. Note by the Secretariat, E/CN.5/2008/6 of 23 November 2007 www.un.org/disabilities/documents/reports/e-cn5-2008-6.doc (Aufruf 11.9.2008).
65. http://www2.ohchr.org/ (05.05.2009).
66. Art. 34–39 BRK.
67. Dazu Schöpp-Schilling, B., Möglichkeiten der Effektuierung des vertragsbasierten Menschenrechtsschutzes, in: Klein/Menke, a.a.O., Anm. 57, S. 143 ff. und Klein, E., Zur Effektuierung des vertragsbasierten Menschenrechtsschutzes – Kommentar, in: ebd., S. 159 ff.
68. Etwa hinsichtlich der Erstellung der Staatenberichte, die nun leichter aber auch transparenter zu erstellen sind (Art. 35 Abs. 4 BRK), oder bezüglich der Überprüfung der Staaten, die keine Berichte vorlegen (Art. 36 Abs. 2 BRK), oder hinsichtlich der Einbeziehung der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen (Art. 36 Abs. 5 BRK).
69. Art. 40 BRK.
70. Art. 34 Abs. 5 BRK.
71. Art. 47 BRK.
72. Art. 33 BRK.
73. Dabei handelt es sich um Richtlinien hinsichtlich der Errichtung nationaler Menschenrechtsinstitutionen und der Wahrung ihrer Unabhängigkeit. Anhang der UN-Resolution UN Doc. A/RES/48/134 vom 20. Dezember 1993.
74. Müller, A./Seidensticker, F., Handbook: The Role of National Human Rights Institutions in the United Nations Treaty Body Process, Berlin: German Institute for Human Rights, December 2007, S. 33, Anm. 77.
75. www.nhri.net (Aufruf 05.05.2009).
76. International Coordination Committee, Zur Rolle der NMRI vgl. Aichele, V., Nationale Menschenrechtsinstitutionen, Frankfurt am Main 2004.
77. Vgl. den Nationalen Präventionsmechanismus nach Art. 3 des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe.
78. Art. 4 Abs. 3 BRK.
79. Art. 33 Abs. 3 BRK.
80. Art. 1 FP, BRK.
81. Art. 6 FP, BRK.
82. UN Doc. A/RES/63/117 vom 10. Dezember 2008.
83. Schneider, J., Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin, Februar 2004.
84. Insbesondere behinderte Gefangene betreffend, Quinn/Degener, a.a.O., Anm. 38 S. 48 ff.
85. Art. 8 FP zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau.
86. Art. 11 FP zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe.
87. BT-Drs 16/10808 vom 8.11.2008.
88. BGBl. II 2008, S.1419.
89. In der 106. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am 24. November 2008, vgl. dazu Ausschussdrucksache 16(11)1186 vom 21.11.2008.
90. Die mit Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmt wurde.
91. http://www.netzwerk-artikel-3.de/dokum/schattenuebersetzung-un-konvention.pdf (aufgerufen am 20.11. 2008).
92. Es gibt sechs authentische Sprachfassungen: englisch, französisch, arabisch, chinesisch, russisch und spanisch, vgl. Art. 50 BRK und Art. 18 FP.
93. Während die Plenarsitzungen von 10–18 Uhr in der Regel mit Simultanübersetzungen in den sechs UN-Sprachen stattfanden, wurde davor und danach, sowie während der oft gleichzeitig stattfindenden informellen Zusammenkünften, die durch Fazilitatoren zur Klärung von Einzelfragen geleitet wurden, auf englisch kommuniziert. Zur Frage der besonderen Bedeutung der faktischen Verhandlungssprache vgl. Latham/Watkins, Völkerrechtliche Fragen des Inklusiven Unterrichts in Deutschland im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Gutachten erstellt für die Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam leben – gemeinsam lernen e.V., April 2009, Manuskript, S. 4 m.w.N.
94. Vgl. BT-Drs 16/11234 vom 3.12.2008.
95. Gem. 45 Abs. 1 BRK und Art. 13 Abs. 2 FP BRK nach Hinterlegung der zwanzigsten bzw. zehnten Ratifikationsurkunde.
96. Gem. Art. 45 Abs. 2 BRK dreißig Tage nach der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde.
97. Vgl. Anm. 88.
98. Aichele, a.a.O., Anm. 26, S. 15.
99. Das DIMR wurde erst 2001 eingerichtet, während in anderen Ländern, wie z.B. Kanada, Südafrika oder Neuseeland nationale Menschenrechtsinstitute bereits seit Jahrzehnten bestehen.
100. Degener, T., Welche legislativen Herausforderungen bestehen in Bezug auf die nationale Implementierung der UNBehindertenrechtskonvention in Bund und Ländern? Br 02/2009 S. 34–51; Poscher, R./Rux, J./Langer, T., Von der Integration zur Inklusion: Das Recht auf Bildung aus der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen und seine innerstaatliche Umsetzung, Baden-Baden 2008; Kaleck, W./Hilbrans, S./Scharmer, S., Gutachterliche Stellungnahme: Ratifikation der UN Disability Convention vom 30.03.2007 und Auswirkung auf die Gesetze für so genannte psychisch Kranke am Beispiel der Zwangsunterbringung und Zwangsbehandlung nach dem PsychKG, Berlin 2007 (Manuskript).
101. Vgl. bereits Degener, a.a.O., Anm. 28.
102. Art. 17 (2) (a) Draft comprehensive and integral international convention on the protection and promotion of the rights and dignity of persons with disabilities, Report of the Working Group to the Ad Hoc Committee A/ AC.265/2004/WG.1 of 27 January 2004.
103. Die von Poscher et. al. vertretene Ansicht, dass lediglich die Inklusion von 80–90 % aller behinderter Schüler und Schülerinnen durch die BRK bezweckt sei, kann allerdings nicht gefolgt werden. Vgl. Poscher, R. et. al., a.a.O., Anm. 99, S. 27 f. Es wurde während der Verhandlungen des Ad-Hoc-Ausschusses in New York absichtlich vermieden, eine statistische Grenze zu nennen. Das Handbuch für Parlamentarier und Parlamentarierinnen, das nach dem Abschluss der Verhandlungen von den Vereinten Nationen und der Interparlamentarischen Union herausgegeben wurde, nennt diese Zahl nicht als Grenze, sondern als Erfahrungswert für einfache Inklusion. Vgl. United Nations, a.a.O., Anm. 48, S. 85.
104. UNESCO (Hrsg.), Die Salamanca Erklärung über Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik für besondere Bedürfnisse, www.unesco.at/user/texte/salmanca.htm (aufgerufen am 15.10.2007).
105. Übersicht bei Motakef, M., Das Menschenrecht auf Bildung und der Schutz vor Diskriminierung: Exklusionsrisiken und Inklusionschancen, Deutsches Institut für Menschenrechte, Berlin 2006, S. 12 ff.; für das Europäische Recht vgl. Langenfeld, C., Das Recht auf Bildung in der Europäischen Menschenrechtskonvention, RdJB 2007, S. 412–429.
106. Report of the Special Rapporteur Katarina Tomasevski, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 2002/23, E/CN.4/2003/913 December 2002, Abs. 25–27.
107. Art. 1 Abs. 1 c) und d) UNESCO-Konvention.
108. Art. 2 UNESCO-Konvention.
109. Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General Comment No. 13 The right to education, E/C.12/1999/10 of 8 December 1999, para. 6.
110. Degener/Koster-Dreese, a.a.O., Anm.7, S. 28 ff.
111. Regel 6 der UN-Rahmenbestimmungen, a.a.O., vgl. Anm. 14.
112. Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General Comment No. 5 Persons with disabilities 09/12/94, para 35.
113. Committee on the Rights of the Child: Recommendation „Children with Disabilities“, para 335, www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/doc/days/disabled.pdf (Aufruf 25.09.2007).
114. Committee on the Rights of the Child: General Comment No. 9 (2006) The rights of children with disabilities, CRC/C/GC/9 of 27 February 2007, para 67.
115. Report of the special rapporteur on the right to education, Vernor Munoz, Addendum, Mission to Germany (13–21 Februar 2006), UN Doc. A/HRC/4/29/Add.3 9 March 2007.
116. Rosenberger, M. (Hrsg.), Schule ohne Aussonderung, Neuwied/Berlin 1998; Heyer, P./Sack, L./Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.) Länger gemeinsam lernen: Positionen – Forschungsergebnisse – Beispiele, Frankfurt a.M. 2003.
117. Muñoz, a.a.O., Anm. 114, para 75–82, zu den Folgen des Besuches vgl. Overwien, B./Prengel, A. (Hrsg.) Recht auf Bildung: Zum Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen in Deutschland, Opladen & Farmington Hills 2007.
118. Dazu der Beitrag von Johannes Rux in dieser Ausgabe.
119. Denkschrift der Bundesregierung zum Entwurf des Ratifikationsgesetzes S. 58 rechte Spalte (i.d.F. Bundesrats- Drucksache 760/08)
120. Craven, M., The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. A Perspective on its Development, Oxford 1998, S. 153 ff; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No 3: The nature of States Parties obligations (Art. 2 par. 1). www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664 (05.05.2009) Latham/Watkins, a.a.O., Anm. 92, S. 24 ff; Schneider, a.a.O., vgl. Anm. 83, S. 31.
121. BVerfG, Beschl. v. 8.10.1997, NJW 1989, S.131 (133).
122. BVerfG (1997) a.a.O. Anm. 120, S. 133.
123. Dazu Degener Welche legislativen Herausforderungen bestehen in Bezug auf die nationale Implementierung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bund und Ländern? in: Behindertenrecht 02, 2009, S. 34–52; Degener, T., Zur Erforderlichkeit der Ausdifferenzierung des Diskriminierungsverbot, in: Klein, E./Menke, C. (Hrsg.) Universalität – Schutzmechanismen – Diskriminierungsverbote, Menschenrechtszentrums der Universität Potsdam Band 30, Berlin, S. 373–395.
124. Vgl. oben S. 10.
125. Art. 5 RL 2000/78/EG Abl. 2000 L 303/16.
126. Degener, T./Dern S./Dieball, H./Frings, D./Oberlies, D./Zinsmeister, J., Antidiskriminierungsrecht: Handbuch für Lehre und Beratungspraxis: Mit Lösungsbeispielen für typische Fallkonstellationen, Frankfurt a.M. 2008, S. 78 ff. und S. 372, zur mangelhaften Umsetzung der EU Rahmenrichtlinie im AGG zu dieser Frage auch Schiek, D. (Hrsg.), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Ein Kommentar aus europäischer Perspektive, Sellier, European Law 2007, § 3 Rn.79.
127. Dazu Degener, a.a.O., Anm. 39; Waddington, L. in: Schiek, D./Waddington, L./Bell, M. (Hrsg.), Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Oxford/Portland/Oregon 2007, S. 629 ff.
128. Nach Mitteilung des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Olaf Scholz, auf der ersten nationalen Bildungskonferenz zur Umsetzung des Art. 24 BRK am 6. und 7. Juni in Berlin, beträgt die aktuelle Integrationsquote 15,7 %
www.bmas.de/coremedia/generator/33220/2009__05__06__scholz__vereint__fuer__gemeinsame__bildung. html (Aufruf 12.05. 2009).
129. Decision of 13 November 2007 Application No 57325/00 cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp (Aufruf 05/05/2009).
130. Art. 17 Abs. 2 und Abschnitt E, bzw. Art. 15 Abs.2 ESC
131. Autism Europe v. France, Complaint No 13/2002, Decision of 4 November 2003; Mental Disability Advocacy Center v. Bulgaria, Complaint No 41/2007 Decision of 13 October 2008 www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/complaints/CC41Merits_en.pdf (05/05/2009).
Gegen Aussonderung – für Selbstvertretung
Gegen Aussonderung – für Selbstvertretung: zur Geschichte der Behindertenbewegung in Deutschland
Swantje Köbsell
(Text beruht auf einem Vortrag beim ZeDis Hamburg, 2006)
Vorbedingungen
Bei Ende des zweiten Weltkrieges waren viele tausend behinderte Menschen Opfer der „Euthanasie“ (1) der Nationalsozialisten geworden, Infrastruktur für Menschen mit Behinderungen gab es kaum. Andererseits gab es durch den Krieg und seine Folgen viele beeinträchtigte Menschen, die versorgt werden mussten. So waren die Organisationen der Kriegsopfer („Kriegsbeschädigten“) und Hinterbliebenen die ersten, die ihre Arbeit wieder aufnahmen (2). Die „Zivilbeschädigten“ spielten zunächst in der öffentlichen Wahrnehmung keine Rolle. 1955 erfolgte als erste Gründung einer Organisation für diesen Personenkreis die der „Sozialhilfe für Querschnitts- und Kindergelähmte“, allerdings auch durch einen behindert (querschnittgelähmt) aus dem Krieg Zurückgekommenen (vgl. Fränkische Nachrichten vom 24.05.2003).
In den folgenden Jahren kam es zu weiteren Vereinsgründungen; in der Regel Elternvereinigungen, die sich auf eine bestimmte Art der Beeinträchtigung bezogen. 1958 wurde die Bundesvereinigung „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ (3) gegründet, ungefähr zeitgleich gründeten Eltern von Kindern mit spastischen Lähmungen den “Verband Deutscher Vereine zur Förderung spastisch gelähmter Kinder“ (4). Ziel dieser schädigungsbezogenen Elternvereinigungen, die oftmals gemeinsam mit Medizinern ins Leben gerufen wurden, war dafür zu sorgen, dass die behinderten Kinder gefördert, aber auch die Familien entlastet wurden. An eine Integration behinderter Kinder in Regelkindergärten und –schulen wurde nicht einmal gedacht, und so entstand sukzessive ein Netz von Sonderkindergärten und –schulen, später dann auch von sog. Beschützenden Werkstätten für Behinderte.
In den späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren traten zwei Ursachen von „ziviler“ Behinderung besonders hervor: Kinderlähmung (Poliomyelitis) und Contergan. An Polio erkrankten vor Einführung der Schluckimpfung im Jahr 1962 jährlich mehrere Tausend Menschen. So wurden noch 1961 in Deutschland (West) 305 poliobedingte Todesfälle gemeldet sowie 4461 Personen, bei denen nach einer Infektion Lähmungserscheinungen zurückgeblieben waren (5).
Das Schlafmittel Contergan wurde von 1957 bis 1961 hauptsächlich in der BRD und Großbritannien vertrieben. Angeblich nicht fruchtschädigend und deshalb besonders empfohlen für Schwangere, wurde das Medikament ein echter Verkaufsschlager. 1960 mehrten sich Berichte über Fehlbildungen, insbesondere der Gliedmaßen, bei Neugeborenen nach Einnahme von Contergan während der Schwangerschaft. 1961 wurde der Zusammenhang nachgewiesen und das Medikament vom Markt genommen. In Deutschland wurden ca. 4000 durch Contergan beeinträchtigte Kinder geboren, von denen ungefähr 2800 überlebten (6). Über das Schicksal der „Contergankinder“ wurde ausgiebig in den Medien berichtet, wodurch das Thema „Behinderung“ eine neue Bewertung erfuhr: Behinderung wurde nicht mehr nur als ein persönliches Schicksal, sondern als gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen (7). In Folge der „Contergankatastrophe“ wurde die Aktion Sorgenkind gegründet.
Aufbruch/Erwachen
Die Kinder der Gründer der Elternvereinigungen wurden älter. Die Bundesrepublik wurde von den Auswirkungen der Studentenbewegung erschüttert, die Frauenbewegung entstand. Auch die behinderten Jugendlichen kamen in den Sog dieser gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung und suchten nach Betätigungsfeldern außerhalb der von Eltern und Fachleuten dominierten Vereine. 1968 gründete sich der „Club 68“, der Vorläufer der „Clubs Behinderter und ihrer Freunde“ (Cebeef). In den Clubs trafen sich jüngere behinderte und nichtbehinderte Menschen, um in partnerschaftlichem Zusammenwirken Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern (vgl. Waldschmidt 1984, 31). Lag der Schwerpunkt der Arbeit der Cebeefs zunächst auf der gemeinsamen Freizeitgestaltung, brachten sich die Clubs zunehmend auf kommunalpolitischer Ebene ein, um Barrieren im Alltag abzubauen. Von denen gab es Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts viele: ungenügende Hilfsmittelversorgung, fehlende Zugänglichkeit öffentlicher Verkehrsmittel, keine rollstuhlgeeigneten Wohnungen und keine ambulanten Hilfen, um nur einige zu nennen. Es wurde ernsthaft über die Frage „Sollen, können, dürfen Behinderte heiraten?“ nachgedacht (Kluge/Sparty 1977) wie auch darüber, ob Körperbehinderte Auto fahren „sollen, können, dürfen“ ( N.N. 1979a, 3). Wer im Alltag regelmäßig auf Hilfen angewiesen war, hatte die „Wahl“ zwischen dem Heim, das oftmals auch ein Altenheim war, und der Versorgung durch die Familie.
Behinderung wurde vor allem aus einem medizinischen Blickwinkel betrachtet und oftmals mit Krankheit gleichgesetzt. Es gab aber durchaus auch schon Stimmen, die „Behinderung“ eine soziale Komponente zuschrieben, Auswirkungen auf die gesellschaftliche Realität behinderter Menschen hatte dies jedoch nicht.
Auch behinderte Menschen merkten mehr und mehr, dass nicht ihr körperlicher Zustand für ihre Ausgrenzung verantwortlich war, sondern eine Gesellschaft, die sie ausgrenzte – und dass sie sich dagegen wehren konnten und mussten. Die Erkenntnis, dass seine Lebenssituation politisch verursacht war, führte z.B. Gusti Steiner 1974 zusammen mit dem nichtbehinderten Publizisten Ernst Klee in die Frankfurter Volkshochschule, wo sie in Kursen mit behinderten und nichtbehinderten Teilnehmer/innen dem Problem zuleibe rücken wollten. Die Gruppe führte für die damalige Zeit unerhört provokative Aktionen durch: Sie blockierten die Straßenbahn, brachten selbsttätig eine Rampe an ein nicht zugängliches Postgebäude an und verliehen einige Male die „Goldene Krücke“ an die jeweils „größte Niete der Behindertenarbeit“. Auch wenn sich die Aktivitäten vornehmlich gegen architektonische Barrieren richteten, waren Behinderte, die sich wehrten, ein absolutes Novum.
Ein noch stärker politisiertes Herangehen an das Thema „Behinderung“ hatten die ab 1978 um Franz Christoph und Horst Frehe gegründeten Krüppelgruppen. Gemeinsam entwickelten sie den „Krüppelstandpunkt, in dem die Unterdrückung Behinderter als sexuelle Versklavung begriffen wurde. Angestrebt war nicht die Partnerschaft mit Behinderten, sondern die Konfrontation (Frehe 1997, 14)
Auf diesem inhaltlichen Hintergrund erfolgte zunächst die Gründung der Bremer Krüppelgruppe, der weitere in anderen Städten folgten. Schon der Name war Provokation und als solche auch gedacht:
„Immer wieder werden wir danach gefragt, warum wir uns als Krüppel bezeichnen (...) Der Begriff Behinderung verschleiert für uns die wahren gesellschaftlichen Zustände, während der Name Krüppel die Distanz zwischen uns und den sogenannten Nichtbehinderten klarer aufzeigt. Durch die Aussonderung in Heime, Sonderschulen oder Rehabilitationszentren werden wir möglichst unmündig und isoliert gehalten. Andererseits zerstört die Überbehütung im Elternhaus jede Möglichkeit unserer Selbstentfaltung. Daraus geht hervor, daß wir nicht nur behindert (wie z.B. durch Bordsteinkanten), sondern systematisch zerstört werden. Ehrlicher erscheint uns daher der Begriff Krüppel, hinter dem die Nichtbehinderten sich mit ihrer Scheinintegration ("Behinderte sind ja auch Menschen") nicht so gut verstecken können.“ (N.N. 1982,2)
Die Krüppelgruppen blieben Nichtbehinderten verschlossen. Nach dem Vorbild der Frauengruppen wollte man zunächst unter sich „gemeinsame Analysen von Zerstörungen“ (Frehe 1984, 118) vornehmen. Als nächste Schritte sollten dann ein „gemeinsames Verändern der Alltagsrealität und gemeinsamer Widerstand gegen die uns zerstörenden Strukturen“ (ebd.) erfolgen. Dies ging nur ohne Nichtbehinderte, die als Nichtbetroffene ohnehin nicht mitreden konnten, aber auch auf dem Hintergrund des Machtgefälles zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Der Ausschluss Nichtbehinderter sollte vermeiden, dass sich die bekannten Machtstrukturen zu Lasten der Behinderten wiederholten; er war aber auch Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins. War schon die Wahl des Wortes „Krüppel“ eine Provokation, so war es der Ausschluss Nichtbehinderter, die man nicht brauchte und nicht wollte, erst recht. Von den Krüppelgruppen wurde von 1979 bis 1985 die Krüppelzeitung – „Zeitung von Krüppel für Krüppel“ - herausgegeben.
Viele Nichtbehinderte, vor allem solche, die in der „Behindertenarbeit“ tätig waren, fühlten sich von den Krüppelgruppen zutiefst provoziert – wurden sie doch als Unterdrücker bezeichnet: „Der Begriff Behindertenarbeit stellt schon eine Unterdrückung dar“ (Christoph 1984, 72 ), wie Franz Christoph in seinem „Behindertenstandpunkt“ schrieb. Christophs Provokation ging in beide Richtungen, sowohl an Nichtbehinderte wie auch Behinderte. Erstere sollten erkennen, dass sie behinderte Menschen unterdrücken und sich damit auseinandersetzen; letztere wurden aufgefordert, sich nicht mehr länger in der Hoffnung auf Anerkennung bei den Nichtbehinderten anzubiedern. Er stellte fest, dass eine echte Solidarität zwischen Behinderten und Nichtbehinderten derzeit nicht möglich sei. Auf dem Weg dorthin müssten die Nichtbehinderten „die Normalität hinterfragen“ und die „eigene Beteiligung an der Unterdrückung der Behinderten“ (ebd.) aufarbeiten. „Wir (Behinderte, S.K.) müssen endlich lernen, uns den Nichtbehinderten gegenüber aggressiv zu verhalten“ (ebd., 74) und „endlich lernen, unsere eigenen, unserer Lebensrealität gemäßen Wertmaßstäbe zu entwickeln und auch versuchen, dazu zu stehen.“ (ebd.)
Die Herangehensweise der Krüppelgruppen war selbstverständlich auch unter Behinderten nicht unumstritten. Und obwohl es viele unterschiedliche Gruppierungen gab, die sich mit der Benachteiligung Behinderter beschäftigten, konnte Ende der Siebzigerjahre von einer „Bewegung“ noch nicht die Rede sein.
Geburt einer Bewegung
Dies änderte sich 1980, als am 25.02.1980 die als „Frankfurter Urteil“ in die Geschichte eingegangene Gerichtsentscheidung die Gemüter erhitzte. In diesem Urteil hatte die 24. Zivilkammer des Frankfurter Landgerichts einer Urlauberin die Minderung ihres Reisepreises zugestanden, weil sie in ihrem Urlaub den Anblick behinderter Menschen hatte ertragen müssen.
Nachdem das Urteil durch die Medien bekannt geworden war, gab es zahlreiche Proteste (Klee 1980, 35 ff) und es wurde bundesweit von verschiedenen Gruppen zu einer Demonstration in Frankfurt aufgerufen. Am 8. Mai 1980 fand dann in Frankfurt eine Demonstration mit 5000 Teilnehmer/innen statt, davon viele selbst behindert – so etwas hatte es noch nicht gegeben. In den Kundgebungsbeiträgen wurde auf die umfassende Diskriminierung behinderter Menschen in Deutschland durch Aussonderung aufmerksam gemacht sowie auf den Selbstvertretungsanspruch behinderter Menschen. Die Rücknahme des Urteils wurde durch die Demonstration nicht erreicht, wohl aber ein Selbstbewusstseinsschub für die sich entwickelnde Behindertenbewegung durch das Gefühl des gemeinsamen Kampfes, der gemeinsamen Stärke. Und auch wenn das Urteil nicht zurückgenommen wurde: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde der Widerstand behinderter Menschen zu einer politischen Nachricht in der „Tagesschau“ (ebd., 84).
Der Erfolg dieser Demonstration beflügelte die Vorbereitungen der Behinderteninitiativen zum UNO-Jahr der Behinderten, das für 1981 ausgerufen worden war. Ahnend, dass dieses Jahr nur dazu genutzt werden würde, dass sich die „Wohltäter“ selbst beweihräuchern, aber die Selbstvertretung Behinderter nicht vorgesehen sein würde, hatte sich eine Gruppe aus dem gesamten Spektrum der Behinderteninitiativen gebildet. Ziel der Gruppe war, die offiziellen Veranstaltungen des UNO-Jahres zu nutzen, um auf die eigenen Belange aufmerksam zu machen. Dazu bot sich vor allem die Eröffnungsveranstaltung am 24. Januar in der Dortmunder Westfalenhalle an. Nach dem Motto „Jedem Krüppel seinen Knüppel“ wurde die Störung der Eröffnung des „Jahres der Behinderer“ (vgl. Steiner 1983, 88) geplant. Aus dem ganzen Bundesgebiet reisten behinderte Menschen und ihre Unterstützer/innen an, um die geplante „Integrationsoperette, die die gravierenden Mißstände im Behindertenbereich verschleiern soll“ (N.N. 1981) zu stören und als Plattform für ihre Anliegen zu nutzen. Als der damalige Bundespräsident Karl Carstens die offizielle Eröffnungsrede halten wollte, besetzten einige der behinderten Demonstranten die Bühne und forderten:
- „keine Reden
- keine Aussonderung
- keine Menschenrechtsverletzungen“ (ebd.).
Karl Carstens musste schließlich in einem Nebenraum sprechen, wo seine Rede die Befürchtungen bestätigte. Da war nicht von Rechten die Rede, von Selbstvertretung, sondern von Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe und Verantwortungsgefühl, davon, etwas für „die Behinderten“ zu tun und dafür Dank zu bekommen. Behinderte als selbstbestimmt handelnde Menschen kamen in dieser Rede nicht vor (Steiner 1983, 82).
Hatte schon die Demonstration in Frankfurt für Medienaufmerksamkeit gesorgt, tat es die Bühnenbesetzung erst Recht, wenn auch nur wenige verstanden, worum es den Bühnenbesetzer/innen wirklich ging. Noch weniger Verständnis bekam eine Aktion anlässlich der Reha-Messe im selben Jahr. Bei der Eröffnung stürzte sich Franz Christoph auf den Bundespräsidenten mit den Worten “Du Partner! Hast Du aus Dortmund nichts gelernt?“ (8) und versetzte ihm zwei leichte Schläge mit seiner Krücke. Mit dieser Aktion konnte er eindrucksvoll zeigen, dass Widerstand von Behinderten nicht ernst genommen wurde: wofür jede/r Nichtbehinderte angezeigt und verurteilt worden wäre (9), brachte ihm nur Hausverbot ein.
Den Abschluss des „Jahres der Behinderer“ seitens der Behindertenbewegung bildete das „Krüppeltribunal“. Analog zum jährlich von Amnesty International durchgeführten Russeltribunal sollten Menschenrechtsverletzungen an behinderten Menschen zur Anklage gebracht werden. Die Organisator/innen wollten „die Strukturen dieser Aussonderungspolitik in der BRD anklagen. Wir wollten uns gegen die Zerstückelung unserer Interessen durch Politiker, Heimaufseher und sonstige Fachleute in Sachen Behindertenunterdrückung zur Wehr setzen und die Betroffenen zur massiven und radikalen Gegenwehr anstiften.“ (Daniels u.a. 1983, 9) Anklagepunkte bezogen sich auf die Lebenssituation in Heimen, Behördenwillkür, Mobilität, Werkstätten, die Lebenssituation behinderter Frauen, die Pharmaindustrie, die Zustände im Rehabilitationszentrum Neckargemünd und die Psychiatrie.
Waren die Aktionen zu Anfang des UNO-Jahres noch von einem breiten Bündnis von Gruppen getragen, in dem das ganze Spektrum der Behindertengruppen sich zusammenfand, von Cebeefs bis Krüppelgruppen, kam es im Vorfeld der Organisation des Krüppeltribunals zu Auseinandersetzungen über die Frage, ob „Behinderte und Nichtbehinderte gleichberechtigt zusammenarbeiten können oder nicht“ (ebd., 11). Da in diesem Punkt keine Einigkeit erzielt werden konnte, fand die Planung und Durchführung des Krüppeltribunals ohne Beteiligung der Krüppelgruppen statt.
Die Bewegung entwickelt sich
Mit dem Ende des UNO-Jahres begann quasi der Alltag der Behindertenbewegung, deren Untergruppierungen sich in verschiedene Richtungen entwickelten. Dabei gab es zwei Hauptströmungen: Der einen ging es vornehmlich um die Schaffung von Infrastruktur für behinderte Menschen, vor allem in Form ambulanter Hilfsdienste, der anderen um politische Selbstvertretung. Einige Gruppen wandten sich der Aufgabe zu, im Alltag praktische Verbesserungen der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu organisieren. Es wurden ambulante Dienste gegründet, später die Zentren für Selbstbestimmtes Leben und Assistenzgenossenschaften. Andere – hier vorwiegend Einzelpersonen – engagierten sich in der Politik, zunächst bei den Grünen, später dann überparteilich für Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetzgebung. Früh schon begannen sich behinderte Frauen mit der Frage des Zusammenspiels von (weiblichem) Geschlecht und Behinderung zu beschäftigen, eine Thematik, die auch in einen anderen Themenkomplex, mit dem sich einige intensiv befassten, hineinspielte: die Diskussion um Eugenik und später um Bioethik. Seit 2001 diskutieren Einzelpersonen aus der Bewegung über die Disability Studies, den „Brückenschlag" von der politischen Bewegung zu einer politischen, parteilichen und interdisziplinären Wissenschaft. Diese Bereiche werden im Folgenden etwas genauer beleuchtet.
Selbstbestimmt Leben mit und ohne Assistenz
Nicht-Aussonderung, Selbstbestimmung und „Experte/ Expertin in eigener Sache“ zu sein waren von Anfang an die zentralen Elemente der Behindertenbewegung. Neben dem Aufzeigen der vorhandenen Aussonderungsstrukturen ging es sehr bald darum, aktiv zum Abbau dieser Strukturen beizutragen. Wie bereits geschildert, mussten behinderte Menschen, die im Alltag auf Hilfen angewiesen waren, sich entweder in Heime abschieben oder von Angehörigen versorgen lassen; die durch Polio beeinträchtigten Menschen mussten in Krankenhäusern leben (vgl. Frevert o.J.). Das lag zum Einen daran, dass „unser Anderssein mit krank gleich gesetzt (wurde)“ (ebd.), zum Anderen gab es einfach keine Hilfen außerhalb stationärer Einrichtungen. Einer der ersten ambulanten Hilfsdienste der Bundesrepublik nahm 1978 in München seine Arbeit auf: die Vereinigung Integrationsförderung, kurz VIF (vgl. ebd.). Durch die VIF erhielten beeinträchtigte Menschen in München erstmals die Möglichkeit „Helfer“ (das Wort „Assistenz“ war damals noch unbekannt) zur selbstbestimmten Gestaltung ihres Alltags einzusetzen. In der Folge entstanden an vielen Orten der BRD solche ambulanten Hilfsdienste, etliche von Behinderten initiiert und geleitet, die zunächst vorwiegend Zivildienstleistende im Rahmen der sogenannten Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) einsetzten. Diese Dienste ermöglichten nun zwar ein Leben außerhalb des Heimes, ein selbstbestimmtes Leben war es aber oft nicht, da die Nutzer/innen der Hilfsdienste wenig Mitbestimmung darüber hatten, wer ihnen wann und wo bei welcher Tätigkeit behilflich war, das wurde in den Diensten entschieden; so mussten auch behinderte Frauen sich von Zivildienstleistenden helfen lassen – ob es ihnen gefiel oder nicht (Fretter 1991, 16f). Wer dies vermeiden wollte brauchte entweder einen Anbieter, der von den Nutzer/innen kontrolliert wurde, oder musste selbst Arbeitgeber/in seiner Helfer/innen werden.
Parallel zum Aufbau der Ambulanten Dienste wurde auch ein anderer Bedarf offensichtlich: der nach Beratung. Denn um die vorhandenen Möglichkeiten nutzen zu können, mussten behinderte Menschen darüber informiert sein, welche Rechte sie überhaupt hatten und wie sie diese einfordern konnten.
Im März 1982 fand in München ein wegweisender Kongress statt. Unter dem Titel „Leben, Lernen, Arbeiten in der Gemeinschaft“ wurden unterschiedlichste Modelle der Unterstützung körperbehinderter Menschen aus dem europäischen Ausland und den USA vorgestellt. Der Kongress stellte der interessierten Öffentlichkeit das Konzept des Independent Living aus den USA und Großbritannien vor und führte die Begriffe „Independent Living“ (Selbstbestimmt Leben) und „Assistenz“ in die deutsche Diskussion ein – wenn auch letzteren zunächst nur im Zusammenhang mit Arbeits- und Schulassistenz (Ratzka 1982, 57 ff).
Der Begriff „Selbstbestimmt Leben“ und die damit verbundene Philosophie setzte sich fest, und im November 1986 wurde in Bremen die Beratungsstelle „Selbstbestimmt Leben“ eröffnet, als erstes von inzwischen über zwanzig „Zentren für Selbstbestimmtes Leben“ (10). Inhalt der Arbeit der Beratungsstelle war das Erbringen einer „politischen Dienstleistung“ im Sinne von „durch Hilfeleistungen für einzelne die materiellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Behinderten ihre Interessen selbst wahrnehmen und vertreten, indem sie sich z.B. solidarisieren und auch politisch aktiv werden.“ (N.N. 1987b, 8) Die Bremer Beratungsstelle wollte „zum Ausgangspunkt einer Bewegung werden, die Krüppel (sic!) mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen vermittelt und zu einer breiteren Bewegung zur Durchsetzung der eigenen Interessen und zur Beseitigung der Diskriminierung beiträgt.“ (ebd., 10) Dies ist zumindest insoweit in Erfüllung gegangen, als es seit 1990 einen Dachverband der Selbstbestimmt-Leben-Zentren gibt, der die Arbeit der Zentren politisch unterstützt (11) und in dem alle Entscheidungen von Menschen mit Behinderungen getroffen werden (12).
Weitere wichtige Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben sind eine barrierefreie Umwelt und Mobilität. In beiden Bereichen hat sich die Behindertenbewegung frühzeitig engagiert, und insbesondere um Mobilität ist hart gekämpft worden. Dabei ging es einerseits um die Einrichtung bzw. den Erhalt von Sonderfahrdiensten, die immer von Kürzungen bedroht waren, und andererseits um die barrierefreie Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs als eigentliches Ziel. In vielen Städten wurden dazu schon Ende der Siebziger und Anfang der Achtziger Aktionen durchgeführt wie das Blockieren der öffentlichen Verkehrsmittel (Steiner 2003) und Demonstrationen. Das Ziel „Bus und Bahn für alle“ ist zwar noch nicht vollständig bzw. flächendeckend erreicht, aber vielerorts ist man ihm wesentlich näher gekommen.
Engagement für die rechtliche Gleichstellung
Nachdem die Grünen 1983 mit 5,6% der Stimmen in den Bundestag gewählt worden waren (13), boten sie sich gesellschaftlichen Minderheiten als Sprachrohr an. Dieses Angebot wurde von einigen in der Behindertenbewegung Aktiven aufgegriffen – in der Hoffnung, über die Grünen Belange Behinderter in Gesetzgebungsverfahren einbringen zu können. Die neue Kooperation begann recht turbulent, zeigte sich doch, dass auch Grüne nur Menschen mit Vorurteilen waren (Sandfort 1983, 15f). Dies wurde u.a. in den Anti-Atomkraftkampagnen deutlich, wo mit Bildern behinderter Menschen vor den Folgen eines Atomkrieges gewarnt wurde (Sierck 1988, 21), aber zeigte sich auch in Achtlosigkeit, Rücksichtslosigkeit und geringer Bereitschaft, sich mit Behinderten wirklich auseinander zu setzen (ebd.). Dennoch wagten etliche den „Marsch durch die Institutionen“ (Kobinet, 24.07.2003) und ließen sich auf Grüne Politik ein. Der Bremer Mitbegründer der Krüppelgruppe Horst Frehe war 1987 einer der ersten aus der Behindertenbewegung, die als Abgeordnete in (Landes-) Parlamente einzogen und trotz der anfänglichen Auseinandersetzungen kam es zur Bildung einer Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Behindertenpolitik bei den Grünen, an der zunächst zahlreiche Mitglieder der Behindertenbewegung teilnahmen.
Erfolgreichstes Projekt dieser BAG in den Neunzehnachtzigern war die Einmischung in die Diskussion um die neu einzuführende Pflegeversicherung. Die Grünen brachten einen – leider erfolglosen – Gesetzentwurf ein, der vorsah, bis 1995 alle Heime abzuschaffen und in dem Zeitraum bis dahin flächendeckend ambulante Dienste auszubauen (Tolmein 1985).
War diese Gesetzesinitiative auch nicht von Erfolg gekrönt, so beherrschte ab 1986 ein anderes Gesetzesvorhaben mal mehr, mal weniger die Diskussion der Bewegung: ein Antidiskriminierungsgesetz. Im Sommer 1986 waren einige Mitglieder der BAG Behindertenpolitik bei den Grünen in die USA gereist und völlig euphorisiert zurückgekommen. Sie berichteten von der gesetzlichen Antidiskriminierungsvorschrift in den USA, die Behinderte dort durch ihre Hartnäckigkeit – unter anderem die siebenundzwanzigtägige Besetzung eines Regierungsgebäudes – erkämpft hatten, um damit gesellschaftliche Chancengleichheit zu erreichen (Jürgens 1986, 14f). Zwar sah man auch durchaus die Schwächen dieser Regelung, dennoch wurde auch für die BRD "eine Debatte über Diskriminierungsverbote" (ebd., 16f) gefordert. Dies zeichnete die Marschrichtung der kommenden fast zwanzig Jahre vor. Das Thema kochte zunächst einige Jahre auf kleiner Flamme; auch gab es nicht nur Befürworter/innen einer solchen gesetzlichen Regelung.
1990 bekam die Sache dann wieder neuen Schwung. Das lag zum Einen daran, dass in den USA ein weiteres Antidiskriminierungsgesetz (14) verabschiedet worden war (Degener 2000), zum Anderen aber interessierten sich inzwischen die großen Behindertenverbände für die rechtliche Gleichstellung behinderter Menschen (Miles-Paul 2004). In der Folge wurde der „Initiativkreis Gleichstellung Behinderter“ gegründet, der mit dem „Düsseldorfer Appell“ 1991 auf die Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen zur rechtlichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machte (Forum 2000, 3). Dies sollte durch eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes erfolgen, das wegen der Wiedervereinigung ohnehin zur Änderung anstand, sowie durch Gleichstellungsgesetze auf Bundes- und Länderebene.
Im Februar 1992 gründete sich das Forum behinderter Juristinnen und Juristen und im Mai des Jahres fand der erste Europäische Protesttag für die Gleichstellung Behinderter statt, der seitdem jedes Jahr wieder die Plattform für Forderungen nach Gleichstellung und Antidiskriminierung ist. Zunehmend entwickelte sich für diesen Themenkreis eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Einzelpersonen aus der Behindertenbewegung und den großen Behindertenverbänden. Dieser „großen Koalition“ gelang es, Politiker/innen von der Notwendigkeit zu überzeugen, dass Diskriminierungsschutz für Behinderte ins Grundgesetz gehört, mit dem Erfolg, dass bei der Grundgesetzänderung 1994 in Artikel 3, Absatz 3 der Satz aufgenommen wurde „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Forum 2000, 3) Dieses nun verfassungsgemäße Benachteiligungsverbot hatte jedoch auf den Alltag behinderter Menschen keine spürbare Wirkung, hierzu bedurfte es entsprechender gesetzlicher Regelungen. Der Initiativkreis Gleichstellung gründet sich um in das „Netzwerk Artikel 3“ (15), das sich von nun an für die rechtliche Gleichstellung Behinderter einsetzte.
Nach einer Satzungsänderung, bei der als weiteres Vereinsziel der Punkt „Aufklärung“ aufgenommen worden war (16), mischte sich die „Aktion Sorgenkind“ – lange Zeit der "Lieblingsfeind" der Behindertenbewegung und seit 2000 in "Aktion Mensch" umbenannt - 1997 mit ihrer „Aktion Grundgesetz“ öffentlichkeitswirksam in die Diskussion um die rechtliche Gleichstellung behinderter Menschen ein. Ziel der Kampagne war, durch breit angelegte Informationen das Umsetzen des Anspruches aus dem Grundgesetz in tatsächliche Gesetze in die Öffentlichkeit zu bringen und damit Druck auf Politiker/innen zu entwickeln. 100 Organisationen aus dem Behindertenbereich beteiligten sich an der Kampagne, auch die ISL, die dafür aber auch kritisiert wurde, denn das Misstrauen gegenüber dieser Organisation saß und sitzt tief, besonders bei denen, die mit dem „Sorgenkind“-Image groß geworden sind (Eisermann, ebd., 58f).
Die „Aktion Grundgesetz“ und die damit verbundenen Aktivitäten der involvierten Verbände stellten so viel Öffentlichkeit für das Thema her, „dass die 1998 gewählte rot-grüne Koalition nicht umhin kam, die Verabschiedung eines Bundesgleichstellungsgesetzes in der Koalitionsvereinbarung festzuschreiben.“ (Miles-Paul 2004) Das allein bewegte jedoch noch nicht viel, die Umsetzung dieses Vorhabens zeichnete sich zunächst nicht ab, weitere Aktivitäten waren gefordert. Hierzu gehörte u.a. der Gesetzesvorschlag, den das Forum behinderter Juristinnen und Juristen im Jahr 2000 der Bundesregierung „schenkte“ (ebd.). Zahlreiche andere Aktionen und die engagierte Unterstützung des Bundesbehindertenbeauftragten Karl-Herrmann Haack führten schließlich 2001 zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Heiden 2003). Absolutes Novum in der deutschen Rechtsgeschichte: Bei der Erarbeitung des Behindertengleichstellungsgesetzes, das am 01.05.2002 in Kraft trat, wurden Betroffene, die beiden Juristen Horst Frehe und Andreas Jürgens beteiligt. Das Behindertengleichstellungsgesetz regelt die Verpflichtungen des Bundes zur Gleichstellung behinderter Menschen. Dazu gehört u.a. die Barrierefreiheit von Gebäuden, aber auch das Erstellen von Bescheiden in für den Empfänger verständlicher Form. Eine große Errungenschaft des Gesetzes ist die Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache, wodurch Gehörlose einen Anspruch auf Gebärdendolmetscher – bei Verhandlungen mit Bundesbehörden – bekamen. Da das Behindertengleichstellungsgesetz nur die Anforderungen an Einrichtungen des Bundes klärte, war von Anfang an klar, dass es zur rechtlichen Gleichstellung weiterer Gesetze bedurfte: der Landesgleichstellungsgesetze, die die Zuständigkeiten der Länder regeln, sowie eines zivilrechtlichen Antidiskriminierungsgesetzes, das behinderte Menschen vor Diskriminierungen im privatrechtlichen Bereich schützen soll. Nachdem Berlin bereits 1999 das erste Landesgleichstellungsgesetz bekam, zogen die meisten Bundesländer nach (17). Der von der rot-grünen Koalition eingebrachte Entwurf für ein zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz, der durch den Widerstand der CDU im Vermittlungsausschuss landete, wurde am 05.09.2005 eben dort nicht behandelt und hatte damit keine Chance mehr durchzukommen (kobinet, 05.09.2005). Doch scheint sich die große Koalition, die damals die Regierung stellte, endlich durchgerungen zu haben, sich für ein Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das auch das Merkmal „Behinderung“ berücksichtigt, einzusetzen (kobinet, 09.05.2006).
Das Recht auf Leben – keine Selbstverständlichkeit
Fragen der Eugenik, später dann der Bioethik, spielten in der deutschen Behindertenbewegung von Anfang an eine wichtige Rolle. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ war Ende der Siebzigerjahre noch nicht aufgearbeitet worden, andererseits war durchaus vielen Menschen bekannt, was mit behinderten Menschen während der Nazi-Herrschaft geschehen war. Behinderte Menschen selbst hatten das Gefühl, dass man sie bei der Aufarbeitung der Vergangenheit vergaß – ihre Geschichte musste erst noch geschrieben werden.
Zu diesem Zeitpunkt hatten einige bereits Erfahrungen mit humangenetischer Beratung gemacht, aber auch mit Sprüchen wie „Unter Hitler hätte man so was vergast“; die Älteren hatten mit Glück die NS-Zeit überlebt. Es gab schon wieder bzw. immer noch Mediziner/innen und Wissenschaftler/innen, die mehr oder minder offen eugenisches Gedankengut propagierten. Zum Teil handelte es sich dabei um Personen, die unter den Nazis in gleichen oder ähnlichen Positionen tätig gewesen waren. Es gab bereits pränatale Diagnostik, wenn auch noch in recht bescheidenem Umfang und damit einhergehend Werbung für ihre Nutzung, die als behindertenfeindlich erlebt wurde, da hier Behinderung als leidvoll und mit dem Leben nicht vereinbar dargestellt wurde. Die Gentechnik und ihre „Verheißungen“ waren bereits im Gespräch und erzeugten bei vielen Menschen mit Behinderungen Befürchtungen.
Auf diesem Hintergrund begannen Mitglieder der Behindertenbewegung sich mit „ihrer“ Vergangenheit zu beschäftigen, im Hinterkopf immer die Frage „Wie wäre es mir/uns damals ergangen?“ Sie stellten Nachforschungen an, stellten Zusammenhänge her und veröffentlichten das Herausgefundene. Ab der Krüppelzeitung 3/1982 zog sich das Thema „Behinderung und Eugenik“ in verschiedenen Varianten durch alle Ausgaben. Dabei ging es zum Einen um die Aufarbeitung der Vergangenheit und daraus resultierender Kontinuitäten, zum Anderen wurden aktuelle Entwicklungen aufmerksam verfolgt und kritisch beleuchtet.
1984 veröffentlichten Udo Sierck und Nati Radke „Die Wohltäter-Mafia. Vom Erbgesundheitsgericht zur Humangenetischen Beratung“, worin sie personelle und ideologische Kontinuitäten vom „Dritten Reich“ bis in die damalige Zeit nachwiesen. Thematisiert wurde die individualisierende Sicht auf Behinderung, ohne die es zu diesen Entwicklungen nicht habe kommen können. Sierck und Radtke deckten in ihrem Buch u.a. auf, dass einer der Mitbegründer der „Lebenshilfe für geistig Behinderte“, Prof. Dr. Werner Villinger, als Gutachter an der Ermordung behinderter Menschen während des „Dritten Reiches“ beteiligt war (Sierck/ Radtke 1984,83, 85). Auch wiesen sie darauf hin, welche Gefahren die Weiterentwicklung der Gentechnik für Menschen mit Behinderungen mit sich bringen könne.
Zu den aus der Vergangenheit „geerbten“ Themen gehört auch das der Zwangssterilisation von behinderten Menschen. Auch hier wurde nachrecherchiert, wie es zum „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ (GzVeN) kommen konnte, nach dessen Regelungen zwischen 1933 und 1945 ca. 400.000 Menschen zwangssterilisiert wurden, und wie mit dem Thema nach Kriegsende umgegangen wurde (Sierck/ Radtke 1984, Köbsell 1987). Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde nach Kriegsende außer Kraft gesetzt, behinderte Menschen, vor allem Mädchen, jedoch weiter sterilisiert, oftmals mit ähnlich absurden Begründungen wie vor 1945 (Sierck/ Radtke 1984, 103ff). Nun erfüllte dies den Tatbestand einer vorsätzliche Körperverletzung, was allerdings nie zur Anzeige kam. Eine „Panorama“-Sendung machte 1984 diesen Skandal publik (Köbsell 1987, 7), wodurch die damalige Bundesregierung unter Zugzwang geriet. Es wurde offensichtlich, dass eine gesetzliche Regelung geschaffen werden musste, was jedoch noch einige Zeit dauerte: Erst am 01.01.1992 wurde mit Inkrafttreten des Betreuungsgesetzes auch die Sterilisation sog. einwilligungsunfähiger Personen geregelt. Zwar erschwert das darin festgelegte Verfahren die Sterilisation gegenüber dem vorherigen „Grauzonen“-Verfahren, einen hundertprozentigen Schutz vor Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit bietet dies Gesetz jedoch nicht, und so wurde diese Regelung bereits im Vorfeld von der Behindertenbewegung kritisiert, die auch den Appell: „Kein neues Sterilisierungsgesetz in der Bundesrepublik“ unterstützte (Arbeitskreis 1987, 21f). Seit der Verabschiedung des Gesetzes wird jedoch über das Thema „Sterilisation“ kaum noch gesprochen, obwohl das Problem – dass behinderte Menschen sich möglichst nicht fortpflanzen sollen – nach wie vor existiert und kritisch bewertet wird.
Der Themenbereich „Euthanasie“ bzw. aktive Sterbehilfe war anfangs, wie weiter oben beschrieben, vor allem in seiner historischen Dimension von Bedeutung. Hinzu kam Protest gegen „Ewiggestrige“ (Krüppelgruppe Bremen 1984, 42) oder Sterbehilfe-Propagandisten wie Prof. Hackethal und den DGHS(18)-Vorsitzenden Attrott, die sich zu diesem Thema exponierten (N.N. 1987, 23; Köbsell 1988, 15f), sowie die kritische Begleitung der immer noch gegen NS-Ärzte stattfindenden Prozesse (Reuter/Pudwill 1987, 6ff). Für die nachgeborenen Behinderten war und ist die „Euthanasie“, wie sie unter den Nazis praktiziert wurde, eine dauernde Warnung davor, was die Folge eines Menschenbildes sein kann, das bestimmte Menschen für „lebensunwert“ erklärt.
Im Juni 1989 kam mit der Einladung des australischen Bioethikers Peter Singer auf einen Kongress der „Lebenshilfe“ neue Brisanz in die Thematik. Singer, bekannt für seine extremen Positionen hinsichtlich des Lebensrechts behinderter, alter und kranker Menschen war eingeladen, um über das Lebensrecht schwerstbehinderter Neugeborener zu sprechen. Er teilt die Menschheit in zwei Gruppen auf: in Personen und Nicht-Personen, wobei letztere kein uneingeschränktes Lebensrecht haben. Um als Person zu gelten, muss das Individuum über Autonomie, Selbst-Bewusstsein, Zukunftsorientierung, Wahrnehmungsfähigkeit und Autonomie verfügen (Klees 1988, 40). Der massive Protest eines breiten Bündnisses aus Behinderten- und Krüppelinitiativen und anderen Gruppen führte dazu, dass die Lebenshilfe den Kongress absagte (Sierck 1989, 7), aber der Geist war gewissermaßen aus der Flasche: Was bis dato nach den Erfahrungen während der Nazi-Zeit unvorstellbar war – das öffentliche Infragestellen des Lebensrechtes behinderter Menschen –, war nun wieder möglich.
Mit Singer hatte nicht nur der Begriff „Bioethik“ in die deutsche Diskussion Einzug gehalten, sondern auch das Absprechen des uneingeschränkten Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Dies wurde besonders im Zusammenhang mit der sog. Bioethikkonvention des Europarates deutlich, die ab 1994 einige Zeit die bioethische Diskussion dominierte. Die Konvention wurde erarbeitet, um die Menschenrechte des Individuums in den Zeiten der Biomedizin zu schützen. Tatsächlich schützt sie jedoch die Menschenrechte nicht, sondern relativiert sie, indem sie dem bioethischen Denkmuster verhaftet bleibt, das die Universalität von Menschenrechten bestreitet und individuelle Rechte den Bedürfnissen von Forschung und Wissenschaft gegenüberstellt. Menschenrechte sind hier nicht etwas, was jeder Mensch besitzt, weil er ein Mensch ist, sondern sie müssen quasi verdient werden, indem jede/r nachweisen muss, dass er oder sie gewisse Leistungen erbringt bzw. bestimmte Eigenschaften hat (Emmrich 1997, 56). Dieser Logik folgend werden behinderte und alterskranke Menschen zu Menschen „minderer Güte”, die zu Forschungszwecken bzw. als Materiallager für Transplantationen benutzt werden können. Ein ähnliches Bündnis wie im Fall der Singer-Einladung konnte auch hier mobilisiert werden, das genug Druck entwickelte um zu verhindern, dass die Bundesregierung die Konvention unterzeichnete.
Das Thema ist nach wie vor in der Diskussion, hat aber bei weitem nicht mehr den Mobilisierungseffekt wie 1989. Als Singer 2004 nach Heidelberg eingeladen war, gab es zwar Protest, ein großes Bündnis, das sein Auftreten verhindern wollte, kam jedoch nicht zustande. Singer bestätigte auch hier noch einmal, dass nach seiner Meinung nur derjenige ein Recht auf Leben habe, der über Fähigkeiten wie Selbstbewusstsein und Sinn für die Zukunft verfügt (kobinet, 13.12.2004).
Ein weiteres brisantes und identitätsstiftendes Thema der Behindertenbewegung kommt auch aus dem bioethischen Themenkreis: der Schwangerschaftsabbruch nach pränataler Diagnostik. Auch hier gehen die Wurzeln auf die NS-Ära zurück, denn im Rahmen der Erweiterung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses von 1935 wurde die Zwangsabtreibung bei „minderwertigen“ Frauen mit anschließender Zwangssterilisation legalisiert (Köbsell 1987, 25). Eine weitere Verbindungslinie geht über die Humangenetik, deren Vorgängerin in Deutschland die Rassenhygiene war. Auch hier ließen sich personelle und ideelle Kontinuitäten feststellen (Sierck/ Radtke 1984, 28) und so war die Vergangenheit in den Veröffentlichungen lange die Bezugsgröße. Die Problematik des selektiven Schwangerschaftsabbruch wurde u.a. in der Kontinuität von alter und neuer Eugenik verortet (Köbsell/Strahl 1986, 3ff), aber auch in der Ungleichbehandlung behinderten und nichtbehinderten Lebens schon vor der Geburt.
Die Thematik der Selektion durch vorgeburtliche Untersuchungen in Kombination mit Abtreibung hat die Behindertenbewegung seit ihrer Entstehung begleitet. Dabei wurde durchgängig und weitgehend einheitlich (19) die gleiche Position vertreten: Die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruches an sich wurde und wird bejaht, die Abtreibung eines bestimmten Fötus aufgrund dessen mangelhafter Qualität jedoch abgelehnt und als vorgeburtliche Diskriminierung behinderten Lebens kritisiert, die auch Auswirkungen auf die Bewertung der Lebensqualität lebender Behinderter habe (Bremer Krüppelfrauengruppe 1991, 227ff). Diese Haltung hat immer wieder zu äußerst heftigen kontroversen Diskussionen geführt. Zunächst wurde auch die Schließung der humangenetischen Beratungsstellen gefordert (Bradish/Feierabend 1989, 282). Diese Forderung ist über die Jahre immer weniger erhoben worden, die Kritik von Seiten der Behindertenbewegung an pränataler Selektion aber blieb.
Die Bewegung in der Bewegung – Frauen mit Behinderung
Frauen bzw. die Frauenbewegung spielten in der jungen Bewegung eine wichtige Rolle, wurden doch Frauengruppen gerne als Analogie zu den nichtbehindertenfreien Krüppelgruppen herangezogen. Doch nicht nur die Orientierung an der Frauenbewegung ist für eine von Männern ins Leben gerufene Bewegung bemerkenswert, sondern auch die Tatsache, dass diesen Männern klar zu sein schien, das sich das Leben von Männern und Frauen mit Behinderung unterscheidet. Auf der letzten Seite der ersten Ausgabe der Krüppelzeitung schreiben „Horst und Franz“: „Leider ist auch die doppelte Diskriminierung behinderter Frauen fast nicht berücksichtigt worden. Wir hoffen, daß sich welche finden, die mit uns Behinderten (sic!) im Redaktionskollektiv zusammenarbeiten und die Positionen behinderter Frauen vertreten werden.“ (1979, 52) Dieser Anspruch wurde jedoch nicht umgesetzt. Zwar meldete sich in der Ausgabe 2/1980 „Nati“ mit einem Artikel „Mit Puder und Crem’ wird auch die Krüppelfrau schön“ (1980, 61 – 63) zu Wort, doch so richtig in Fahrt kamen die Frauen erst 1981 und das weitere Verhalten der Männer in der Bewegung lässt darauf schließen, dass der Wunsch, die „doppelte Diskriminierung“ behinderter Frauen berücksichtigen zu wollen, wohl nur ein Lippenbekenntnis war.
Der 2. Gesundheitstag 1981 in Hamburg bot auch das Forum für die erste öffentliche Veranstaltung zum Thema behinderte Frauen. Hier wurde die besondere Situation behinderter Frauen zum Thema gemacht, die davon gekennzeichnet ist, dass behinderte Frauen zwei Ausgrenzungsmerkmale auf sich vereinen: weiblich und behindert sein, wobei jeweils eines dieser Merkmale dem völligen Aufgehobensein in der jeweiligen Bewegung im Wege steht.
Beim Krüppeltribunal 1981 machten Frauen mit Behinderung ihre besondere Lebenssituation zum Thema und zeigten anhand der Bereiche Schönheitsideal, Gynäkologie, Paragraf 218 und Vergewaltigung auf, wie sich hier das Zusammenspiel von weiblichem Geschlecht und Behinderung zum Nachteil der behinderten Frauen auswirkt.
Frauen und Mädchen mit Behinderung waren damals unsichtbar. „Fachleute der Behinderten handeln uns ausschließlich geschlechtsneutral als 'die Behinderten' ab (...) und auch in der gängigen Frauenliteratur kommen wir kaum vor.“ (Ewinkel/ Hermes 1985, 7) Auch in der Behindertenbewegung wurde die Geschlechterfrage nicht gestellt sondern die nichtbehinderte Gesellschaft insofern reproduziert, als ihr männerzentriertes, heterosexistisches Weltbild unhinterfragt übernommen wurde. Die Frauen allerdings hinterfragten dies schon recht bald und so wurden die ersten Krüppelfrauengruppen kurz nach den Krüppelgruppen gegründet. Ziel war die Analyse der speziellen Diskriminierungen, die behinderte Frauen erfahren und diese zu bekämpfen.
1983 wurde die erste wissenschaftliche Arbeit zur Situation behinderter Frauen veröffentlicht (Schildmann 1983), in der die Autorin feststellte, dass „davon auszugehen ist, dass in patriarchalischen Gesellschaften aufgrund der Machtverhältnisse von Männern über Frauen sowohl Normalität und Abweichung von der Normalität als auch Behinderung für Frauen und Männer unterschiedliches Gewicht bekommen. Die gesellschaftliche Unterdrückung (Behinderung) des weiblichen Geschlechts in der patriarchalisch-kapitalistischen Gesellschaft führt bei denen, die von der "‘weiblichen Normalität' abweichen, zu einer Potenzierung der Behinderung“. (1983, 41)
War dies noch eine Untersuchung einer nichtbehinderten Wissenschaftlerin über Frauen mit Behinderungen, brachten diese 1985 selbst ein Buch mit dem Titel „Geschlecht: behindert – Besonderes Merkmal: Frau. Ein Buch von behinderten Frauen“ (Ewinkel/Hermes) heraus. Trotz seines inzwischen beachtlichen Alters ist es immer noch der Klassiker zum Thema, und der Titel hat schon zahllose Veranstaltungen zum Thema geziert - bringt er doch das zugrunde liegende Dilemma hervorragend auf den Punkt: „Wir Krüppelfrauen sind Frauen, die behindert sind, wir werden aber als Behinderte behandelt, die nebenbei weiblich sind.“ (ebd., 8) Das Buch geht den bereits im Rahmen des Krüppeltribunals angerissenen Themen vertieft nach und beschäftigt sich zusätzlich noch mit Mutterschaft, Sterilisation, Sozialisation, Ausbildung und Rehabilitation. Der im Buch behandelte Themenkatalog prägt die Diskussion zum Thema behinderte Frauen bis heute.
Die Gruppen vor Ort trafen sich weiter und mischten sich in frauenpolitische Diskussionen ein. Im Rahmen der aufkommenden feministischen Kritik an den neuen Gen- und Reproduktionstechnologien konfrontierten sie die nichtbehinderten Kritikerinnen mit dem Zusammenhang von Eugenik, humangenetischer Beratung und selektiver Abtreibung und setzten damit die Diskussion darüber, wie politisch das Private in dieser Hinsicht ist, in Gang (Bremer Krüppelfrauengruppe 1991, 272). Diese Diskussionen, die zum Teil höchst emotional geführt wurden, führten auf dem 1. bundesweiten Kongress „Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologie“ dazu, dass in die Abschlussresolution die Forderung der behinderten Frauen nach Schließung der humangenetischen Beratungsstellen aufgenommen wurde (Bradish/Feyerabend 1989, 282) – wenn auch nur mit knapper Mehrheit. Das Thema der selektiven Abtreibung nach Pränataldiagnostik behielt ein hohes Konfliktpotential, da es sich um zwei letztendlich unvereinbare Positionen handelt: Die nichtbehinderten Frauen beharren darauf, dass selektive Abtreibung Teil ihres Selbstbestimmungsrechtes ist, die behinderten Frauen verurteilen diese Abtreibungen als behindertenfeindlich. Die Aussage „Wir meinen, dass es möglich ist, für das Recht von Frauen auf Abtreibung und gegen ein vermeintliches Recht auf ein nichtbehindertes Kind zu streiten“ (Degener/Köbsell 1992, 8) fasst diese Haltung zusammen.
Anfang der Neunzigerjahre begannen sich behinderte Frauen in Netzwerken auf Länderebene zusammenzuschließen und ins landespolitische Geschehen einzumischen; 1998 erfolgte die Gründung des Bundesnetzwerkes unter dem Namen „Weibernetz e.V.- Bundesnetzwerk von FrauenLesben und Mädchen mit Beeinträchtigungen"(20). Der Name macht auf eine andere interne Diskussion aufmerksam: Auch in der Bewegung der behinderten Frauen war zunächst Heterosexualität die unhinterfragte Norm, so dass die „Krüppellesben“ auch hier zunächst um Anerkennung kämpfen mussten. Aus diesem Dilemma heraus gründeten sie 1997 ihr eigenes Krüppel-Lesben-Netzwerk (Ruhm 1997, 25).
Behinderte Frauen begannen, sich in die Diskussion um Gleichstellungsgesetze einzumischen. 1993 und 1994 organisierte das gerade gegründete Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) je eine Tagung zum Thema „Die Forderungen behinderter Frauen an Gleichstellungsgesetze für Behinderte“ (Hermes 1994, 2). Daraus ging ein umfangreicher Forderungskatalog hervor (ebd., 93ff), der in die Gleichstellungsdebatte eingebracht wurde. Viele dieser Forderungen haben inzwischen Eingang in Gesetze gefunden: Sowohl das Behinderten- wie auch die Landesgleichstellungsgesetze und auch das SGB IX sehen die Berücksichtigung der besonderen Belange behinderter Frauen vor.
Neben dem Auslösen der Kontroverse um den selektiven Schwangerschaftsabbruch ist es ein großer Verdienst der behinderten Frauen, das Thema „sexuelle Gewalt gegen behinderte Mädchen und Frauen“ in die Öffentlichkeit gebracht zu haben und Maßnahmen sowohl zur Prävention wie auch zur härteren Bestrafung der Täter zu fordern. Ein Erfolg der Hartnäckigkeit, mit der sich die behinderten Frauen für ihre Belange einsetzen und einsetzten, ist z.B. die Änderung des Sexualstrafrechts von 2004 (kobinet vom 06.01.2004), wodurch der Schutz behinderter Menschen vor sexueller Gewalt verbessert wurde.
Seit 2003 führt das Weibernetz das vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend geförderte Projekt „Politische Interessenvertretung behinderter Frauen“ durch. Ziel dieses Projektes ist es sicher zu stellen, dass die im SGB IX und im Behindertengleichstellungsgesetz vorgesehenen Beteiligungsrechte für behinderte Frauen auch umgesetzt werden. Darüber hinaus vertritt das Weibernetz die Interessen behinderter Frauen in zahlreichen Gremien (21). Insgesamt kann man im Hinblick auf die Interessenvertretung behinderter Frauen von einer echten Erfolgsgeschichte sprechen, die noch nicht beendet ist.
Disability Studies
Seit 2001(22) beschäftigt ein neues Thema Teile der Behindertenbewegung: die Disability Studies. 2002 gründeten Anne Waldschmidt und Theresia Degener die Arbeitsgemeinschaft „Disability Studies Deutschland – wir forschen selbst“. Die Gruppe ist ein Zusammenschluss von behinderten Wissenschaftler/innen und Aktivist/innen aus der Behindertenbewegung, die ein Interesse daran haben, dass Disability Studies auch in Deutschland eingeführt und anerkannt werden. Die Sommeruni „Disability Studies – Behinderung neu denken“, die im Rahmen des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderungen im Juli 2003 in Bremen stattfand (23), bot erstmals den Rahmen, Disability Studies innerhalb der Bewegung zu diskutieren.
Entstanden sind die Disability Studies Ende der Siebzigerjahre unabhängig von einander in den USA und Großbritannien. Grundlage war in beiden Ländern die Entwicklung eines sozialen Modells von Behinderung, das dem gängigen medizinischen (oder auch individuellen) Modell von Behinderung entgegengesetzt wurde. Es war ein Gegenmodell zu einer Sichtweise, die Behinderung ausschließlich in der Schädigung und den Defiziten des Individuums begründet sieht. Entsprechend kann sie nur überwunden oder mit ihr umgegangen werden, wenn das Individuum geheilt wird, oder die Person ihr Schicksal akzeptiert. Die Schädigung und ihre Auswirkungen, wie schlechtere Bildung und Ausbildung, schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, reduzierte Mobilität etc. werden zur persönlichen Tragödie. Nichtbehinderung wird gleichgesetzt mit Normalität, Fitness, Kompetenz, Aktivität und Unabhängigkeit (Johnstone 2001, 17) und als „Wert an sich“ positiv bewertet. Behinderung stellt in dieser Dichotomie die Gegenseite dar: Abnormalität, Unfähigkeit, Abhängigkeit und Passivität und wird als negativ bewertet. Nach dieser Denkweise liegen alle in Folge einer Beeinträchtigung auftretenden Probleme im Individuum bzw. seiner Beeinträchtigung begründet. Anstrengungen zur Überwindung dieser Probleme sind wohlmeinende Almosen, die nicht auf die grundlegende Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse ausgerichtet sind. Man tut eher Dinge „für“ als „mit“ den betroffenen Menschen. Das soziale Modell dagegen begreift Behinderung als gesellschaftlich hergestellt, was zur Folge hat, dass auch Änderungen nicht auf individueller, sondern gesellschaftlicher Ebene erfolgen müssen.
Zur Fassung des Sozialen Modells von Behinderung sind im Rahmen der Disability Studies zwei Begriffe, bzw. ihre Abgrenzung gegeneinander, besonders wichtig: Disability und Impairment. Im Deutschen entspricht Disability dem politischen Begriff von Be-hinderung (der Verlust oder die Beschränkung von Möglichkeiten, am Leben in der Gemeinschaft gleichberechtigt teilzunehmen auf Grund räumlicher und sozialer Barrieren), Impairment kann mit Beeinträchtigung übersetzt werden (die funktionale Einschränkung einer Person auf Grund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Schädigung). Allerdings wird in der Anwendung des Sozialen Modells wie auch in den Behindertenbewegungen der Schwerpunkt auf die Be-hinderung, Disability, gelegt, also das soziale und politische Konstrukt von Behinderung oder einfacher: behindert ist man nicht, behindert wird man.
Aus der Abkehr vom medizinischen Modell von Behinderung folgt die Erforschung von Behinderung als sozial konstruierte Kategorie, und das wiederum bedeutet, Behinderung in einen sozialen, historischen und politischen Kontext zu stellen. Es geht darum, Behinderten ihre Geschichte und eine Stimme zu geben. Und es geht um einen Perspektivenwechsel in der Behinderungsforschung: statt wie bisher über, wird nun von und mit Menschen mit Behinderung geforscht. Sie werden so vom Forschungsobjekt zum aktiven Subjekt. Anne Waldschmidt beschreibt dies so: „Die Mehrheitsgesellschaft wird aus Sicht der „Behinderung“ untersucht, und nicht umgekehrt, wie es eigentlich üblich ist.“(2003, 16) Für die Forschung innerhalb der Disability Studies hat die veränderte Sichtweise von Behinderung weit reichende Konsequenzen. Die Menschen mit Beeinträchtigungen stehen hier im Mittelpunkt jedes Forschungsvorhabens. Ein wichtiges Prinzip ist dabei die Anerkennung der Tatsache, dass behinderte Menschen die besten Expert/innen sind, wenn es um die Erfahrung mit Behinderung geht. Die veränderte Forschungspraxis soll behinderten Menschen eine Stimme geben, die auch ihrem Ärger und ihrem Protest Ausdruck verleiht.
Disability Studies sehen sich in der Tradition der gender, race und critical culture studies, die alle ebenfalls politische, interdisziplinäre Studiengänge zu den jeweiligen sozialen Phänomenen sind. Aber warum „Disability“ (24) Studies? In einem Ansatz, der gerade weg will von den negativen Zuschreibungen und Bewertungen, die mit Behinderung verbunden sind, tat man sich mit diesem Wort natürlich schwer. Es hat sich dann aber doch weltweit in den Behindertenbewegungen die Verwendung des Wortes „disability“ durchgesetzt; so auch in den Disability Studies, wo man es vorzog, dem Begriff eine neue Bedeutung zu geben, anstatt einen neuen Begriff einzuführen (Linton 1998, 31)(25). Die Verwendung erfolgt seitens der Disability Studies, aber auch der Behindertenbewegungen in den USA und Großbritannien, im Sinne von be-hindern – also durch gesellschaftliche Bedingungen behindert werden. Nach längeren Diskussionen wurde der englische Begriff auch für Deutschland übernommen, da sich einerseits kein wirklich treffender deutscher Begriff fand und andererseits um deutlich zu machen, dass sich die deutschen Forscher/innen in den internationalen Diskussionszusammenhang einklinken.
Disability Studies als politische Wissenschaft verstehen sich – auch, aber nicht nur - als wissenschaftlicher Arm der politischen Behindertenbewegung. Es geht darum, auch in der Wissenschaft den Paradigmenwechsel von Fürsorge und Wohltätigkeit hin zu Bürgerrechten für Menschen mit Behinderungen zu vollziehen und damit wiederum die Voraussetzung für die Erlangung dieser Rechte schaffen. Anne Waldschmidt merkt hierzu an: „Soziale Teilhabe, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit, Gleichstellung und Bürgerrechte – das sind zentrale Anliegen der Disability Studies. Allerdings: Würden die Disability Studies allein als Anwendungswissenschaft der Behindertenbewegung und wissenschaftliche Reflexion von Betroffenenperspektiven gesehen, so wäre dies ein Missverständnis und würde auf eine Verkürzung des Ansatzes hinaus laufen.“ (Waldschmidt 2003, 14) Die Disability Studies wären jedoch ohne die Behindertenbewegungen in den jeweiligen Ländern nicht entstanden und so sollte es das Anliegen beider Seiten sein, sich gegenseitig Impulse zu geben (Priestley 2003, 31).
Die deutsche Behindertenbewegung wandte sich ebenfalls frühzeitig gegen das medizinische Modell von Behinderung mit seinen negativen Zuschreibungen und seiner Defektorientierung, allerdings mit anderer Terminologie. Der zentrale Begriff war hier der der Aussonderung, verbunden mit der politischen Forderung nach Abschaffung aussondernder Einrichtungen und dem Aufzeigen aussondernder gesellschaftlicher Mechanismen und ihrer Folgen. Der hier verwendete Behinderungsbegriff war und ist ein stark politisierter. Ausdruck dessen war die bewusste Verwendung des Begriffes „Krüppel“ anstelle von „Behinderte“. Behinderung wurde als Unterdrückungsverhältnis zwischen Behinderten und Nichtbehinderten begriffen. Eingefordert wurde und wird das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und die Präsenz behinderter Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Doch trotz Kritik am medizinischen Modell von Behinderung und ausgeübter Wissenschaftskritik kam es in Deutschland nicht zur Entwicklung eines mit den Disability Studies vergleichbaren „eigenen“ wissenschaftlichen Ansatzes.
Es wurde zwar kein explizites „soziales Modell von Behinderung“ formuliert, implizit war es jedoch seit Beginn der Behindertenbewegung vorhanden. So lobte Franz Christoph in seinem Asylantrag 1980(26) den „wichtigen“ Ansatz Wolfgang Jantzens dafür, „die Unterscheidung zwischen 'Schaden' und 'Behinderung'“ gemacht zu haben (Christoph 1980, 23), was der Unterscheidung zwischen Impairment und Disability in den Disability Studies entspricht. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung beschränkte sich auf die Kritik an z.B. der Behindertenpädagogik – die Entwicklung eigener Modelle und Theorien auf wissenschaftlicher Ebene fand nicht statt.
Versuche, eine Entwicklung in Richtung Disability Studies anzustoßen, verliefen bis 2001 im Sande, eine wissenschaftlich-theoretische Auseinandersetzung mit unseren Themen fand nicht statt; anscheinend war die Zeit für Disability Studies in Deutschland damals noch nicht reif.
Es drängt sich die Frage auf, warum die deutsche Bewegung erst so spät und dann auch nur durch Anstoß von außen angefangen hat, sich für die wissenschaftliche Bearbeitung behinderungsrelevanter Themen aus Betroffenensicht zu interessieren. Dies heraus zu finden wäre ein schönes Projekt für die Disability Studies. So kann man nur mutmaßen woran es lag und Faktoren benennen, die vermutlich dazu beigetragen haben: Es waren relativ wenige Aktive, deren Kräfte weitgehend anderweitig gebunden waren; es war wahrscheinlich auch unser Bildungssystem daran beteiligt, das akademische Karrieren behinderter Menschen nicht gerade fördert, wie auch die in Teilen der Bewegung vorhandene Angst vor Intellektualisierung, vor der Franz Christoph bereits 1980 gewarnt hatte. Er sah einen „Schichtkonflikt (zwischen Akademiker/innen und Nichtakademiker/innen S.K.), der wohl einmal die gesamte Behindertenbewegung durchziehen wird“ (Christoph 1980, 25f) voraus. Andere befürchteten eine Entsolidarisierung untereinander sowie die Entwicklung neuer Hierarchien (Ehlers 1998).
So gibt es immer noch einen großen Nachholbedarf z.B. an Theoriebildung und Methodenentwicklung. International ist zu beobachten, dass zunehmend Kritik am sozialen Modell von Behinderung geübt wird, da es u.a. die Lebenswirklichkeit behinderter Menschen nur unzureichend abbilde (z.B. Crow 1996). In diesem Zusammenhang plädiert Anne Waldschmidt (2005, 25) für einen „kulturwissenschaftlichen Perspektivenwechsel“ und entwickelt ein kulturelles Modell von Behinderung, das davon ausgeht, „dass Sozialleistungen und Bürgerrechte allein nicht genügen, um Anerkennung und Teilhabe zu erreichen, vielmehr bedarf es auch der kulturellen Repräsentation. Individuelle und gesellschaftliche Akzeptanz wird erst dann möglich sein, wenn behinderte Menschen nicht als zu integrierende Minderheit, sondern als integraler Bestandteil der Gesellschaft verstanden werden.“ (ebd., 27) Man darf also gespannt sein, wie sich die Disability Studies in Deutschland weiter entwickeln werden.
Der Stand der Dinge
Die deutsche Behindertenbewegung ist bereits öfter für tot erklärt worden. So konstatierte Franz Christoph bereits 1993, dass „unsere Bewegung am Boden liegt“ (145) und Eckhard Rohrmann stellte 1999 fest, dass die Bewegung vom „brüllenden Löwen“ zum „kläffenden Schoßhund“ verkommen sei. Fest steht, dass sie sich verändert hat. Aus der locker organisierten „kleinen radikalen Minderheit“ der ersten Jahre haben sich etablierte Organisationen entwickelt. Früher unvorstellbar gibt es einen Dachverband, Projekte werden mit Mitteln der ehemaligen „Aktion Sorgenkind“ finanziert und es wird zu bestimmten Fragen mit den großen Behindertenverbänden zusammengearbeitet.
Wenn man auch gegenüber der „wilden“ Anfangszeit feststellen muss, dass tatsächlich Vieles braver und angepasster geworden, die Konfrontation eher der Kooperation gewichen ist, und die Aktionen nicht mehr so spektakulär sind wie damals, so zeigt sich doch, dass sich die Behindertenbewegung in ihren wesentlichen Inhalten treu geblieben ist. Von Anfang an bis heute ging und geht es darum, Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ihnen Kontrolle über ihr Leben zu verschaffen (Frehe 1984, 122). Man wollte weg von dem individualisierenden medizinischen Blick auf Behinderung; Aussonderung und Diskriminierung bekämpfen – Ziele, die heute immer noch ihre Gültigkeit haben, wenn sich auch die Mittel und Wege dorthin verändert haben.
Und so kann die Bewegung durchaus mit Stolz auf ihre Erfolge blicken. Es gibt über 20 Zentren für Selbstbestimmtes Leben, in denen alle Entscheidungen von Menschen mit Behinderungen getroffen werden. Es gibt mehr und mehr Menschen mit Behinderungen, die ihre Persönliche Assistenz selbst organisieren. Wie es aussieht, wird es bald ein zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz geben, dass das Merkmal „Behinderung“ mit berücksichtigt. Vertreter der Bewegung sitzen in Parlamenten und Gremien, die Behindertenpolitik der Bundesrepublik hat einen viel zitierten „Paradigmenwechsel“ – von der Fürsorge zur gleichberechtigten Teilhabe – vollzogen (Haack 2003). Zeigen muss sich jetzt, wie sich dieser Paradigmenwechsel in Zeiten leerer Kassen auch im Alltag behinderter Menschen umsetzen lässt. Auch andere Entwicklungen bzw. ihre Verhinderung sind auf eine starke und funktionierende Behindertenbewegung angewiesen: so z.B. die Verhinderung der Aussonderung behinderter Menschen in Heime, die wieder verstärkt gebaut werden, und das zunehmende Infragestellen des Wertes behinderten Lebens im Zuge der Entwicklung neuer technischer und medizinischer Machbarkeiten. Im Angesicht der vielfältigen Herausforderungen ist der deutschen Behindertenbewegung ein langes Leben zu wünschen. Zu wünschen ist ihr auch, dass sich wieder mehr junge Menschen mit Behinderung für ihre Rechte engagieren und nicht nur die Früchte der „Alten“ genießen – auf dass die Bewegung lange leben möge.
Anmerkungen
1. Auf Hitlers Anweisung, jedoch ohne gesetzliche Grundlage, wurden im Zuge der „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ viele tausend behinderte Menschen umgebracht. (Klee 1983) Obwohl die meisten der Transporte und Tötungen dokumentiert wurden, kann man die Zahl der Opfer nur schätzen. Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der „Euthanasie“ ca. 300.000 behinderte Menschen umgebracht wurden (Schmuhl 1999).
2. Der 1917 gegründete “Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten – Reichsbund“ (heute „Sozialverband Deutschland“) nahm 1946 seine Arbeit wieder auf (http://www.sovd-bv.de/sozialverband_deutschland.htm, 01.08.2005); 1950 wurde der „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ (heute: „Sozialverband VdK Deutschland“) gegründet.
3. heute "Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung".
4. heute “Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte".
5. http://www.polio-berlin.de/Schluck1.htm, 16.08.2005.
6. http://www.emergency-management.net/pdf/contergan_brd.pdf, 20.08.2005.
7. http://www.aktion-mensch.de/chronik/index.html, „1961“, 18.08.2005.
8. dokumentiert im Film: „Lieber Arm ab als arm dran“.
9. Beate Klarsfeld schlug am 7.11.1968 den damaligen Bundeskanzler Kiesinger ins Gesicht, um damit auf dessen Nazi-Vergangenheit aufmerksam zu machen. Sie wurde dafür zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde 1969 umgewandelt in 4 Monate Haft auf Bewährung (vgl. www.netzwelt.de/lexikon/Beate_Klarsfeld.html, 18.08.2005).
10. http://www.isl-ev.org/2005/08/18/mitgliedsorganisationen/, 18.08.2005.
11. Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben Deutschland, ISL e.V..
12. http://www.isl-ev.org/2001/06/21/grundungsresolution-der-isl-ev/, 18.08.2005.
13. http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnis_90/Die_Gr%C3%BCnen, 22.08.2005.
14. der Americans with Disabilities Act, kurz ADA, von 1990.
15. www.nw3.de.
16. http://www.aktion-mensch.de/chronik/index.html, 20.08.2005.
17. lediglich Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Thüringen hatten Ende 2005 noch kein Landesgleichstellungsgesetz, es liegen aber auch dort zumindest Referentenentwürfe vor (http://www.wob11.de/gesetze/landesgleichstellungsgesetz.html#thueringen, 19.12.05).
18. Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben.
19. Franz Christoph teilte diese Meinung nicht vgl. Christoph 1993, 151 ff.
20. www.weibernetz.de
21. http://www.weibernetz.de/wir.html, 01.09.2005.
22. Im Rahmen der Ausstellung des Hygiene Museums Dresden „Der (im)perfekte Mensch“ (vgl. Stiftung Deutsches Hygienemuseum 2001) haben 2001 und 2002 zwei Tagungen stattgefunden, auf denen die Disability Studies zum ersten Mal einem breiteren Publikum vorgestellt wurden.
23. Die Sommeruni ist dokumentiert in Waldschmidt 2003 und Hermes/Köbsell 2003.
24. „able“ = fähig, „dis“ als Negation : Disability = Unfähigkeit.
25. „We have decided to reassign meaning rather than choose a new name”.
26. Franz Christoph stellte 1980 einen Antrag auf politisches Asyl in den Niederlanden (Christoph 1980), „weil er seine Existenz in der BRD bedroht sah.“ (Klaus 1980, 6) Der Antrag wurde von den niederländischen Behörden abgelehnt.
Literatur:
Aktion Mensch: Chronik der Aktion Mensch
www.aktion-mensch.de/chronik/index.html, 18.08.2005
Arbeitskreis zur Aufarbeitung der Geschichte der „Euthanasie“ (1987): Kein neues Sterilisationsgesetz in der Bundesrepublik
In: die randschau 3/1987, S. 21 -22
Bradish, Paula; Feyerabend, Erika; Winkler, Ute (1989): Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologien. Beiträge vom 2. bundesweiten Kongress Frankfurt, 28.-30.10.1988; Frauenoffensive: München
Bremer Krüppelfrauengruppe (1991): Trau, schau, wem..
In: Frauen gegen den § 218, bundesweite Koordination (Hg.): Vorsicht „Lebensschützer“! Die Macht der organisierten Abtreibungsgegner, Konkret Literatur Verlag: Hamburg, S. 227 -231
Christoph, Franz (1980): Asylantrag
In: Psychologie & Gesellschaftskritik, Jg. 4, Heft 3, S. 9 - 30
Christoph, Franz (1984): Unterdrückung durch Normalität
In: Gerber, Ernst P.; Piaggio, Lorenzo (Hrsg., 1984): Behinderten-Emanzipation. Körperbehinderte in der Offensive, Z-Verlag: Basel, S. 69 – 77 (Nachdruck des „Behindertenstandpunkt“ von 1980)
Christoph, Franz (1993): Pädagogische Betroffenheit
In: Mürner, Christan; Schriber, Susanne: Selbstkritik der Sonderpädagogik? Stellvertretung und Selbstbestimmung, Edition SZH: Luzern, S. 137 – 153
Crow, Liz (1996): Including all of our lives: Renewing the social model of disability. In: Barnes/Mercer (ed.): Exploring the Divide, The Disability Press: Leeds/UK
http//www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Crow/exploring%20the%20divide%20ch4.pdf, 15.06.2003
Daniels, Susanne, von; Degener, Theresia u.a. (Hrsg.) (1983): Krüppeltribunal
Menschenrechtsverletzungen im Sozialstaat, Pahl-Rugenstein: Köln
Degener, Theresia; Köbsell, Swantje (1992): „Hauptsache, es ist gesund”?! Weibliche Selbstbestimmung unter humangenetischer Kontrolle
Konkret Literatur Verlag: Hamburg
Degener, Theresia (2000): Antidiskriminierungsgesetze für Behinderte weltweit – ein Überblick
www.netzwerk-artikel-3.de/wsite/referat.htm, 25.08.05
Ehlers, Heino (1998): Tendenz steigend
In: die randschau 2/1998, S. 10
Eisermann, Martin (1997): Namen sind Schall und Rauch? Diskriminierung durch Sprache am Beispiel der Aktion Sorgenkind
In: die randschau 4/97, S. 58-59
Emmrich, Michael (1997): Der vermessene Mensch. Aufbruch ins Gen-Zeitalter
Aufbau: Berlin
Ewinkel, Carola; Hermes, Gisela u.a. (Hrsg.) (1985): Geschlecht: behindert – Besonderes Merkmal: Frau. Ein Buch von behinderten Frauen,
AG SPAK: München
Forum behinderter Juristinnen und Juristen (2000): Entwurf eines Gleichstellungsgesetzes für Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik Deutschland
www.behindertenbeauftragter.de/pdfs/1116418775_pdf.pdf, 01.09.2005
Fränkische Nachrichten vom 24.05.2003: 80 Plätze für Schwerbehinderte
www.eduard-knoll-wohnzentrum.de/fnweb_80_Platze_fur_Schwerbehinderte__24_05_2003_.htm, 18.08.2005
Frehe, Horst (1984): Konfrontation oder Integration
In: Gerber, Ernst P.; Piaggio, Lorenzo (Hrsg.): Behinderten-Emanzipation. Körperbehinderte in der Offensive, Z-Verlag: Basel, S. 104 – 129
Frehe, Horst (1997): Nachruf auf Franz Christoph
In: die randschau 1/1997, S. 10
Fretter, Jörg (1991): Frauenpflege vor Gericht
In: die randschau 1/1991, S. 16-17
Frevert, Uwe (o.J.): Erfahrungsbericht DieSL
www.zsl-mainz.de/projekte_DieSL_Uwe.html, 18.08.2005
Haack, Karl-Hermann (2003): Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik. Rede auf der Tagung „Gleich richtig stellen“ am 26./27. Juli 2003 in Bremen
www.netzwerk-artikel-3.de/tagung/260703haack.php, 01.09.2005
Heiden, Hans-Günter (2003): Gesetze fallen nicht vom Himmel – Stationen auf dem Weg zum BGG
In: Netzwerk Artikel 3 e.V.: Leitfaden zum BGG, S. 35 – 38
gehoerlosenbund.de/download/pdf/bgg_leitfaden.pdf, 18.08.2005
Hermes, Gisela (Hg.) (1994): Mit Recht verschieden sein. Forderungen behinderter Frauen an Gleichstellungsgesetze, bifos Eigenverlag: Kassel
Hermes, Gisela; Köbsell, Swantje (Hg.) (2003): Disability Studies in Deutschland – Behinderung neu denken. Dokumentation der Sommeruni 2003, bifos: Kassel
Horst und Franz (1979): Nachtrag
In: Krüppelzeitung 1/1979, S. 52
Johnstone, David (2001): An Introduction to Disability Studies
Fulton Publishers: London, Second Edition
Jürgens, Andreas (1986): Anti-Diskriminierungsgesetze in den USA und bei uns
In: die randschau 4/1986, S. 14 - 17
Klaus (1980): Politisches Asyl für Krüppel
In: Krüppelzeitung 1/1980, S. 6 - 11
Klee, Ernst (1980): Behinderte im Urlaub? Das Frankfurter Urteil. Eine Dokumentation, Fischer Taschenbuch Verlag: Frankfurt/ Main
Klee, Ernst (1983): „Euthanasie“ im NS-Staat. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“, S. Fischer: Frankfurt/ Main
Klees, Bernd (1988): Der gläserne Mensch im Betrieb
Frankfurt/ Main
Kluge, K.-J. und L. Sparty (1977): Sollen, können, dürfen Behinderte heiraten? Rehabilitationsverlag: Bonn-Bad Godesberg
Kobinet-Nachrichten vom 23.07.2003: Der Marsch durch die Institutionen
kobinet-nachrichten.org/2003/07/2080.php, 15.08.08
Kobinet-Nachrichten vom 06.01.2004: Verschärfung des Sexualstrafrechtes beschlossen
127.0.0.1/cache, 14.06.2004
Kobinet-Nachrichten vom 13.12.2004: Wird Tötungsphilosoph Peter Singer in Deutschland hoffähig?
www.kobinet-nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,6510/ticket,g_a_s_t, 15.08.2005
Kobinet-Nachrichten vom 05.09.2005: Rot-grünes Antidiskriminierungsgesetz entgültig gestoppt
www.kobinet-nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,9299/ticket,g_a_s_t, 05.09.2005
Kobinet-Nachrichten vom 09.05.2006: Im Streit um Diskriminierungsschutz eingelenkt
www.kobinet-nachrichten.org/cipp/kobinet/custom/pub/content,lang,1/oid,11655/ticket,g_a_s_t, 09.05.2006
Köbsell, Swantje; Strahl, Monika (1986): Humangenetik – die „saubere Eugenik“ auf Krankenschein
In: die randschau 3/1986, S. 3 -11
Köbsell, Swantje; Waldschmidt, Anne (1989): Pränatale Diagnostik, Behinderung und Angst
In: Bradish, Paula; Feyerabend, Erika; Winkler, Ute (Hrsg.): Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologien, Frauenoffensive: München, S. 102 - 107
Köbsell, Swantje (1987): Eingriffe. Zwangsterilisation geistig behinderter Frauen, AG SPAK: München
Köbsell, Swantje (1988): Behinderte behindern den Sterbehelfer
In: die randschau 2/1988, S. 15-16
Krüppelgruppe Bremen: Protest gegen geplante Werner-Catel-Stiftung
In: Krüppelzeitung 1/1984, S. 42
Deutschmann, Wolfram (1982): Lieber Arm ab als arm dran, Deutschland 1982
Linton, Simi (1998): Claiming Disability. Knowledge and Identity
New York/London
Miles-Paul, Ottmar (2004): Vom Benachteiligungsverbot zum Gleichstellungsgesetz
kobinet-Nachrichten vom 30.06.2004
Miles-Paul, Ottmar; Frevert, Uwe (o.J.): Zentren fuer selbstbestimmtes Leben Behinderter in Deutschland
www.behinderte.de/ISL/ZENTRENF.HTM, 31.08.04
Nati (1980): Mit Puder und Crem’ wird auch die Krüppelfrau schön
In: Krüppelzeitung 2/1980, S. 61 - 63
N.N. (1979a): Sollen – können – dürfen Schwerbehinderte Auto fahren?
In: Leben und Weg. Der Körperbehinderte. Zeitschrift für Körperbehinderte, Förderer
und an Problemen Körperbehinderter Interessierter, 19(2)April 1979, S. 3 – 4
N.N. (1981): Resolution vom 24.01.1981, (Privatarchiv S.K.)
N.N. (1982): Warum Krüppel?
In: Krüppelzeitung 1/82, S. 2
N.N. (1987b): Selbstbestimmt Leben. Entwicklung eines Bremer Projektes,
In: die randschau 3/1987, S. 6 - 10
Priestley, Mark (2003): Worum geht es bei den Disability Studies? Eine britische Sichtweise,
In: Waldschmidt, Anne: Kulturelle Perspektiven der Disability Studies. Tagungsdokumentation, bifos: Kassel, S. 23 - 35
Ratzka, Adolf (1982): Schweden – Wunderland der Integration? Eine Übersicht über gemeindenahe ambulante Dienste in Schweden
In: Vereinigung Integrationsförderung e.V.: Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten? Neue Wege gemeindenaher Hilfen zum selbständigen Leben. Kongressbericht der internationalen Tagung „Leben, Lernen, Arbeiten in der Gemeinschaft“, München 24.- 26. März 1982, S. 56 – 64
Reuter, Michael; Pudwill, Regina (1987): Das unmögliche Urteil. NZ-Ärzteprozess
In: die randschau 4/1987, S. 6 - 10
Rohrmann, Eckhard (1999): Vom „brüllenden Löwen“ zum „kläffenden Schoßhund“. Zur Institutionalisierung und Professionalisierung von Selbsthilfegruppen im Behindertenbereich
In: Günther, Peter; Rohrmann, Eckhard (Hrsg.): Soziale Selbsthilfe. Alternative, Ergänzung oder Methode sozialer Arbeit, Edition S: Heidelberg, S. 52 - 86
Ruhm, Kassandra: Krüppel-Lesben-Netzwerk
In: die randschau 4/1997, S. 25
Sandfort, Lothar (1983): GRUENE UND BEHINDERTE
In: Krüppelzeitung 2/1983, S: 15 – 16
Schildmann Ulrike (1983): Lebensbedingungen behinderter Frauen. Aspekte ihrer gesellschaftlichen Unterdrückung, focus: Gießen
Schmuhl, Hans-Walter (1999): Heilen und Vernichten. Der Mord an psychisch Kranken und geistig Behinderten im „Dritten Reich“
www.psychiatrie-erfahrene.de/eigensinn/aktuelle_texte.htm, 02.02.2006
Sierck, Udo; Radtke, Nati (1984): Die Wohltätermafia. Vom Erbgesundheitsgericht zur Humangenetischen Beratung, Selbstverlag: Hamburg
Sierck, Udo (1988): Behinderte und Grüne - Alles Lüge!?
In: die randschau 2/1988, 20-21
Sierck, Udo (1989): Unser Lebensrecht ist undiskutierbar
In: die randschau 2/3 1989, S- 7 - 10
Steiner, Gusti (1983): In eigener Sache
In: Deppe-Wolfinger, Helga (Hrsg.): behindert und abgeschoben. Zum Verhältnis von Behinderung und Gesellschaft, Beltz: Weinheim und Basel, S. 79 - 92
Steiner, Gusti (2003): Wie alles anfing – Konsequenzen politischer Behindertenselbsthilfe
forsea.de/projekte/20_jahre_assistenz/steiner.shtml, 18.08.2005
Stiftung Deutsches Hygienemuseum; Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e.V. (Hg.) (2001): der (im)perfekte mensch. Vom recht auf unvollkommenheit
Hatje Cantz Verlag: Ostfildern-Ruit
Tolmein, Oliver (1985): Rollis machen Zoff. Bisher einmalige Aktion von Rollstuhlfahrern im Bonner Parlament/ Debatte über Bundespflegegesetz unterbrochen
In: taz vom 15.11.1985, abgedruckt in Krüppelzeitung 1/1985, 25
Waldschmidt, Anne (1984): Zu den Strukturen und Wirkungsmöglichkeiten von Selbsthilfezusammenschlüssen im Behindertenbereich
Unveröffentlichte Diplomarbeit im Studiengang Sozialwissenschaft, Universität Bremen
Waldschmidt, Anne (2003): Kulturwissenschaftliche Perspektiven der Disability Studies. Tagungsdokumentation, bifos: Kassel
Waldschmidt, Anne (2005): Disability Studies: Individuelles, soziales und/oder kulturelles Modell von Behinderung?
In: Psychologie & Gesellschaftskritik Jg. 29, Heft 113, S. 9 – 31
Heterogenität und Inklusion – Binnendifferenzierung und Individualisierung
Heterogenität und Inklusion – Binnendifferenzierung und Individualisierung
Birgit Wenzel
In eine Geschichtsstunde im Jahr 2010 hineingeschaut
In einem Klassenraum einer Berliner Hauptschulklasse sitzen 20 (von 23) Schülerinnen und Schüler, das Fach Geschichte steht auf dem Plan.
Die Schülerschaft setzt sich international zusammen, die Jugendlichen selbst bzw. ihre Eltern kommen aus Bosnien (2 Schüler/innen), Deutschland (2), Gambia (1), Ghana (1), Guinea (1), Indien (2), Kenia (2), Lettland (1), Libanon (1), Mazedonien (1), Nigeria (1), Polen (1), Russland (1), Serbien (2), Simbabwe (1) und der Türkei (3). Nur fünf der Lernenden mit Migrationshintergrund gehören der sogenannten zweiten Generation an und sind in Deutschland geboren; die anderen sind als Kinder oder Jugendliche immigriert.
Für einen kurzen Zeitraum der Stunde sind viele aus der Gruppe aktiv und engagiert dabei: Die Lernenden überlegen, was einen „Viel/völker/staat“ ausmacht. Trotz des „Aufblitzens“ von reger Unterrichtsbeteiligung zu dieser Frage blieben einige Lernende während der gesamten Stunde völlig passiv. Hierfür gab es sicher verschiedene und individuelle Ursachen, zu ihnen zählen jedenfalls auch mangelndes Sprachverständnis und Überforderung. Binnendifferenzierende und individualisierende Lern- und Arbeitsangebote wären hier zusätzlich notwendig gewesen, um tatsächlich alle aktiv in den Unterrichtsprozess zu integrieren.
Eine typische Situation oder eher eine spezifische Ausnahme?
Die hier vorgestellte Zusammensetzung einer Klasse entspricht (fast) einer üblichen für eine Großstadt (hier eine Berliner Hauptschulklasse im Bezirk Wilmersdorf, nicht etwa in Berlin-Neukölln).
Was ist verallgemeinerbar?
Neben sicher auch spezifischen Aspekten erscheinen mir folgende zwei als verallgemeinern bar und relevant:
Zum einen: Lerngruppen sind heute heterogen zusammengesetzt. Diese Heterogenität fällt – je nach Region und Schulart – unterschiedlich aus. Die Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Lernenden muss Berücksichtigung finden und mit Heterogenität (bedingt durch Geschlecht, Kultur, Begabung, sozialen Hintergrund, durch Religion, Sprache, Förderschwerpunkt, Be-hinderung ...) sollte individuell und kreativ, vor allem aber differenzierend und individualisierend, umgegangen werden.
Zum anderen: Geschichtsunterricht bietet viele Möglichkeiten des Lebenswelt- wie auch des Gegenwartsbezugs. Vielfalt und Heterogenität z.B. sind Kennzeichen moderner Gesellschaf-ten, aber auch solcher in der Geschichte. Insbesondere durch Migration bedingt, zeigen auch Kulturen in der Vergangenheit große Verschiedenartigkeiten auf. Wie sind die Menschen dieser Kulturen damit umgegangen? Wie gehen heute unterschiedliche Gesellschaften mit Heterogenität um? Die Vielfalt der Perspektiven und Deutungen können im Geschichtsunterricht thematisiert und genutzt werden, damit Lernende sich einlassen und letztlich auch Bezüge zwischen Geschichte und (ihrer) Gegenwart erkennen.
Ziele des Beitrags
Die Heterogenität von Lerngruppen macht ein wesentliches Element, ja den „Normalfall“ heutigen Unterrichts in der Bundesrepublik aus (1). Dass Unterricht Formen der Differenzie-rung und der Individualisierung finden muss, um sowohl den Mehrheiten, wie auch den Min-derheiten in den Lerngruppen gerecht zu werden, ist mindestens im Wissenschaftsdiskurs unbestritten. Dieser Beitrag will auch den Begriff und die Bedeutung der Inklusion vorstellen und Anstoß und Anregungen geben, sich auf die Heterogenität der Lerngruppen in der Pla-nung des Geschichtsunterrichts durch Binnendifferenzierung einzustellen. Dabei stellt die Inklusion den Oberbegriff und eine Fakten schaffende, politisch getroffene Entscheidungs-grundlage dar und die Binnendifferenzierung eine unterrichtswirksame, planerische Antwort auf Inklusion und Heterogenität.
Es wird sich zeigen, dass Begriff und Konzept der Inklusion so übergreifend zu verstehen sind, dass hierin die gesamte Vielfalt aller Lernenden bedacht und berücksichtigt werden muss und dass eine Unterscheidung in eine „allgemeine“ Heterogenität und eine weitere oder „andere“, verschiedene Förderschwerpunkte einbeziehende, obsolet wird.
Wenn der Artikel dennoch unterscheidende Ausführungen und Schwerpunkte beibehält, ist dies vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Unterrichtswirklichkeit in Deutschland (noch) nicht in der notwendigen Konsequenz der Konzeption der Inklusion entspricht. Leh-rende können, insbesondere wenn sie sich im Fachunterricht Geschichte, der eher in der ge-samten Gruppe erteilt wird und oft ohne zusätzliche personelle Unterstützung auskommen muss, berechtigt systematische und fachspezifische Hilfestellungen erwarten, die hier gege-ben werden sollen.
Heterogenität als Herausforderungen für den (Fach-) Unterricht
Gibt man bei einer beliebten Suchmaschine im Internet die Suchbegriffe Heterogenität, Schule und Unterricht ein, so kommt man auf rund 121.000 Einträge. Binnendifferenzierung und Unterricht ergeben noch etwa 82.000 Einträge. Unterrichtende Lehrer/innen, die sich auf die je vorgefundene Vielfältigkeit einlassen müssen und die mit ihrer Unterrichtsplanung darauf eingehen wollen, sehen sich mit vordergründig divergenten Zielstellungen konfrontiert:
Einerseits sollen alle Lernenden möglichst individuell gefördert werden und andererseits sollen und wollen Lehrende dazu beitragen, dass eine Lerngruppe gebildet wird, dass soziales Lernen eingeübt, gemeinsam an der Sache gearbeitet wird und bestimmte Standards von möglichst allen erreicht werden. Mit den Anforderungen, auf Heterogenität binnendifferenzierend zu reagieren und dennoch leistungsbezogen benoten zu müssen, steigt das Anforderungspotential an die einzelne Lehrerin, den einzelnen Lehrer, zusätzlich.
Binnendifferenzierung – warum?
Binnendifferenzierung und individuelle Förderungen werden im aktuellen Diskurs auch als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse internationaler Schulleistungsvergleiche und –studien vehement eingefordert, jedoch ohne, dass darauf politisch einhellig und konsequent mit entsprechenden Mitteln und Ressourcenerweiterungen reagiert würde. Auch die in Grundschulen zum Teil schon länger und mit Erfolg betriebenen Maßnahmen und Leistungen in den Bereichen der Individualisierung und der Binnendifferenzierung, besonders auch im integrativen Unterricht, machen „Druck“ auf die Oberschulen (2).
Lehrerhaltungen – empirische Ergebnisse
Angesichts des großen, hier nur angerissenen Problemfelds verwundert es nicht, dass laut einer quantitativen und qualitativen Studie zu Positionen von Lehrerinnen und Lehrern zur individuellen Förderung in der Sekundarstufe I (2006 und 2007) die Befragten Förderung durch Binnendifferenzierung zwar als wichtiges und anzustrebendes Ziel, zugleich aber auch als belastende Herausforderung ansehen und bewerten (3). Gründe dafür, dass in der Praxis nur zögerlich Lehr- und Lernbedingungen umgesetzt werden, die eine individuelle Förderung ermöglichen, wird von den Befragten vor allem in den strukturellen Gegebenheiten (Klassen-größe, Ausstattung etc.) identifiziert. Aber auch die Erfahrungen – so die Wahrnehmungen der Lehrerinnen und Lehrer – dass Lernende nicht „gegen“ ihren Willen gefördert werden können und dass eine angemessene Fortbildung benötigt wird, tragen laut Studienergebnis zu Grundhaltungen und zum Gelingen/Nichtgelingen von individueller Förderung bei.
Zu Recht fühlen sich viele Lehrer/innen mit der vorgefundenen Heterogenität überfordert, sollen sie doch häufig allein große Klassen unterrichten und den vielfältigsten Ansprüchen gerecht werden.
Das Fazit der oben erwähnten Studie: Grundlegend für gelingende individuelle Förderung ist eine Haltung, die Respekt und Vertrauen dem Einzelnen gegenüber beinhaltet sowie der Glaube an seine Stärken und (positiven) Leistungserwartungen (4). Zu einer solchen Grund-haltung kann die Planung als wichtiges Mittel und Instrument hinzukommen, ersetzen kann sie sie nicht.
Inklusion als Herausforderung für den (Fach-) Unterricht
Inhalt und Ziele von Inklusion
Die Entscheidung für die Inklusion, die in der Bundesrepublik getroffen worden ist, stellt mehr als eine „kleine Veränderung“ oder Weiterentwicklung dar, sie bedeutet einen Paradig-menwechsel.
Zur Genese
Bereits im Juni 1994 fand in Salamanca, Spanien, die UNESCO- Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“ statt. Die „Inklusion“ wurde aus der Taufe gehoben. 15 Jahre später, im Oktober 2009, tagte eine Konferenz am gleichen Ort unter dem Motto „Return to Salamanca: Confronting the Gap: Rights, Rhetoric, Reality?“. Der internationale Austausch von Fachleuten konnte einmal mehr Bemühungen für die Inklusion vor allem von Menschen mit geistiger Behinderung („intellectual disability“) feststellen, musste aber auch auf die begrenzten Fortschritte im Blick auf die Umsetzung in allen praktischen Belangen verweisen (5). Auch beim 15. Weltkongress von Inclusion International im Juni 2010 in Berlin, er stand unter dem Motto „Inklusion – Rechte werden Wirklichkeit“, ging es schwerpunktmäßig um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in nationales Recht (von 2006, vor allem von Artikel 24 über Bildungsfragen) (6).
Beschluss der Bundesregierung
Für Deutschland gilt, was die Bundesregierung am 26. März 2009 beschlossen hat und was als Pressemitteilung von Karin Evers-Meyer, Beauftragte der Bundesregierung für die Belan-ge behinderter Menschen in Berlin, online nachzulesen ist: „Die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist heute in Deutschland in Kraft getreten. Für Politik, Verwaltung und für die Gerichte sind die Vorgaben dieser Konvention seit heute verbindliches Recht.“(7) Von der Exklusion (Ausschluss von einer Beschulung) über die Segregation/Separation (Sonderbeschulung) bis zur Integration (in das Regelschulsystem) sind wir nunmehr auch in Deutschland bei der Inklusion (als differenzierte Beschulung für alle) – zumindest im Denken, wenn auch noch lange nicht im konsequenten Handeln – angekommen.
Inklusion – mehr als Integration
Inklusion versteht alle Schülerinnen und Schüler als unterschiedlich und als Menschen mit besonderen Bedürfnissen, auf die Pädagogik, Schule und Unterricht reagieren müssen. Hier steht die gesamte Klasse und nicht mehr einzelne behinderte Schüler/innen im Fokus. Wäh-rend die skandinavischen Länder und auch der englischsprachige Raum schon länger erfolg-reiche Praxiserprobungen aufweisen, stehen im deutschen Schulsystem einer wirklich effektiven individuellen Förderung noch viele Barrieren im Wege (8). Dennoch verweist einiges auf ein verändertes Bewusstsein. Behinderungen werden nicht (mehr) als unveränderbare Tatsachen oder festgeschriebene Defekte gesehen, sondern als „eine durch soziales Handeln und Erleben veränderliche Bedingung des Menschseins.“(9) Streng genommen wird mit dem systemischen Ansatz der Inklusion eine Aufhebung der Unterscheidung in behinderte und nichtbehinderte Lernende oder zwischen Förderschwerpunkten und „anderen“ heterogenen Voraussetzungen fällig und notwendig. Im Einzelnen machen den neuen Ansatz folgende Elemente aus (10): Die gesamte Lerngruppe (statt einzelne behinderte Lernende) steht mit allen personellen und materiellen Bedingungen und Beziehungen im Fokus der Betrachtung. „Die inklusive Schule braucht keine Förderpläne für einzelne Schüler in der Klasse, sondern Strategien und Handlungskompetenzen der Lehrpersonen für die ganze Klasse mit all ihren Indi-vidualitäten.“(11) Nicht das Kind wird in die passende Institution eingegliedert, sondern Ausstattung und Lernumgebung in der Regelklasse werden so angepasst, dass alle Kinder die notwendige individuelle Unterstützung erhalten.
Es ist offensichtlich, dass eine so umgesetzte Inklusion ganz andere Ressourcen benötigt, als sie unsere Schulen bisher in aller Regel zur Verfügung stellen können. Den politischen Aus-sagen und Beschlüssen müssen die notwendigen Maßnahmen folgen, die nicht „kostenneut-ral“ zu regeln sein werden.
Förderschwerpunkte im inklusiven (Geschichts-) Unterricht
Inklusiver (Geschichts-) Unterricht will gerade auch für Lernende mit Behinderungen inner-halb des allgemeinen Bildungssystems eine erfolgreiche Bildung erreichen und dabei die notwendigen individuellen Unterstützungen geben (12). Das fordert nicht zuletzt auch die Fachdidaktiken heraus, sich den Bedingungen und vor allem den Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen zu stellen. Hierfür wird es auch relevant, sich mit den konkreten Förderschwerpunkten der inklusiv beschulten Kinder und Jugendlichen zu befassen und in Erfahrung zu bringen, welche Lernschwächen, aber auch welche Stärken die jeweiligen Schüler/innen in einer Gruppe aufweisen (13).
Förderschwerpunkte
In Deutschland unterscheidet die KMK (14) in die Förderschwerpunkte „Lernen“, „Sehen“, „Hören“, „Sprache“, „Körperliche und motorische Entwicklung“, „Geistige Entwicklung“, „Emotionale und soziale Entwicklung“ (und „Förderschwerpunkt übergreifend bzw. ohne Zuordnung“). Dabei ist der Anteil des festgestellten Förderbedarfs seit 1998 gewachsen (von 4,4% auf 5,8 % aller Lernenden in 2006).
2006 gab es in Deutschland insgesamt 484.346 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-gischem Förderbedarf. Die größte Gruppe wurde dabei durch den Förderschwerpunkt Lernen gebildet (224.900, das entspricht 46,4%). Die in der Größe folgenden Gruppen waren Geistige Entwicklung (75.679 oder 15,6%), Sprache (49.822 oder 10,3 %) und Emotionale und soziale Entwicklung (48.217 oder 10,0 %). Diese vier Förderschwerpunkte bilden nicht nur die große Mehrheit, sondern auch spezielle Anforderungen an Lehrer/innen und deren Unterrichtsplanung, insbesondere in einer inklusiven Unterrichtssituation (15):
- Der Förderschwerpunkt Lernen umfasst Kinder und Jugendliche, die in ihrem Lern- Leistungsverhalten erhebliche und lang andauernde Beeinträchtigungen aufweisen, die häufig gekoppelt sind mit weiteren Beeinträchtigungen, vor allem in den sprachlichen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten.
- Der Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung meint Kinder und Jugendliche, die hochgradige Beeinträchtigungen in ihren intellektuellen Fähigkeiten haben und mit den damit verbundenen Lern- und Entwicklungsstörungen beträchtlich unter den altersgemäßen Entwicklungen liegen.
- Der Förderschwerpunkt Sprache befasst sich mit Kindern und Jugendlichen, die er-hebliche Sprachbehinderungen aufweisen und hierdurch ihre Fähigkeiten und Anlagen ohne eine gezielte, vor allem kommunikative Förderung nicht angemessen entwickeln können.
- Der Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung verweist auf Beeinträchtigungen in eben diesen Bereichen, sie beziehen sich auf das Erleben und das Verhalten. (Die daraus resultierenden Verhaltensauffälligkeiten und –störungen sind größtenteils auf die Erfahrungen und Prägungen in der familiären Sozialisation der Kinder und Jugendlichen zurückzuführen und führen häufig zu Lernstörungen, so dass Kinder mit diesem Förderschwerpunkt häufig zusätzlich den Förderschwerpunkt „Lernen“ aufweisen.)
Die benannten Schwerpunkte haben im Blick auf den Geschichtsunterricht zur Folge, dass eine schnell nachlassende Aufmerksamkeit und Probleme im Abstraktionsvermögen vor al-lem zu überschaubaren, anschauungsreichen und handlungs- und produktionsorientierten Arbeitsphasen führen werden.
Planungshinweise für einen binnendifferenzierenden (Geschichts-) Unterricht und individuelle Förderung als eine Antwort auf heterogene Lernvoraussetzungen
Ein Blick in die allgemeindidaktische Literatur
An Literatur für Binnendifferenzierung und Individualisierung des Unterrichts, deren Vor-schläge auch in diesen Artikel einfließen, mangelt es nicht. Mit unterschiedlichsten und viel-fältigen Ansätzen wird für die Differenziertheit des Unterrichts argumentiert, eben weil die Lernenden selbst, wie auch ihre Lernprozesse, von großer Varianz geprägt sind. Bönsch nennt mindestens sieben Kriterien, in denen es große Unterschiedlichkeiten bei den Lernenden gibt (16): Die Auffassungsgabe, das Lerntempo, die Lernkapazität (also die Lerninhaltsmenge, die bei Überforderung zu Lernblockaden führen kann), das Anspruchsniveau (das sich vor allem auf die Wege des Lernens auswirken sollte), das Sprach- und Sprechniveau (eng mit dem Anspruchsniveau zusammenhängend), die Motiviertheit (als Gestimmtheit zum Lernen) und schließlich die Selbstorganisation und Selbststeuerung (als Fähigkeit, die eigene Lernarbeit zu organisieren und zu verantworten).
Liane Paradies unterscheidet drei Grundformen der inneren Differenzierung, den individuali-sierten Unterricht (als Interessen- und Wahldifferenzierung), den kooperativen Unterricht (als schulorganisatorische Differenzierung) und den gemeinsamen Unterricht (als didaktische Differenzierung) (17). Binnendifferenzierung ist (ansatzweise) auch im gemeinsamen Unterricht möglich, besser und effektiver sowie gezielter jedoch in kooperativen Lernformen (Gruppen- und Partnerarbeit) sowie in individualisierenden Lernphasen.
Anregungen für den Geschichtsunterricht?
Entgegen der breiten Literaturgrundlage innerhalb der Pädagogik liegen jedoch bisher nur wenige konkrete Überlegungen für den Geschichtsunterricht vor. Ertragreich sind jedoch die Ausführungen Peter Adamskis zur inneren Differenzierung im Geschichtsunterricht (18) so-wie weitere Aufsätze des Heftes „Differenzierung“ der Zeitschrift Geschichte Lernen (Nr. 131, 2009). Anhand realer Unterrichtsbeispiele beschäftigen sie sich mit der Förderung von Leseschwächen im Geschichtsunterricht, der Differenzierung in einem längerfristigen Unter-richtsvorhaben, der Lernwerkstatt und den Lernstationen.
Möglichkeiten, (auch) im Geschichtsunterricht zu differenzieren, gibt es sehr viele, wie ein Überblick in einer Map veranschaulicht (19). Für welche Möglichkeiten man sich (am besten gemeinsam mit der Lerngruppe) entscheidet und wie man sie untereinander kombiniert, hängt zu allererst von den Lernvoraussetzungen auf der einen Seite und den Unterrichts-inhalten und –zielen auf der anderen ab. Aber auch andere Faktoren, wie persönlichkeitsspezifische, örtliche, räumliche, personelle (zusätzliche Unterstützung) oder schulorganisatorische müssen mit bedacht werden. Wünschenswert im Sinne einer erfolgreichen Binnendifferenzierung ist, dass eine stimmige Passung der Faktoren vorgenommen wird, Lehrende und Lernende aber auch gemeinsam viel Mut zum Ausprobieren aufbringen.
Planungshinweise für einen inklusiven Geschichtsunterricht unter der besonderen Berücksichtigung von Lernenden mit Förderschwerpunkten
Im Folgenden werden wesentliche Planungselemente, die sowohl für einen zielgleichen, wie auch für einen zieldifferenten (20) Unterricht anwendbar sein können, in Form von Thesen und ihren Begründungen vorgestellt (21). Im Anschluss werden sie als Überblick zusammenfassend und durch weitere Faktoren ergänzt in Form einer Tabelle gebündelt. Im Blick sind dabei vor allem Kinder und Jugendliche mit den Förderschwerpunkten Lernen (sie bilden laut KMK die jeweils größte Gruppe der Lernenden mit einem Förderschwerpunkt, sowohl in den Förder- wie in den allgemeinbildenden Schulen), und Emotionale und soziale Entwick-lung (die zweitgrößte Gruppe mit einem Förderschwerpunkt in den allgemeinbildenden Schulen). Aber auch für andere individuelle Voraussetzungen, die sich z.B. durch eine einge-schränkte Fähigkeit ausdrücken, mit der (deutschen) Sprache umzugehen, bilden die Hinweise sinnvolle Anregungen und insofern Unterstützung für heterogene Lernsituationen.
Besondere Herausforderungen des Faches Geschichte
Sie liegen sicher vor allem darin, dass Lernende hier mit „Fremdheit“ in mehrfacher Hinsicht umgehen müssen; sie haben es mit Alterität im Blick auf die Zeit und häufig auch im Blick auf den Ort, den Raum, zu tun.
Ziel des konkreten (Geschichts-) Unterrichts kann es nicht sein, alle vorgestellten Überlegungen und Anregungen gleichsam in jeder Stunde umzusetzen, wohl aber alle Punkte ausge-wählt und gezielt in die eigene Unterrichtsplanung einzubeziehen. Die anschließend vorge-stellten Maßnahmen stellen Schwerpunkte vor und müssen in der konkreten Planung, ange-passt an die spezifischen Bedingungen, ausgewählt werden. Die Hinweise bewegen sich auch hier auf verschiedenen Ebenen der Unterrichtsplanung und berücksichtigen allgemein- wie fachdidaktische Elemente.
A) Zielgruppenbeteiligung suchen
Inklusiver Geschichtsunterricht sollte nicht nur für, sondern mit den Zielgruppen gestaltet werden.
Zu allererst scheint es mir wichtig zu sein, soweit möglich, diejenigen, für die die Planungsarbeit gemacht wird, als Expertinnen und Experten für sich selbst wahr- und ernst zu nehmen. Das bedeutet, die Zielgruppen der Planung aktiv mit einzubeziehen, mit ihnen über ihre Erfahrungen, Bedürfnisse, aber auch besonderen Schwierigkeiten zu reden und sie als Partner/innen, auch für die Planung, zu gewinnen. Wenn Ge-schichtsunterricht der Orientierung in der Zeit dienen soll, so müssen Lernende auch Experten und Expertinnen ihrer individuellen Orientierungsbedürfnisse werden, ihre eigenen Fragen und Interessen entwickeln und einbringen. „Betroffene“ wissen häufig selbst, was ihnen gut tut, wann und wie sie Lernerfolge finden können. Hierzu gehört es auch, den Lernenden Feedbackmöglichkeiten zu geben und mit ihnen gemeinsam Unterrichtsprozesse und Lerninhalte auszuwerten, um die Erkenntnisse für die weitere Planung zu nutzen.
B) Anschaulichkeit und Handlungsorientierung als Grundprinzipien beachten
Inklusiver Geschichtsunterricht braucht besonders viel Anschauungsmaterial sowie aktive Handlungsmöglichkeiten, um Vorstellungen von der Geschichte zu entwickeln und Begegnungen zwischen der Geschichte und ihren Menschen und dem lernenden Subjekt zu ermöglichen.
Möglichst konkrete und sinnliche Erfahrungen sind für alle Lernenden hilfreich, wenn es darum geht, neues Wissen zu erwerben und es zu integrieren. Für Lernende mit Lernproblemen ist es besonders relevant, Unterrichtsstoff zunächst sprichwörtlich in ihren optischen (Verwendung von Bildmaterial!) und dann auch in ihren Erfahrungshorizont zu bringen. Gerade Themen und Probleme in und aus der Vergangenheit können in ihrer Fremdheit nicht nur auf einer abstrakten Ebene gedacht und verstanden werden. Wer sich ein Bild machen kann, wer eine Handlung vollzieht, eine Erfahrung macht, kann eine Beziehung knüpfen, kann die Bilder und Erfahrungen integrieren (und kann auch etwas berichten, vgl. C!). Wer etwas berichtet, denkt gleichzeitig darüber nach und hat die Chance, das Entdeckte durch die Kombination von Handlung und Versprachlichung zu integrieren. Auswendig zu lernen fällt Schülerinnen und Schülern mit Lernproblemen ohnehin schwer und das „Gepaukte“, aber nicht „Begriffene“ wird sich nicht in die semantische Netzstruktur einfügen, sondern als träges Wissen fast unmittelbar verloren gehen. Hieraus ergibt sich auch die folgende These.
C) Selbstständiges Narrativieren und Erzählen von Geschichte ermöglichen
Inklusiver Geschichtsunterricht braucht unmittelbare Gelegenheiten für das Erzählen von Geschichte und das Versprachlichen von Gedanken durch die Lernenden.
Anschauungen und Erfahrungen müssen möglichst unmittelbar mit eigenen Worten wiedergegeben werden. Lernende brauchen die Chance, das, was sie gesehen, erfah-ren, wahrgenommen und gedacht haben, mit eigenen Worten zu erzählen. Mit eigen-ständigen narrativen Deutungen bringen sie zum Ausdruck, was sie über Geschichte wissen und denken und wie sie das Gelernte für sich und ihre Gegenwart verarbeiten. Erst mit einer Versprachlichung wird Sinnbildung nachhaltig betrieben. Damit kann eine Begriffsbildung einhergehen, die mit einer für das Individuum überschaubaren und handhabbaren Anzahl von Fachbegriffen arbeitet. Es kann und soll im inklusiven Geschichtsunterricht nicht um ein bestimmtes und schon gar nicht für alle gleiches Quantum an abrufbarem Wissen gehen, wohl aber um Deutung und Sinnbildung.
D) Geschichtsbewusstsein durch Lebenswelt- und Gegenwartsbezüge berücksichtigen
Auch und besonders inklusiver Geschichtsunterricht verhilft Lernenden zu einer Orientierung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, will Sinnbildung initiieren und damit das Geschichtsbewusstsein der Lernenden fördern.
Hierfür ist besonders in der Themenformulierung und in der Aufbereitung der Lernin-halte auf Lebenswelt- wie auf Gegenwartsbezüge zu achten, denn wenn es solche An-knüpfungspunkte gibt, kann Geschichte unmittelbar bedeutsam werden (vgl. das Bei-spiel vom Beginn). Wie ist es zu heutigen Bedingungen und Problemen gekommen? Warum feiern wir bestimmte Anlässe? Wie sind Zusammenhänge aus dem Umfeld, der Region, zu verstehen? Solche Fragen können das Interesse für die Prozesse des Gewordenseins wecken. Auch das Anknüpfen z.B. an grundlegende Erfahrungen, die Lernende mitbringen, kann eine „Tür“ zur Geschichte bilden. Hierzu zählen z.B. Erlebnisse und Erfahrungen von Macht und Ohnmacht, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Erfolg und Misserfolg, Benachteiligung oder Teilnahme, Glück und Unglück usw. Wenn hier auch der Gefahr zu begegnen ist, dass unzulässige Analogien zu historischen Situationen vermieden werden müssen, so sollten lebensweltliche Bezüge dennoch mit ihrem Potential ausgelotet und berücksichtigt werden.
E) Medien und Materialien bewusst auswählen
Inklusiver Geschichtsunterricht braucht eine gezielte Auswahl von Medien, die helfen, Lernprobleme zu mindern.
Lerninhalte zur Geschichte sind immer Reisen in (entfernte) Zeiten und Räume. Um sowohl die Geschichte als auch sich selbst in Bezug auf die Geschichte in Raum und Zeit zu verorten, benötigen Lernende Orientierung und wiederum Veranschaulichung. Für alle Lernenden hilfreich und unterstützend, für Lernprobleme jeglicher Art unver-zichtbar, sind Medien, die diese Orientierung erleichtern.
Ein Zeitstrahl im Klassenraum, der nicht nur Jahreszahlen, Daten und kurze Erklärungen enthält, sondern auch eine Bebilderung, die für Ankerpunkte sorgt sowie einfaches Kartenmaterial, auf das immer wieder Bezug genommen werden kann, sollten ständige Begleiter des Geschichtsunterrichts sein. Die Fragen also „In welcher Zeit sind wir unterwegs?“ und „Wo ereignete sich die Geschichte eigentlich?“ sollten immer durch Anschauungsmaterial zu beantworten sein.
Die Relevanz von Bildmaterial soll hier für eine angemessene Anschaulichkeit noch-mals, vor allem für Lerner/innen mit Lernproblemen, betont werden. Während abs-trakte Zusammenhänge und durch Texte vermitteltes Wissen schwierig zu verstehen und zu integrieren sind, haben Bilder eine größere Chance, aufgenommen und verar-beitet zu werden. Bei den Lernenden sollten auch eigene Bilder im Kopf entstehen können, die abgespeichert werden und durch deren Abruf auch zusätzliche Informationen nutzbar bleiben, die mit den Bildern im Kontext aufgenommen wurden und daran gleichsam „angedockt“ bleiben. Diese abgespeicherten Bilder können zum einen aus Material bestehen, das der Unterricht anbietet. Zum anderen können sie auch aus Vorstellungen erwachsen sein, die die Lernenden z. B. durch Erzählungen, durch Ge-schichten, entwickelt haben.
Verständliche Texte werden für Geschichtsunterricht unverzichtbar bleiben, denn Geschichte vermittelt sich vornehmlich durch schriftliche Erzählungen. Für den inklusiven Geschichtsunterricht wird mit unterschiedlichen Texten zu arbeiten sein, die immer verständlich und für die Gruppen oder Einzelnen angemessen im Blick auf viele Faktoren sein müssen (Sprache, Komplexität, Länge usw). Hervorzuheben sind Bio-graphien und „Geschichten“. Biographien (22) stellen als (schriftliche und mündli-che) Erzählungen gut geeignete und nachvollziehbare Zugänge dar. Sie können, redu-ziert und konzentriert auf menschliche Schicksale, Geschichte in vergleichsweise leicht fassbaren, überschaubaren Zusammenhängen transportieren. Durch die Gegen-überstellung von mindestens zwei unterschiedlichen Biographien kann die Vielfalt der Vergangenheit deutlich werden und unzulässige Zuspitzungen können vermieden werden.
Auch eine Interesse weckende, spannende Erzählstruktur, in „Geschichten“ über die Geschichte, z.B. in Form einer Lehrererzählung, kann die Lernenden motivieren und ansprechen. In einer solchen narrativen Struktur, die einem Plot folgt und an (realen, aber auch fiktiven, jedoch triftig ausgewählten) handelnden Personen und ihren Schicksalen orientiert ist, können Ereignisse und Zeitabläufe wie auch die Prozesshaftigkeit von Geschichte vergleichsweise einfach deutlich werden. Individuelle Geschichten, das gilt für Biographien wie für Geschichtserzählungen, können Typisches verdeutlichen, ohne dass Klischees bedient werden müssen.
Eine besondere Schwierigkeit bildet sicher die Einbeziehung von schriftlichen Quel-len, die in der Regel nur gekürzt und vor allem für das Schülerverständnis „über-setzt“, sinnvolle Verwendung finden können. Hier ist zu einer Nutzung zu raten, wenn die Quelle einem konkreten Ereignis oder einer Person zuzuordnen ist, so dass Verstehen und Vernetzen möglich werden.
F) Wechselnde und den individuellen Belangen angepasste Sozialformen auswählen
Inklusiver Geschichtsunterricht braucht den individuellen Bedingungen angepasste Sozialformen, die individualisierende und kooperative Lernformen, aber auch darin integriert, strukturierende Instruktionsphasen berücksichtigen.
Ein Wechsel der Lern- und Arbeitsformen in einem Lernarrangement sorgt nicht „ein-fach“ nur für Abwechslung, sondern befördert das Lernen gezielt. Bedeutsam ist wei-terhin, dass insbesondere Lernende mit Lern- oder Konzentrationsproblemen mög-lichst viele unmittelbare Lern- und Arbeitssituationen vorfinden, d.h. an das individu-elle Leistungsvermögen angepasste Einzel- und Partnerarbeit sowie Kleingruppenar-beit, die nicht mehr als vier Lernende umfasst. Lehrerzentrierte Phasen können vor al-lem das gezielte Erzählen, Erklären (23) und Strukturieren von Geschichte, das Vor-machen und Anleiten von fachspezifischen Methoden ergänzen.
Darüber hinaus wird sich das Prinzip des Tutoriums für den inklusiven Unterricht als besonders hilfreich und effektiv erweisen. Das Setting sieht vor, dass ein/e leistungs-stärkere/r Schüler/in eine/n leistungsschwächere/n Schüler/in unterstützt/unterrichtet, ohne zu diskriminieren und ohne zu bevormunden. Hierfür gibt es im Einzelnen viele überzeugende theoretische Grundlagen sowie auch positive Konsequenzen, interessanter und wichtiger Weise nicht nur für die zu Unterstützenden, sondern ebenso für die Unterstützer/innen!(24)
Für Gruppen- und Plenumssituationen ist es besonders bedeutungsvoll, dass gute Sicht-, Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten herrschen. Die Sitzordnung muss also so angepasst sein, dass sich alle, die miteinander kommunizieren, auch anschauen können und dass die Körpersprache gegenseitig wahrgenommen werden kann.
G) Methoden und Lehr- und Lernwege bevorzugen, die Individualisierung und Binnendifferenzierung besonders befördern und den Unterricht öffnen (Projekte, Wochenplanarbeit, Stationenlernen und Co)
Inklusiver Geschichtsunterricht sollte Lehr- und Lernformen bevorzugen, die den in-dividuellen Rhythmus, die Eigenaktivität und Eigenverantwortlichkeit der Lernenden unterstützen und herausfordern.
Hierzu gehören vor allem Lern- und Arbeitsformen, die den Unterricht öffnen und in-dividualisieren. Wenn nicht alle entgegen ihrer Verschiedenheit gleichzeitig das Gleiche lernen und bearbeiten müssen, öffnen sich Türen für ein individuelles Arbeiten sowie punktuelle Unterstützungsmöglichkeiten für die Lehrkraft. Lernen ist ein individueller Prozess, das bedeutet, dass es unterschiedliche bereichsspezifische Vorkenntnisse gibt, subjektive Begriffe und Theorien bei den Lernenden, unterschiedliche Lerntempi, Lernstrategien und Lernmotivationen. Wenn diese berücksichtigt werden und es Wahlmöglichkeiten der Lernenden gibt, so werden sich Motivation und erfolgreiche Lernergebnisse einstellen. So können beispielsweise in einem Stationenlernen Arbeitstempi selbst bestimmt werden, in der Regel inhaltliche Prämissen durch die Interessen der Lernenden gesetzt werden, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in den Aufgabenstellungen und den Materialien mit überschaubarem Aufwand umgesetzt werden und anderes mehr.
Bei der Öffnung von Unterricht sollten Lehrkräfte versuchen, bewusst außerschulische Kooperationspartner/innen zu gewinnen und deren Kompetenzen und Ressourcen einzubinden.
H) Auf alters- und entwicklungsangemessenes Material achten
Inklusiver Geschichtsunterricht benötigt Material, das Geschichte in einer den Lernenden und ihren individuellen Möglichkeiten angepassten Komplexität und Sprache behandelt.
In der schwierigen Situation, kein angemessenes Unterrichtsmaterial vorzufinden, das den Lernschwierigkeiten der Zielgruppe oder Einzelner gerecht wird, besteht die Gefahr, zu Material zu greifen, das für geschichtsinteressierte, aber „kleine“ Kinder durch Verlage bereitgestellt wird. Hiermit werden eventuell allgemeine Parameter, wie einfache Sprache oder Bebilderung eingelöst. Wenn der Schwierigkeitsgrad und die Quantität der Texte als angemessen erscheinen, wäre ein Problemfeld gelöst. Häufig wird hierdurch jedoch ein anderes „mitgekauft“, diese Materialien sind eben für jüngere Kinder und nicht für Jugendliche verfasst. Ihr Einsatz führt u.U. zu einer nicht angemessenen Ansprache der Lernenden oder zu Bildmaterial, das naive Vorstellungen transportiert. Die Jugendlichen fühlen sich hier zu Recht nicht ernst genommen, so z.B., wenn für den Lerngegenstand Mittelalter in der Klasse 7 oder 8 Material genutzt wird, das für 6-8jährige konzipiert wurde.
Ausblick
So eindeutig notwendig Binnendifferenzierung und Individualisierung für heterogene Gruppen und inklusiven Unterricht sind, so vielgestaltig sind die Wege und Möglichkeiten, sie umzusetzen.
Sicherlich, auch das muss zum Ende diese Artikels gesagt sein, wird die wohlmeinendste und engagierteste Unterrichtsplanung angesichts vieler Begleitumstände nicht alle Herausforde-rungen und Probleme gleichermaßen in den Griff bekommen und schon gar nicht ausgleichen können, was auf der Systemebene versäumt wird. Auch steht fest, dass konsequente Binnendifferenzierung und Individualisierung für Lehrende viel Aufwand und einen hohen Einsatz bedeuten; (dauerhafte) Überforderung tut jedoch niemandem gut.
Chancen von Kooperation nutzen!
Statt als Einzelkämpfer/in unterwegs zu sein, sollten gegenseitige Stärkung und Unterstüt-zung, der Aufbau von Netzwerken, auch mit außerschulischen Partner/innen, aber auch Fort- und Weiterbildung angeboten und genutzt werden.
Trotz des notwendigen Problembewusstseins, Heterogenität nicht als Stör-, sondern als Nor-malfall anzusehen, die Unterschiede zu nutzen und dennoch die Gemeinsamkeiten zu stärken, Defizitansätze zu überwinden durch einen „diversity-Ansatz“, all das kann und will auch Mut machen, sich auf die Herausforderungen einzulassen und Bewährtes, aber auch Neues anzuwenden und auszuprobieren.
Die Grundhaltung bei Lehrenden und Lernenden, das muss immer wieder betont werden, sollte immer am Erfolg orientiert sein. Hierfür will der Artikel Denkanstoß und Wegbereiter sein.
Anmerkungen
1. Vgl. Jörg Dräger, Individuelle Förderung für ein faires und leistungsstarkes Schulsystem. In: Heterogenität und Bildung, 2009, S. 4.
2. Vgl. Ingrid Kunze, 2009, S. 15-17.
3. Ergebnisse sind nachzulesen bei Claudia Solzbacher, 2009, S. 28-41. Grundlage der Studie bilden 51 Interviews mit Lehrkräften in NRW und im Raum Osnabrück sowie 104 ausgefüllte Fragebogen (von Lehrkräften verschiedener Schularten, Raum Osnabrück).
4. Vgl. Claudia Solzbacher, S. 41.
5. Die hier verabschiedete Resolution vgl. unter www.dielebenshilfe.at/Salamanca-Konferenz-Resolution.705.0.html
6. Nachzulesen unter files.institut-fuer-menschenrechte.de/437/Behindertenrechtskonvention.pdf
7. Vgl. www.bundesregierung.de/Content/DE/Pressemitteilungen/BMG/2009/03/2009-03-26-un-bhindertenrechtskonvention.html
8. Jürgen Oelkers setzt sich mit den Barrieren auseinander und unterscheidet dabei in die drei Ebenen Schule, Unterricht, Region und Land, vgl. Oelkers 2009, S. 9-35
9. Ewald Feyerer, 2003, bidok.uibk.ac.at/library/beh1-03-feyerer-bildungsprozesse.html
10. Vgl. Alfred Sander 2003, Kapitel 3.2
11. daselbst, S. 129
12. Gemäß dem Artikel 24 (Bildung) im Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Be-hinderungen, vgl. www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/PDF-Dateien/Pakte_Konventionen/CRPD_behindertenrechtskonvention/crpd_de.pdf, S. 23f
13. Hinweise für die einzelnen Förderschwerpunkte und ihre Besonderheiten aus erziehungswissenschaftlicher Sicht vgl. Jutta Schöler 2009 und insbesondere für verhaltensauffällige Kinder in den Aufsätzen bei Ulf Preuss-Lausitz (Hrsg.), 2005.
14. Alle Zahlen vgl. KMK-Statistik, S. XI-XVI und S. 3.
15. Vgl. z.B. die Sonderpädagogikverordnung Berlins, 2005, vgl. www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/rechtsvorschriften/sopaed_vo.pdf
16. Vgl. Manfred Bönsch 2009, S. 36-38.
17. Vgl. Liane Paradies, S. 66f.
18. Vgl. Peter Adamski, S. 2-13.
19. Vgl. die Map im gedruckten Aufsatz. Sie zeigt Möglichkeiten der Binnendifferenzierung auf, z.B. im Blick auf die Materialien und Zugänge zur Geschichte, die Produkte, und Präsentati-onsmöglichkeiten, die Lehr- und Lernwege, die Art der Gruppenzusammensetzung, unter-schiedliche Lernorte u.v.a.m.
20. Hier sind auch die gesonderten Rahmenlehrpläne zu beachten.
21. Für die zusammenfassende und ergänzende Tabelle vgl. den gedruckten Aufsatz.
22. Vgl. auch Oliver Musenberg und Detlef Pech 2010
23. Vgl. Birgit Wenzel 2009.
24. Vgl. Klaus Feldmann und Elisabeth Wendebourg, 2009, S. 111-117 sowie Dario Ianes, 2009, S.119-121; Ianes verweist richtig auch auf die Möglichkeit, dass auch die lernschwächeren Lernenden, wenn möglich, als Tutorinnen und Tutoren eingesetzt werden sollten.
Literatur:
Adamski, Peter, Auf vielen Wegen ins Land der Pharaonen. Innere Differenzierung im Geschichtsunterricht, in: Geschichte Lernen (2009), Heft 131 (Differenzierung), S. 2-13
Barow, Thomas, Globale Konferenz über inklusive Bildung in Salamanca, in: Zeitschrift für Inklusion (2010), Heft 1, vgl. auch www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/viewArticle/45/52
Barsch, Sebastian, Geschichtsunterricht an der Schule für Geistigbehinderte, in: Zeit-schrift für Heilpädagogik (2001), Heft 12, S. 515-518
Bönsch, Manfred, erfolgreiches Lernen durch Differenzierung im Unterricht, Braun-schweig 2009
Feldmann, Klaus; Wendebourg, Elisabeth, Schülerinnen und Schüler als Tutoren, in: Kunze, Ingrid; Solzbacher, Claudia (Hrsg.), Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II, 2. unverä. A., Hohengehren-Baltmannweiler 2009, S. 111-117
Feyerer, Ewald, Pädagogik und Didaktik integrativer bzw. inklusiver Bildungsprozes-se. Herausforderung an Lehre, Forschung und Bildungsinstitutionen, in: Behinderte in Fami-lie, Schule und Gesellschaft (2003), Heft 1, Graz, S.38-52, vgl. auch bidok.uibk.ac.at/library/beh1-03-feyerer-bildungsprozesse.html
George, Uta; Winter, Bettina, Wir erobern uns unsere Geschichte. Menschen mit Be-hinderungen arbeiten in der Gedenkstätte Hadamar zum Thema NS-„Euthanasie“-Verbrechen, in: Zeitschrift für Heilpädagogik (2005), Heft 2, S. 55-62
Heese, Thorsten, Vergangenheit „begreifen“. Die gegenständliche Quelle im Ge-schichtsunterricht, Schwalbach/Ts. 2007
Hinz, Andreas, Heterogenität in der Schule. Integration – Interkulturelle Erziehung – Koedukation (1993), vgl. bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet_schule.html
Ianes, Dario, Die besondere Normalität. Inklusion von SchülerInnen mit Behinderung, (aus dem Italienischen), München, Basel 2009
Kultusministerkonferenz: Statistische Veröffentlichungen. Sonderpädagogische Förderung in Schulen 1997 bis 2006, Dokumentation Nr. 185-April 2008, vgl. www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2004/Dok185.pdf
Kunze, Ingrid, Begründungen und Problembereiche individueller Förderung in der Schule – Vorüberlegungen zu einer empirischen Untersuchung, in: Kunze, Ingrid; Solzbacher, Claudia (Hrsg.), Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II, 2. unverä. A., Hohengehren-Baltmannweiler 2009, S. 13-26
Musenberg, Oliver/Pech, Detlef, Geschichte thematisieren - historisch lernen, in: Ratz, Christoph (Hrsg.): Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderung, Oberhausen, 2011
Oelkers, Jürgen, Barrieren für individuelle Förderung im Bildungssystem und ihre Bearbeitung, in: Heterogenität und Bildung. Individuelle Förderung in Deutschland – Hindernisse und Herausforderungen basierend auf einer Expertise von Prof. Dr. J. Oelkers, Bertelsmann Stiftung (2009)
Paradies, Liane, Innere Differenzierung, in: Kunze, Ingrid; Solzbacher, Claudia (Hrsg.), Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II, 2. unverä. A., Hohengehren-Baltmannweiler 2009, S. 65-74
Ricking, Heinrich, Die Reise nach Amerika: Carl Meyer wandert aus. Geschichtsun-terricht in einer achten Klasse einer Schule für Lernhilfe, in: Zeitschrift für Heilpädagogik (2002), Heft 7, S. 286-288
Sander, Alfred, Über Integration zur Inklusion, St. Ingbert 2003, [Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik, Bd. 12]
Schöler, Jutta, Alle sind verschieden. Auf dem Weg zur Inklusion in der Schule, Weinheim und Basel, 2009
Schönrock, Hannelore, Die Abhängigkeit der Bauern in der Grundherrschaft. Geschichtsunterricht in einer Lernhilfeklasse der Schule für Erziehungshilfe, in: Zeitschrift für Heilpädagogik (1997), Heft 6, S. 242-248
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Berlin, Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, (Sonderpädagogikverordnung - SopädVO), Juni 2009, vgl. www.berlin.de/sen/bildung/bildungswege/foerderschule/
Solzbacher, Claudia, Positionen von Lehrerinnen und Lehrern zur individuellen Förderung in der Sekundarstufe I – Ergebnisse einer empirischen Untersuchung, in: Kunze, Ingrid; Solzbacher, Claudia (Hrsg.), Individuelle Förderung in der Sekundarstufe I und II, 2. unverä. A., Hohengehren-Baltmannweiler 2009, S. 27-42
Wenzel, Birgit, Geschichte erklären, in: Rüdiger Vogt (Hrsg.), Erklären. Gesprächs-analytische und fachdidaktische Perspektiven, (= Stauffenberg Linguistik), 2009
Wenzel, Birgit: Kreative und innovative Methoden. Geschichtsunterricht einmal an-ders, Schwalbach,Ts, 2010
(Birgit Wenzel: Heterogenität und Inklusion - Binnendifferenzierung und Individualisierung. Der vollständige Aufsatz erscheint in: Michele Barricelli/Martin Lücke (Hg.): Handbuch "Praxis des Geschichtsunterrichts". Historisches Lernen in der Schule, Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag 2011)
Inhalt
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Übungen

Glossar
Hilfe
Gebärdensprache
Leichte Sprache
Herzlich Willkommen auf unserer Internet-Seite
Herzlich Willkommen auf unserer Internet-Seite
Wir sind das Deutsche Institut für Menschenrechte.
Sie finden hier Infos zu Menschenrechten von Menschen mit Behinderung.
Warum gibt es diese Internet-Seite?
Es geht um die Geschichte von Rechten für Menschen mit Behinderung.
Hier gibt es Infos und Lern-Materialien zu dem Thema.
In vielen Ländern gelten heute die gleichen Rechte
für Menschen mit Behinderung.
Die Rechte gehören zu den Menschenrechten.
Die Rechte stehen in einem Vertrag.
Der Vertrag heißt: UN-BRK.
Das ist kurz für UN-Behinderten-Rechts-Konvention.
Der Vertrag gilt in Deutschland seit dem Jahr 2009.
Ein wichtiger Begriff in der UN-BRK ist Inklusion.
Inklusion bedeutet:
Menschen mit Behinderung sollen überall
mitmachen und mitbestimmen können.
Sie finden hier Antworten auf diese Fragen:
- Welche Rechte haben Menschen mit Behinderungen heute?
- Welche Rechte hatten Menschen mit Behinderungen früher?
Zum Beispiel vor 2800 Jahren, vor 500 Jahren oder in den letzten 100 Jahren. - Was machte Menschen mit Behinderung das Leben leichter oder schwerer?
- Wie entstehen neue Verträge für Menschenrechte?
- Wie kann man über die Themen Menschenrechte und Behinderung in der Schule reden?
- Was kann man für Kinder mit Behinderung im Kindergarten tun?
Lern-Materialien finden
Sie finden hier verschiedene Lern-Materialien.
Zum Beispiel:
- Info-Texte
- Spiele
- Aufgaben für Gruppen-Arbeit
Sie können nach bestimmten Lern-Materialien suchen.
Sie können dabei genau einstellen:
- Sollen die Lern-Materialien leicht, mittel oder schwer sein?
- Für welches Schul-Fach sollen die Lern-Materialien sein?
- Für welche Schul-Art sollen die Lern-Materialien geeignet sein?
Wir haben alles einfach geschrieben.
Aber die Texte sind nicht in Leichter Sprache.
Jahres-Zahlen
Oben finden Sie die Jahres-Zahlen:
-800, 500, 1500, 1933, 1945 und 1994.
Klicken Sie auf eine Jahres-Zahl.
Dann finden Sie Infos über das Leben
von Menschen mit Behinderung zu der Zeit.
Zum Beispiel zu alten Gesetzen oder Lebens-Geschichten.
Sie finden auch Ideen für Übungen oder Spiele im Unterricht.
Für wen ist diese Internet-Seite?
Alle Menschen können hier Infos über Behinderung und Inklusion bekommen.
Und man kann Ideen für Lern-Übungen bekommen.
Die Internet-Seite ist zum Beispiel eine Hilfe für:
- Lehrer und Lehrerinnen.
- Jugendliche und Erwachsene in Selbsthilfe-Gruppen, im Jugendzentrum oder in der Jugendgruppe.
- Erzieher und Erzieherinnen in Kitas.
- Ausbilder und Ausbilderinnen in Heilerziehungspflege-Schulen, Erzieherinnen-Fachschulen und Altenpflege-Schulen.
Von wann sind die Infos auf dieser Internet-Seite?
Die Internet-Seite ist aus dem Jahr 2011.
Dann haben wir sie nicht mehr geändert.
Haben Sie Fragen?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: web@dimr.de
Erklärung zur Barrierefreiheit
Erklärung zur Barrierefreiheit
Wie barrierefrei ist unsere Internet-Seite?
Wir sind das Institut für Menschenrechte.
Auch Menschen mit Behinderung sollen
unsere Internet-Seite gut nutzen können.
Dafür gibt es Regeln im Gesetz.
Die Gesetze heißen:
- Behindertengleichstellungs-Gesetz
- BITV
Das ist kurz für Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung.
Dieser Text ist unsere Erklärung zur Barrierefreiheit.
In dieser Erklärung zur Barrierefreiheit steht:
- Was ist schon barrierefrei?
- Was ist nicht barrierefrei?
- Wo können Sie sich bei Problemen beschweren?
Die Erklärung gilt für die Internet-Seite:
www.inklusion-als-menschenrecht.de
Welche Regeln für Barriere-Freiheit halten wir ein?
- Regeln aus der BITV 1.
BITV ist kurz für: Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung. - Regeln aus der WCAG.
Das ist eine englische Abkürzung.
Auf Deutsch heißt das: Richtlinien für barrierefreie Webinhalte. - Regeln für valides CSS und für validen HTML-Code.
Das sind Regeln für die Programmierer von Internet-Seiten.
Was ist nicht barrierefrei?
Einige PDF-Dateien sind nicht barrierefrei.
Das heißt: Vorlese-Programme können diese PDF-Dateien nicht vorlesen.
Wir schreiben bei diesen PDF-Dateien dazu, dass sie nicht barrierefrei sind.
Haben Sie Probleme oder Barrieren auf der Internet-Seite gefunden?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: web@dimr.de
Beschreiben Sie bitte das Problem oder
die Barriere in der E-Mail.
Hat es keine gute Lösung für Ihre Beschwerde gegeben?
Dann können Sie sich beschweren.
Es gibt eine Schlichtungsstelle für die Beschwerden.
Der Name ist:
Schlichtungsstelle nach § 16 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG).
Die Schlichtungsstelle kümmert sich bei Streit zwischen:
- Menschen mit Behinderung und
- öffentlichen Stellen des Bundes.
Das sind zum Beispiel Ministerien und einige Stiftungen.
Die Schlichtungsstelle sucht eine Lösung.
Dann muss man mit dem Streit nicht vor Gericht gehen.
Sie müssen nichts für die Schlichtungsstelle bezahlen.
Sie brauchen keinen Anwalt oder Anwältin.
Mehr Infos zur Schlichtungsstelle finden Sie hier:
Zum Beispiel:
Was müssen Sie für eine Beschwerde tun?
Die Infos gibt es auch in Gebärden-Sprache
und in Leichter Sprache.